Peter Kaiser Und Die Entdeckung Des Liechtensteinischen Volkes*"*
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Amschwand Et Al., Bleis Marscha
Deciphering the evolution of the Bleis Marscha rock glacier (Val d’Err, eastern Switzerland) with cosmogenic nuclide exposure dating, aerial image correlation, and finite- element modelling Dominik Amschwand1,3, Susan Ivy-Ochs1,2, Marcel Frehner1, Olivia Steinemann2, Marcus Christl2, 5 Christof Vockenhuber2 1Department of Earth Sciences, ETH Zurich, 8092, Zurich, Switzerland 2Laboratory of Ion Beam Physics, ETH Zurich, 8093, Zurich, Switzerland 3Now at: Department of Geosciences, University of Fribourg, 1700, Fribourg, Switzerland Correspondence to: Dominik Amschwand ([email protected]) ORCID: 0000-0003-2179-1481 10 Abstract. We constrain the Holocene morphodynamic development of the active Bleis Marscha rock glacier (Err-Julier area, eastern Swiss Alps) with fifteen 15 cosmogenic nuclide exposure ages (10Be, 36Cl), 2003/2012 horizontal surface creep rate quantification from by orthophoto orientation correlationcorrelating two orthophotos from 2003 and 2012, and finite element modelling to separate the control exerted by topography and material composition on surface movement. and semi- quantitative ice-content estimates from finite-element modelling. The results suggest that the complex Bleis Marscha rock 15 glacier formed during two activity phases, one in the early Holocene and one in the late Holocene, separated by a mid- Holocene period of inactivation. The now transitional-inactive low-elevation lobes (first generation) formed after the retreat of the Egesen cirque glacier in a pulse-like manner at 11.5–9.0 ka. Rock-glacier viscosities inverted with the finite-element model hint at ground ice in these lobes which is possibly as old as its early-Holocene debris cover. In contrast to the debris- conditioned rapid emplacement, the thermally controlled permafrost degradation is still ongoing, likely attenuated by thermal 20 decoupling from the insulating coarse-debris boulder mantle. -

Austria͛s Internaional Posiion After the End Of
ƵƐƚƌŝĂ͛Ɛ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWŽƐŝƟŽŶ ĂŌĞƌƚŚĞŶĚŽĨƚŚĞŽůĚtĂƌ Günter Bischof, Ferdinand Karlhofer (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | VOLUME 22 UNO PRESS innsbruck university press Copyright © 2013 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form, or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage nd retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive. New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America Design by Lauren Capone Cover photo credit: Hopi Media Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press ISBN: 9781608011162 ISBN: 9783902936011 UNO PRESS Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Ferdinand Karlhofer, Universität Innsbruck Assistant Editor Production and Copy Editor Dominik Hofmann-Wellenhof Lauren Capone University of New Orleans Executive Editors Christina Antenhofer, Universität Innsbruck Kevin Graves, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver Wirtschaftsuniversität -
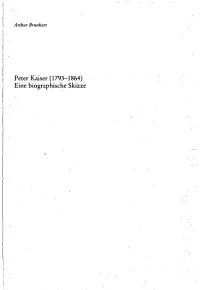
Peter Kaiser (1793-1864) Eine Biographische Skizze Peter Kaiser (1793-1864)
Arthur Brunhart Peter Kaiser (1793-1864) Eine biographische Skizze Peter Kaiser (1793-1864) "Die Ehre liege übrigens, nach meinem Dafürhalten, im Bewussuein des Guten, was man gewollt und vollbracht hat, und insofern ist sie weder einer Minderung noch einer Mehrung fähig." (Peter Kaiser, 1842) Thema und Eingrenzung Vorerst möchte ich mich beim einladenden Liechtenstein-Institut und bei der Peter Kaiser Stiftung dafür bedanken, dass ich als Bürger dieses Landes Gelegenheit erhalte, über den Lebensweg eines der bedeutendsten Liechtensteiner, Peter Kaiser, sprechen zu dürfen. Das Referat ist das erste einer Reihe von Vorträgen, die sich mit Fragen um Per son und Wirken Kaisers befassen. Meine Aufgabe sehe ich darin, das Wissen, wel ches Sie über diesen Liechtensteiner ganz zweifellos besitzen, etwas aufzufrischen, damit der allgemeine historisch-biographische Hintergrund der Person Peter Kai sers präsent ist, wenn in den folgenden Referaten von zentralen Bereichen seines Ideengutes, seiner pädagogischen, historiographischen und staatsbürgerlich-politi schen Leistungen die Rede sein wird. Zusätzlich kann dieses und jenes Neue beige bracht werden. Gewisse Überschneidungen mit den folgenden Vorträgen sind unvermeidlich; das eine lässt sich vom andern nicht trennen. Themenbereiche dieses Referates sind somit nicht in erster Linie jene Aspekte, um derentwillen Peter Kaiser bekannt und berühmt geworden ist, sondern vielmehr einige Facetten der allgemeinen Lebensumstände, des Herkommens und Bildungs weges, der jugendlichen Dynamik und des mühsamen Kampfes, den Kaiser durch viele Jahre seines Lebens hindurch ausfechten musste. Die Geschichtsschreiber, die sich bisher mit ihm befasst haben, sind seiner Per son in der Regel mit grosser Sympathie begegnet, mit dem oft unverkennbaren Wil len, ihn von allem, was als Makel gelten konnte, zu befreien, es zu rechtfertigen. -

Dolf Kaiser Neues Von Den Zuckerbäckern Aus Graubünden Nachtrag Zu Einer Bestandesaufnahme
Dolf Kaiser Neues von den Zuckerbäckern aus Graubünden Nachtrag zu einer Bestandesaufnahme Sonderdruck aus: Archiv für Familiengeschichtsforschung Revue de recherches genealogiques Review for Genealogical Studies 2001, 1 - 68 C. A. Starke Verlag: Limburg a. d. Lahn 2001 Dolf Kaiser Neues von den Zuckerbäckern aus Graubünden KAISER Dolf Nachtrag zu einer Bestandesaufnahme Neues von den Zuckerbäckern aus Graubünden. Nachtrag einer Bestandesaufnahme Technik/Material: Broschüre Sonderdruck aus: Archiv für Familiengeschichtsforschung Masse: 16,5x24 cm Standort: Büro 2a Signatur: 10.1.1989 Provenienz: Kaiser, Dolf, Zürich/Bever 10 Nummer: 10-1 06321 . CH-7503 Samedan Tel. +41 (0)81 852 35 31,[email protected] Sonderdruck aus: Archiv für Familiengeschichtsforschung Revue de recherches genealogiques Review for Genealogical Studies 2001, 1 - 68 C. A. Starke Verlag: Limburg a. d. Lahn 2001 Neues von <l en Zuckerbäckern aus Graubünden Neues von den Zuckerbäckern aus Graubünden 1800 Jeanne DANJOYE. Von ihren Kindern wid Alessandria (l) Nachtrag zu einer Bestandesaufnahme mete sich nur Giovan Andrea (* 1805) dem Konditorberuf.Er veränderte seinen Vornamen Jakob Joos von Schiers erwähnt 1862.10 Glossaire la Dolf Kaiser, Carl Spitteler-Strasse 69, CH -8053 Zürich, Tel. 01/381 72 68 in Adrien und war Verfasser des de Amiens (Picardie, F) /angue agennaise .4 Leon JÖRJMANN von Ta mins und Ehefrau Mar Mein 1985 erschienenes Bucl, Fas t ein Volk Spitze des Eisbergs beriihren. Diese Bemerkung Jean ßARANDlJN von Feldis (* 1788) , Konditor, von Zuckerbäckern?1 gueri te ÜLGIATI besassen eine Konditorei an enthielt in seinem doku hat sich in der Ta l bewahrheitet. Die neueren nannte sich in Frankreich BARANDOU, erw. -

Fast Ein Volk Von Zuckerbäckern?
Fast ein Volk von Zuckerbäckern? Bündner Konditoren, Cafetiers und Hoteliers in europäischen Landen bis zum Ersten Weltkrieg Ein wirtschaftsgeschichtlicher Beitrag Stand 02.06.2009 Dolf Kaiser, Fast ein Volk von Zuckerbäckern 1 Inhaltsübersicht Allgemeiner Teil Vorwort Bündner in Venedig bis 1766 Arbeitsbedingungen, Schicksale, Reisen Italien als Auswanderungsland Triest und Dalmatien Zuckerbäcker und Kaffeehausbesitzer in Deutschland Landsleute in Ost- und Nordeuropa Frankreich, Spanien und übrige Länder Europas als Ziel der Auswanderung Schlusswort Dokumentarischer Teil Alphabetische Bestandesaufnahme nach Städten von A bis Z Abkürzungen Zeittafel Genealogische Tabellen Anmerkungen und Quellenangaben Quellenvermittler und Informanten Herkunftsortsverzeichnis Personenverzeichnis Bildnachweis Dolf Kaiser, Fast ein Volk von Zuckerbäckern 2 Vorwort Das Gewerbe der Zuckerbäcker und Cafetiers im Ausland nimmt in der Kultur- und Wirtschaftsgeschichte Graubündens einen wichtigen Platz ein. Wäre es demnach angebracht, die Bewohner dieses Bergkantons als "fast ein Volk von Zuckerbäckern" zu bezeichnen? Der In Schlesien geborene Silvaplaner Konditor und Chronist Giachem L’Orsa beklagte sich 1807 in seinen Aufzeichnungen im "Neuen Sammler", dass es in seinem Heimatdorf keine Schcneider und keine Schuhmacher gebe, dafür aber 28 Zuckerbäcker. Um die Mitte des vorletzten Jahrhunderts schilderten Eugen Baron von Vaerst, der spätere Besitzer und Herausgeber der "Breslauer Zeitung", die Lage dieser" süssen Branche" wie folgt: " Die vorzüglichsten Zuckerbäcker -

FISCAL-MILITARY SYSTEM PROJECT BIBLIOGRAPHY Section A
FISCAL-MILITARY SYSTEM PROJECT BIBLIOGRAPHY (see also www.oxfordbibliograhies.com: “Fiscal-Military State”, “Warfare and Military Organizations”, and “War and Trade”) Section A: Concepts A1 Fiscal-Military State A1.1 FMS Studies A1.2 Taxation in individual states A2 Contractor State A3 Sovereignty A4 International Order A5 War and the State Section B: Agents and Actors B1 Contractors, Enterprisers and Entrepreneurs B2 Patronage B3 Corruption B4 Networks B5 Trust Section C: Fiscal-Military Assets C1 Personnel C1.1 Mercenaries – definition C1.2 Mercenaries as migration C1.3 Foreign soldiers C1.4 PMSCs C1.5 Recruitment C1.6 Privateering C1.7 Prisoners C1.8 Hospitals C2. Expertise C3. Information and Intelligence C4. Finance C4.1 General C4.2 War finance C4.3 Subsidies and pensions C4.4 Credit and Debt C5. War Materials C5.1 General C5.2 Liege Arms Production C5.3 Naval Stores C5.4 Logistics C6. Services C6.1 Ports C6.2 Transit Section D: Economic Aspects 1 D1 General D2 Mercantilism D3 War and Economics D4 Contracts and Treaties D5 Trade Section E: Dismantling the FMSy E1 General E2 Foreign Fighters E3 Neutrality Section F: Case Studies F1. Cities and Hubs F2. Amsterdam F3. Danzig/Baltic F4. Geneva and the Swiss Confederation F5. Savoy-Piedmont F6. Genoa F7. Hamburg F8. London F9. Riga F10. Vienna Section G: Global Comparisons SECTION A: CONCEPTS A1. Fiscal-Military State Blockmans, Wim (ed.), Fiscal Systems in the European Economy from the 13th to the 18th Centuries (Firenze, 2008) Bonney, R., The Rise of the Fiscal State in Europe, c.1200-1815 (Oxford, 1999). -
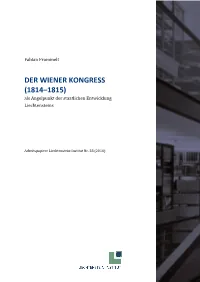
Der Wiener Kongress
Fabian Frommelt DER WIENER KONGRESS (1814–1815) als Angelpunkt der staatlichen Entwicklung Liechtensteins Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut Nr. 58 (2016) Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut Nr. XX (2013) Wilfried Marxer HERAUSFORDERUNG MIGRATION IN UND FÜR LIECHTENSTEIN - SYNTHESEBERICHT Wilfried Marxer HERAUSFORDERUNG MIGRATION IN UND FÜR LIECHTENS TEIN - Fabian Frommelt Forschungsbeauftragter Fachbereich Geschichte [email protected] Arbeitspapiere Liechtenstein-Institut Nr. 58 (2016) Fachbereich Geschichte http://dx.doi.org/10.13091/li-ap-58 Die Verantwortung für die Arbeitspapiere liegt bei den jeweiligen Autoren. © Liechtenstein-Institut 2016 Liechtenstein-Institut Auf dem Kirchhügel St. Luziweg 2 9487 Bendern Liechtenstein T +423 / 373 30 22 F +423 / 373 54 22 [email protected] www.liechtenstein-institut.li ABSTRACT Der Wiener Kongress (1814–1815) gestaltete die europäische Staatenwelt nach Jahren der französischen Hegemonie um, installierte ein neues kollektives Sicherheitssystem und verschaffte Europa eine vierzigjäh- rige Friedensperiode. Deutschland erhielt mit dem Deutschen Bund eine neue staatsrechtliche Form. Die Aufnahme in den Deutschen Bund sicherte dem Fürstentum Liechtenstein die Souveränität, welche es 1806 durch die Rheinbundmitgliedschaft erlangt hatte. Diese Entwicklung verdankte sich nicht vornehmlich der Politik des Fürsten. Vielmehr profitierten Fürst und Land von der Politik anderer Akteure, namentlich Napoleons und Metternichs, der Mächte Österreich, Preussen und Russland, -
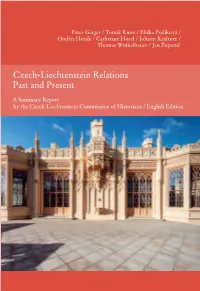
Czech-Liechtenstein Relations Past and Present a Summary Report by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians
In 2009 the Czech Republic and the Principality of Liechtenstein established diplomatic Peter Geiger / Tomáš Knoz / Eliška Fučíková / ties, thus ameliorating a situation which had lasted since 1945 because of the post-war period Ondřej Horák / Catherine Horel / Johann Kräftner / of confiscations in the Czech lands. In 2010 the governments of both countries established a Thomas Winkelbauer / Jan Županič joint commission of historians in order to examine the development of relations within the context of their rich history to the present day, and to explain it not only to the two peoples but also to an international public. This Summary Report by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians contains the results of common research of more than three years, published at first in German and in Czech-Liechtenstein Relations Czech. This English Edition now opens the results to a worldwide public of interested rea- ders and researchers. Historians Past and Present The Summary Report sheds light on the history of the Princely House of Liechtenstein, A Summary Report deeply rooted in the Bohemian Lands since the Middle Ages, als well as on the difficult rela- tions between the Principality and the Czech Republic during the 20th century. It explains by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians / English Edition why the diplomatic ties remained interrupted for more than half a century, and it names questions which are still waiting for solution. Contents: – The Liechtenstein-Czech Commission of Historians – The Liechtensteins: Middle Ages, -

Liechtenstein in European History Ad Honorem Peter Geiger
Studia Historica Brunensia 67 / 2020 / 2 https://doi.org/10.5817/SHB2020-2-1 Liechtenstein in European History Ad Honorem Peter Geiger Tomáš Knoz / [email protected] Historický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, CZ Abstract In its first part, the present article presents the role of Peter Geiger as an historian and as co- chairman of the Liechtenstein-Czech Commission of Historians. PD Dr. Peter Geiger has been / INTRODUCTION ÚVOD the co-chairman of the Liechtenstein-Czech Commission of Historians for the last ten years. Between 2010 and 2020, he was one of its basic building blocks. In the commission, Associate Professor Geiger dealt mainly with the modern history of Liechtenstein and selected aspects of Liechtenstein-Czech relations. He prepared a crucial article on how frequently Czechoslovak and Czech topics figured in the pages of the Liechtenstein press, and thus what impression the ordinary citizen of the Principality of Liechtenstein could form of the original homeland of their princes. In the context of his research into Liechtenstein continuities and discontinuities, he again described the transformation of Liechtenstein from a somewhat marginal territory within the Liechtenstein states into the centre of life of the princely family. Peter Geiger’s pro- fessional interest in the Liechtenstein-Czech Commission of Historians was divided between the history of the family and the history of the country and its inhabitants, especially in the area of property gains and losses. He therefore wrote two fundamental studies on the topic of the “Liechtensteins, Liechtenstein and Czechoslovakia in the 20th Century”. The first of these deals with the efforts of the Liechtenstein family from 1938–1945 to regain and save the prop- erty they lost in connection with the so-called first land reform.