Berliner Schulreform Wenig Verändert Hat
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Germany-Thuringia "Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann
OECD - Innovative Learning Environment Project Universe Case Germany-Thuringia "Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann-Lietz Schule Haubinda" A private full-day boarding school based on reform pedagogic principles by H. Lietz (in tradition of Landerziehungsheime), comprising primary school, secondary school, and technical college for students aged 6 – 20. The school follows official curricula, but in addition emphasizes practical, manual work and cooperative, social skills. Whereas the focus of primary school is on the acquisition of learning methods like individual project work and cooperative learning in mixed-age groups, the higher grades are more subject- oriented. Work forms include participation in scientific competitions, cooperation with local communities, and theatre performances. Communication among teachers is organized (e.g., in teacher groups) in order to encourage interdisciplinary cooperation and unified curricula. A school parliament including students decides on daily school life, and a school board including parents oversees school functioning. Main Focus of Innovation: ORGANISATION, TEACHERS Other keywords: alternative philosophy General Information Name of the ILE: Stiftung Deutsche Landerziehungsheime Hermann-Lietz Schule Haubinda Location/Address: Stiftung 01, 98663 Haubinda, Thuringia, Germany Website: www.lietz-schulen.de ILE submitted by: Thuringian Ministry of Culture and Education 1 OECD - Innovative Learning Environment Project Universe Case Rationale Why do you suggest that it should be included in -
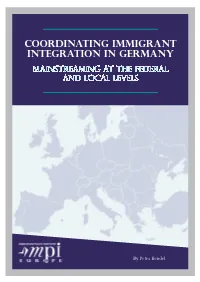
Coordinating Immigrant Integration in Germany Mainstreaming at the Federal and Local Levels
coordinating immigrant integration in germany mainstreaming at the federal and local levels By Petra Bendel MIGRATION POLICY INSTITUTE EUROPE Coordinating immigrant integration in Germany Mainstreaming at the federal and local levels By Petra Bendel August 2014 ACKNOWLEDGMENTS The author is particularly grateful for the assistance of Sabine Klotz and Christine Scharf in research and useful critiques. She would also like to thank all her interview partners in the different ministeries and agencies at the federal and state levels as well as local administrations for their frankness and for providing useful material on ‘best practices’. This report, part of a research project supported by the Kingdom of the Netherlands, is one of four country reports on mainstreaming: Denmark, France, Germany, and the United Kingdom. MPI Europe thanks key partners in this research project, Peter Scholten from Erasmus University and Ben Gidley from Compas, Oxford University. © 2014 Migration Policy Institute Europe. All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopy, or any information storage and retrieval system, without permission from MPI Europe. A full-text PDF of this document is available for free download from www.mpieurope.org. Information for reproducing excerpts from this report can be found at www.migrationpolicy.org/about/copyright-policy. Inquiries can also be directed to [email protected]. Suggested citation: Bendel, Petra. 2014. Coordinating immigrant integration in Germany: Mainstreaming at the federal and local levels. Brussels: Migration Policy Institute Europe. TABLE OF CONTENTS EXECUTIVE SUMMARY ........................................................1 I. INTRODUCTION: THE CONTEXT OF IMMIGRATION AND INTEGRATION IN GERMANY ...........................................2 II. -

Standing up for Equality in Germany’S Schools Standing up for Equality in Germany’S Schools 1
STANDING UP FOR EQUALITY IN GERMANy’S SCHOOLS STANDING UP FOR EQUALITY IN GERMANy’S SCHOOLS 1 INTRODUCTION No country wants to believe that it is It is clear that children from a “migration failing its children in any way. It is difficult background”1 perform significantly to imagine a government that would not worse at school than their native German support the idea of equal education for counterparts. The term “migration back- all. Germany is no exception. And yet, ground” covers children from families in Germany, children of varied ethnic who are still perceived as “foreigners” and racial backgrounds have vastly because of their racial or ethnic identity, different educational opportunities and even though their families may have experiences. arrived in Germany years ago. This should no longer be a surprise. In 2001, an influential European study shocked Germans with the news that their country, which long had prided itself on its excellent educational system, was at the low end of the compara- tive spectrum. The study, undertaken in 2000 by the Program for International Student Assessment (PISA) (an arm of the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD)), showed that German children did poorly in reading, math, and science, in comparison to students from 56 other countries. The PISA study described the deep flaws in the German education system. In particular, it explained that at-risk students—including those of migration, or migrant, backgrounds—performed among the worst in the world. They were more often tracked into the lowest level Hauptschule; they were excluded from the best classrooms; and they had far fewer opportunities to attend Gymnasium, which meant they were not permitted to take the state Abitur examination and attend university. -

Germany's New Security Demographics Military Recruitment in the Era of Population Aging
Demographic Research Monographs Wenke Apt Germany's New Security Demographics Military Recruitment in the Era of Population Aging 123 Demographic Research Monographs A Series of the Max Planck Institute for Demographic Research Editor-in-chief James W. Vaupel Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany For further volumes: http://www.springer.com/series/5521 Wenke Apt Germany’s New Security Demographics Military Recruitment in the Era of Population Aging Wenke Apt ISSN 1613-5520 ISBN 978-94-007-6963-2 ISBN 978-94-007-6964-9 (eBook) DOI 10.1007/978-94-007-6964-9 Springer Dordrecht Heidelberg New York London Library of Congress Control Number: 2013952746 © Springer Science+Business Media Dordrecht 2014 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Exempted from this legal reservation are brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis or material supplied specifi cally for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the Copyright Law of the Publisher’s location, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer. Permissions for use may be obtained through RightsLink at the Copyright Clearance Center. -

Vorgaben Für Die Klassenbildung
Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland IVC DS 1932-5(15)3 Vorgaben für die Klassenbildung Schuljahr 2019/2020 Stand: September 2019 Baden-Württemberg Vorgaben für die Klassenbildung im Schuljahr 2019/2020 Schulart Schüler/innen je Klasse Erläuterungen zur Klassenbildung Vorgaben für die Vorgabe eines Vorgabe für die einzelne Klasse Klassenteilers einzelne Schule auf Klassen- (Orientierungswert) stufenebene (Richtzahl) Untergrenze1) Obergrenze1) 1 2 3 4 5 Grundschule2) 16 28 Orientierungsstufe Hauptschule3) 16 30 Schularten mit mehreren Bildungsgängen Realschule 16 30 Gymnasium 16 30 Integrierte Gesamtschule4) 16 28/30 1) Mindestschülerzahl und Klassenteiler sind Richtwerte zur Bedarfsplanung. Innerhalb des zugewiesenen Budgets ist die Klassengröße flexibel. 2) Auch Primarstufe der Gemeinschaftsschule (in BW Grundschulen im Verbund mit der Gemeinschaftsschule). 3) Ab dem Schuljahr 2010/11 führt BW die Werkrealschule und die Hauptschule. 4) Ab dem Schuljahr 2012/13 führt BW die Gemeinschaftsschule. Bei den Gemeinschaftsschulen (Sek. I) liegt der Klassen-/Gruppenteiler bei 28 Schüler/innen; bei der Sekundarstufe II und den Schulen besonderer Art bei 30 Schüler/innen. Bayern Vorgaben für die Klassenbildung im Schuljahr 2019/2020 Schulart Schüler/innen je Klasse Erläuterungen zur Klassenbildung Vorgaben für die Vorgabe eines Vorgabe für die einzelne Klasse Klassenteilers einzelne Schule auf Klassen- (Orientierungswert) stufenebene (Richtzahl) Untergrenze Obergrenze 1 2 3 4 5 1) Für die Orientierungsstufe und für die 2) Grundschule 13 28 Gesamtschule sind Richtwerte bzw. Grenzen nicht explizit festgelegt. Da sich jedoch die Orientierungsstufe1) Personalzuweisungen bzw. Personalkostenzuschüsse bei diesen Schularten an den für die Mittelschule, die Realschule bzw. Hauptschule5) 155) 302), 5) Budget das Gymnasium geltenden Richtlinien orientieren, halten sich auch die Orientierungsstufe und die Schularten mit mehreren Gesamtschule im Wesentlichen an die für die Bildungsgängen Mittelschule, die Realschule bzw. -

Auf Ein Wort Hauptschule in Berlin Eine Schulform Im Wandel Der Zeit
1 IBS Interessenverband Berliner Schulleitungen e.V. Auf ein Wort Rückblick und Ausblick Sehr geehrte Kolleginnen IBS und langjähriger Leiter einer Hauptschule, würdigt in seinem und Kollegen, Beitrag diese Schulart, die durch die Schulstrukturreform nun der liebe Mitglieder, Vergangenheit angehört. Für diese Ausgabe haben wir zwei Schwerpunkte gesetzt: das dreißigjährige Jubiläum des Zum einen blicken wir zurück auf eine Schulform, die in den IBS hat der Vorstand zum Anlass 1950er Jahren von mehr als der Hälfte aller Oberschülerinnen genommen, um die Verdienste un- und Oberschüler in Berlin-West besucht wurde. Heinz Winkler, seres Verbandes zu würdigen, aber ehemaliger Vorsitzender des IBS und langjähriger Leiter einer Martin Wagner, Vorsitzender auch die Aufgaben und Ziele für Hauptschule, würdigt in seinem Beitrag diese Schulart, deren die Zukunft auszuleuchten. Nach letzte Klassen in diesem Sommer verabschiedet wurden. einem ersten Gedankenaustausch auf unserer Jubiläumssitzung Zum anderen gehen wir der Frage nach, wie die Schulsekre- im August werden wir im Dezember unsere Klausurtagung dafür tariate zum neuen Kalenderjahr von der Verantwortlichkeit der nutzen, unser Leitbild kritisch zu hinterfragen. Die Überarbei- Bezirke in die der Schulen erfolgreich überführt werden können. tung unserer Homepage wird diesen Prozess begleiten. Zu den Voraussetzungen haben wir im Frühjahr 2013 sowohl die Vor den Sommerferien haben wir bei der Senatsschulverwal- Schulsekretärinnen und –sekretäre als auch die Schulleitungen tung die Anerkennung unserer Fortbildungen für die Schullei- befragt. terausbildung beantragt. Eine Entscheidung darüber, in welchem Umfang diese Fortbildungen anerkannt werden, steht noch aus. Einen sonnigen Herbst wünscht Ihnen Für diese Ausgabe haben wir zwei Schwerpunkte gesetzt: Zum einen blicken wir zurück auf eine Schulform, die in den Martin Wagner 1950er Jahren von mehr als der Hälfte aller Oberschüler in Berlin- Vorsitzender West besucht wurde. -

Country Profile: Germany (Rhineland-Palatinate)
Towards universal participation in post-16 mathematics: lessons from high-performing countries Country profile: Germany (Rhineland-Palatinate) Population (end of 2011): 81,800,8001 Population aged 5-19 (2010): 11,672,4752 Population of aged 15-19 (2010): 4,140,3942 Registered school students: 11,424,9483 Number of schools: Primary & 34,4864 secondary: 8,876 Secondary: The Federal System In Germany, state education is free. Full-time education is compulsory between the ages of 6 and 15 or 16 (depending on the region), and part-time education is compulsory until the age of 18 for those who do not attend a full-time school. Germany is a federal republic and the ministers and senators of the federal states (the Länder) are responsible for education, higher education and research as well as cultural affairs. School policy is in the responsibility of the federal states.5 School-systems and curricula differ between the federal states dependent in part on the political parties. Responsibility for education lies primarily with the Länder.6 A particular issue in German mathematics education is referred to as the PISA crisis. The PISA 2000 survey results led to a considerable focus both at Länder and Federal level on increasing attainment (despite differences between the PISA focus on problem solving and 1 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/01/PD12_014_12411.html 2 Calculated from: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ with support from country policy -

Education in Germany
EDUCATION IN GERMANY German public education makes it possible for qualified kids to study up to university level, regardless of their families' financial status. The German education system is different in many ways from the ones in Anglo-Saxon countries, but it produces high-performing students. Although education is a function of the federal states, and there are differences from state to state, some generalizations are possible. Children aged one to six may attend Kindergarten . After that school is compulsory for nine or ten years. From grades 1 through 4 children attend elementary school (Grundschule ), where the subjects taught are the same for all. Then, after the 4th grade, they are separated according to their academic ability and the wishes of their families, and attend one of three different kinds of schools: Hauptschule , Realschule or Gymnasium . The Hauptschule (grades 5-9 in most German states) teaches the same subjects as the Realschule and Gymnasium , but at a slower pace and with some vocational-oriented courses. It leads to part-time enrollment in a vocational school combined with apprenticeship training until the age of 18. The Realschule (grades 5-10 in most states) leads to part-time vocational schools and higher vocational schools. It is now possible for students with high academic achievement at the Realschule to switch to a Gymnasium on graduation. The Gymnasium (grades 5-13 in most states) leads to a diploma called the Abitur and prepares students for university study or for a dual academic and vocational credential. The most common education tracks offered by the standard Gymnasium are classical language, modern language, and mathematics-natural science. -

High School Exchange in Germany (Berlin)
Germany Age : 14 to 18 HIGH SCHOOL PROGRAMS High school exchange in Germany (Berlin) SCHOOL EXPERIENCE classes ranging from year 5 to year 13, the “Gymnasium” is the most advanced International students are placed in a school type in Germany; most paid host family and a public school, international students attend year 10 across Germany. Students must be or 11. Location : Baden-Wurttemberg / Bavaria / ready to live in small villages and n i Berlin / Hesse / Lower Saxony / North- the countryside and should not expect There are about 12 subjects: two or Rhine Westphalia / Saxony / Thuringia to be placed in urban areas, except if three foreign languages (one to be they opt for Berlin. The taken for 9 years, another for at least Boarding : Full board 3 years), physics, biology, chemistry carefully-chosen host family opens its Accommodation : Host family home to a student not as a guest, but and usually civics/social studies, as a new family member. This mathematics, music, art, history, Length : Term (12 weeks) / Semester (20 program allows students to German, geography, physical education weeks) / Academic Year (44 weeks) / Fall experience the everyday life of and religious education/ethics. Semester (26 weeks) / Spring Semester German families and teenagers. (20 weeks) / Academic Year (47 weeks) Classes usually begin between early August and mid September and finish Type : Public SCHOOL SYSTEM between the end of June and the end of July, depending on the region. Germany, the German language and German Secondary education in Germany Graduation is not possible. includes four types of schools: the universities have become more and more “Gymnasium” prepares students for popular among international students. -
Schule Aktuell Ausgabe Für Das Schuljahr 2021/2022
Schule aktuell Ausgabe für das Schuljahr 2021/2022 Wegweiser für den Übergang von der Grundschule in die 5. Klasse einer weiterführenden Schule in Gelsenkirchen Einleitung Liebe Eltern, bald ist es soweit, Ihr Kind wechselt zum kommenden Schuljahr von der Grundschule in die fünfte Klasse einer weiterführenden Schule. Diese Broschüre soll Ihnen schon jetzt einen Überblick über die weiter - führenden Schulen in der Stadt Gelsenkirchen geben und bei der Wahl der Schule helfen. Einige Schulen bieten zum Kennenlernen einen Tag der offenen Tür an. Bitte beachten Sie, dass Sie Infor - mationen nicht über die Grundschulen, sondern aus - schließlich über die weiterführenden Schulen selbst erhalten. Die Termine der „Kennenlern-Tage“ können Sie der Tabelle auf der letzten Seite dieser Broschüre entnehmen. Wir wünschen Ihnen, dass Sie eine gute Wahl treffen mögen und Ihr Kind mit Freude und Erfolg in der neuen Schule weiterlernt. Ihr Referat Bildung der Stadt Gelsenkirchen 2 Schule aktuell ⁄⁄ Weiterführende Schulen ⁄⁄ 2021/2022 Inhalt In Gelsenkirchen bestehen in der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) folgende weiterführende Schulformen: Hauptschule Seite 04 Realschule Seite 09 Sekundarschule Seite 15 Gesamtschule Seite 17 Gymnasium Seite 26 Schule aktuell ⁄⁄ Weiterführende Schulen ⁄⁄ 2021/2022 3 1. HAUPTSCHULE DIE HAUPTSCHULE Die Hauptschule ist eine Schule der weiterführenden Bildung und um - fasst die Klassen 5 bis 10. In der Hauptschule werden die Klassen 5 und 6 als Erprobungsstufe geführt. In der Erprobungsstufe werden die Schüle - rinnen und Schüler in Zusammenarbeit mit den Eltern gefördert und be - obachtet. Sie hat das Ziel, die Entscheidung der Schule über die Eignung der Schülerin bzw. des Schülers für die gewählte Schulform sicherer zu machen. -

EDUCATION POLICY OUTLOOK: GERMANY © OECD 2020 0 June 2020 EDUCATION POLICY OUTLOOK
EDUCATION POLICY OUTLOOK GERMANY EDUCATION POLICY OUTLOOK: GERMANY © OECD 2020 0 June 2020 EDUCATION POLICY OUTLOOK This policy profile on education in Germany is part of the Education Policy Outlook series, which presents comparative analysis of education policies and reforms across OECD countries. Building on the OECD’s substantial comparative and sectoral policy knowledge base, the series offers a comparative outlook on education policy. This country policy profile is an update of the first policy profile of Germany (2014) and provides: analysis of the educational context, strengths, challenges and policies; analysis of international trends; and insight into policies and reforms on selected topics. It is an opportunity to take stock of progress and where the education system stands today from the perspective of the OECD through synthetic, evidence-based and comparable analysis. In addition to country-specific profiles, the series also includes a recurring publication. The first volume, Education Policy Outlook 2015: Making Reforms Happen, was released in 2015. The second volume, Education Policy Outlook 2018: Putting Student Learning at the Centre was released in 2018. Its complement, Education Policy Outlook 2019: Working Together to Help Students Achieve their Potential was released in autumn 2019. Designed for policy makers, analysts and practitioners who seek information and analysis of education policy taking into account the importance of national context, the country policy profiles offer constructive analysis of education policy -

Basic Structure of the Education System in the Federal Republic of Germany Diagram
Basic Structure of the Education System in the Federal Republic of Germany Diagram kmk.org Basic Structure of the Educational System in the Federal Republic of Germany continuing education (various forms of continuing general, vocational and academic education) Doctorate (Promotion) Degree or examination after a course of study which provides qualification for a profession (Bachelor, Master, staatl./kirchl. Prüfung, Diplom16) Continuing Education Bachelor universität 13 technische universität / 15 technische hochschule pädagogische hochschule 14 kunsthochschule musikhochschule fachhochschule Qualification of vocational Allgemeine berufsakademie Tertiary Education further education Hochschulreife verwaltungsfachhochschule Fachgeb. 12 abendgymnasium / fachschule kolleg Hochschul- reife Allgemeine Hochschulreife 13 19 Berufsqualifizierender Abschluss 11 Fachhochschulreife berufs- ober- 2, 7 8 gymnasiale oberstufe 18 12 schule berufs- fach- in the different school types: berufsschule fach- ober- Gymnasium, Schularten mit 17 10 9 11 und betrieb schule schule drei Bildungsgängen, (dual System of vocational Berufliches Gymnasium 2 16 education) 10 Secondary level II 15 Mittlerer Schulabschluss (Realschule leaving certificate) after 10 years, Erster allgemeinbildender Schulabschluss (Hauptschule leaving certificate) after 9 years 6 10 10th grade 16 2 9 15 schularten 4 5 8 4 realschule mit mehreren gymnasium 14 hauptschule bildungs- 4, 5 13 7 gängen 12 6 förderschule Secondary level I 11 Orientation phase 3 5 10 2 4 9 3 8 grundschule 1 2 7 1 förderschule Primary Education 6 grade 5 kindertagesstätte/kindertagespflege 4 (optional) 3 integrativer kindergarten age Pre-school Educ. Published by: Secretariat of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany, German EURYDICE Unit of the Länder, Taubenstr.