Fair Play in Der Digitalen Welt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Table of Contents 500 GREAT PROGRAM IDEAS
Table of Contents 500 GREAT PROGRAM IDEAS Compiled by Recreation and Leisure Studies Students Gordon College Presented at Massachusetts Recreation and Park Association State Conference October 23, 2007 Workshop Presenters: Dr. Peggy Hothem Professor of Recreation and Leisure Studies Students: Christine Arruda, Christine Scanlon and Kendra Spotts Adult: Let's Talk An open forum for parents to exchange ideas, learn how to cope with ups and downs of parenthood, and acquire useful information from local guest speakers. Childcare and refreshments provided for participants. Where are Your Teenagers ----- on the Internet? Facebook, MySpace, IM, Textmessaging, and what is coming next? Learn to communicate in their language. (Best Buy and other technology retail stores can be a resource for providing an instructor – usually free of charge) Understanding Japanese Culture A course designed as an introduction to Japanese cuisine. Participants will learn Japanese cooking techniques, ingredients, quality brands, shopping tips, and how to locate Japanese grocers. Also you will prepare entrees. Fit Fitness in your Schedule Various fitness classes to choose from; Coed Body Sculpting, Exercise for the Early Bird, and Ultimate Step and Tone are only a few offered. Shorter sessions allow for greater flexibility for those with tight schedules Digital Camera Club Learn the newest techniques. Meetings consist of presentations by professional photographers, field trips, photo contests and photo demonstrations. A Mile In My Shoes A walking club offering the guidance and direction to start walking into shape! Tally sheets to keep track of walking distance, instructional handouts and fitness instructors will be provided. Each participant will record his/her mileage and receive prizes upon reaching goals. -
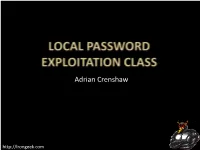
Local Password Exploitation Class
Adrian Crenshaw http://Irongeek.com I run Irongeek.com I have an interest in InfoSec education I don’t know everything - I’m just a geek with time on my hands Regular on: http://www.isd-podcast.com/ http://Irongeek.com Pulling stored passwords from web browsers/IM clients and other apps Hash cracking of Windows passwords, as well as other systems Sniffing plain text passwords off the network How passwords on one box can be used to worm though other hosts on a network Hope it get’s you thinking. Exploits are temporary, bad design decisions are forever. http://Irongeek.com There are several reasons why an attacker may want to find local passwords: To escalate privileges on the local host (install games, sniffers, key stroke catchers and other software or just to bypass restrictions). Local passwords can be used to gain access to other systems on the network. Admins may reuse the same usernames and passwords on other network hosts (more than likely if they use hard drive imaging). Similar themes are also often used for password selection. Just for the fun of doing it. http://Irongeek.com Does not organize well, but you need to have these factoids in the back of your head for later. http://Irongeek.com Imaged Systems Uses it on other systems Repeat ad nauseum Attacker grabs local password on one box Grabs passwords from other systems, and installs keyloggers/sniffers to get network credentials for http://Irongeek.com more systems Target Audience: Workstation Installers, System Admins, Security Folk and General Gear-heads. -

The Application Usage and Risk Report an Analysis of End User Application Trends in the Enterprise
The Application Usage and Risk Report An Analysis of End User Application Trends in the Enterprise April 5, 2008 Palo Alto Networks 2130 Gold Street, Suite 200 Alviso, CA 95002-2130 Main 408.786.0001 Fax 408.786.0006 Sales 866.207.0077 www.paloaltonetworks.com Table of Contents Executive Summary............................................................................................................................. 3 Introduction.......................................................................................................................................... 4 Palo Alto Networks Application Visibility and Risk Report............................................................... 5 Findings ............................................................................................................................................... 5 Major Trends.................................................................................................................................... 5 Consumerization of Enterprise Networks and Applications............................................................. 6 Instant messaging: evasive features bring business and security risks. ..................................... 6 Web mail: rampant use brings delicate balancing act of personal email on company time. ....... 7 Peer-to-peer applications: prevalent on enterprise networks, despite control efforts.................. 8 Web-based file transfer and storage: harmless utility or data sinkhole? ..................................... 8 Media applications: -

TSU Journal of Communication and Media Studies, Vol. 3, No. 1, March 2020
TSU Journal of Communication and Media Studies, Vol. 3, No. 1, March 2020 Impact of Social Media on the Socio-Economic Development of Nigeria 1Bolu John Folayan & 2Maria Kisugu Obun-Andy Abstract Advancements in technology and the internet have greatly influenced the way things are done virtually in all fields of human endeavor. These advancements, no doubt, have influenced the socio-economic developments of nations including Nigeria. The impact of social media on human capacity development has gone beyond the exchange of information; the social media have become powerful communicative forces in the economic, political, religious and educational realms of the society. This study examines the role of social media in the socio- economic development of Nigeria. It explores the potentials of the various social media platforms to the socioeconomic development of Nigeria. Scholarly perspectives and positions in the literature are explored to demonstrate the relevance of social media and their applications in the course of making life better for the masses, particularly the indigent and information have-nots. The study spotlights key areas where successful application of social media can engender the much needed sustainable development of society, using the Nigerian situation as a point of reference. The study further identifies social media platforms that can facilitate this much desired socio-economic development, emphasizing that the goal of developing human and technological potentialities of Nigeria cannot be achieved effectively unless the society adopts IT-driven developmental strategies, especially in an information era like ours. Social media presents viable IT avenues that could be harnessed to spearhead this course. Key words: Social media, Socio-Economic Development, Information Technology and Nigeria. -

Hosting Online Open Houses & Online/Virtual Office Hours
Hosting online open houses & online/virtual office hours A virtual open house can be an information session, webinar, or other interactive program that provides prospective students with the opportunity to ask questions either via video, chat, or audio while a staff member responds to questions and provides program information in real time. These should be planned on adult student- friendly schedules with a variety of available dates and times. The event could be offered on a Tuesday evening, Thursday at noon, and/or a Saturday morning, giving prospective students the ability to “attend” the event either after regular office hours, during a lunch break, or on a weekend from their office, home, or a local library. An online open house event should provide: general information about the program; program requirements; the portfolio process; and financial aid. By making information available to the students on their schedule from a space they consider safe and non- threatening, they will be more open to participation. Prospective students can access the event from anywhere with a computer and an internet connection. Adult learners often juggle many responsibilities between work, home, and their community. Here are some helpful resources to help you reach prospective adult students without breaking the bank or overextending your staff. The services listed below will enable you to host events or hold office hours outside of the traditional work schedule and from anywhere with an internet connection. You aren’t required to use these specific services; these are merely suggestions to assist you in providing online support to your students as a part of the RBA Today program commitment requirements. -
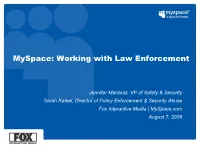
Myspace FY07 Ad Strategy
MySpace: Working with Law Enforcement Jennifer Mardosz, VP of Safety & Security Sarah Kaleel, Director of Policy Enforcement & Security Abuse Fox Interactive Media | MySpace.com August 7, 2008 The Fox Interactive Media Family Social Networking and MySpace What Are Social Networking Sites? • Social networking sites have one stop shopping for online content, activities and features. • Some of the larger social networking sites on the internet, aside from MySpace.com, are Xanga.com, Facebook.com and Friendster.com. Bebo.co.uk and Piczo.com are popular in the U.K. The MySpace Generation • 1 in 4 Americans are on MySpace • 85% of members are 18+ • 110 million monthly users in US • 300,000 new registrants daily* • 15 million total images uploaded daily • 70,000+ videos uploaded daily • 50 million messages sent a day • Localized versions in 30 regions across 15 languages Source: comScore Media Metrix August 2007 * MySpace internal data, August 2007 A Strong Foundation for Online Safety Technology Education NGOs Law Enforcement Public Policy Industry Relations International Contact, Content and Collaboration Contact Content Collaboration Keep predators off of Keep inappropriate Information that MySpace content off of empowers parents MySpace Block teen access Prevent unwanted from age - Education contact for all users inappropriate content Work with Law Enforcement Contact What We’re Doing: Contact . Email verification of new members . Users under 18 are automatically assigned a Private Profile . Adults can never add under 16’s as a friend unless they know the under 16’s last name or email address (adult must know the user in the physical world) • Keep predators off . -

Download (907Kb)
www.ojcis.net Vol. 3 No. 1. February, 2020 The Place of Social Media and its Impact in Nigeria Maria Kisugu Obun-Andy M.Sc., B.Sc. CMIMIM Department of Mass Communication The Federal Polytechnic, Ilaro Tel. 08177663219 Email: [email protected] Abstract The study investigates the place of social media and its impact in Nigeria. The major objective of this study is to determine how the use of social media impact on Nigeria with specific emphasis on the strength, weakness, threat and opportunities. The study used survey research design with one hundred and eighty six respondents randomly selected from the community area where the research was carried out. The paper adopted purposive random sampling techniques and selected (200) respondents. The respondents were given questionnaire to fill in order to determine their perceptions. The findings of this study seem to confirm the assumption that social media impact on Nigerians in more positive ways though, has some negative effect. The study therefore recommends that Nigeria should focus on the opportunities available in social media and do away with the negative aspects. Concerned global regulatory bodies should do more at ensuring that social media content is being censored. Parents should engage their children in discussions that disabuse their mindset from thought of engaging in wrong activities on social media. Key words: Social media, Networking sites, Global Village, SWOT Analysis Introduction Human communication has evolved over time. During the oral traditional stage, human developed his ability to speak and communicate face to face with one another. This was followed by the stage of images during which period they communicated through signs and symbols. -

The Application Usage and Risk Report an Analysis of End User Application Trends in the Enterprise
The Application Usage and Risk Report An Analysis of End User Application Trends in the Enterprise Fall Edition 2009 Palo Alto Networks 232 East Java Dr. Sunnyvale, CA 94089 Sales: 866.207.0077 www.paloaltonetworks.com Table of Contents Executive Summary................................................................................................................. 3 Introduction............................................................................................................................. 4 Enterprise 2.0 Application Usage ............................................................................................ 5 SharePoint Usage Continues Its Rapid Growth........................................................................................ 6 Watch Out Microsoft, Here Comes Google ............................................................................................... 6 WebEx Competitors Show Increased Usage............................................................................................. 6 Twitter Rises From Nowhere.................................................................................................................... 6 Facebook Expands Its Dominance............................................................................................................ 7 Employees Are Active Contributors.......................................................................................................... 8 Enterprise 2.0 Benefits Are No Longer Elusive...................................................................... -

Safezone Browser Download Cent Safezone Browser Download Cent
safezone browser download cent Safezone browser download cent. NOT REGISTERED YET? RETRIEVE YOUR PERNUM FOR BETA TESTERS--> PLEASE ENTER YOUR REGISTERED EMAIL. Your PERNUM will be sent to your registered email account. REQUEST PASSWORD FOR BETA TESTERS--> PLEASE ENTER YOUR PERNUM. Your temporary password will be sent to your registered email account. RESET YOUR MASTER PIN FOR BETA TESTERS--> PLEASE ENTER YOUR REGISTERED EMAIL AND SAFEZONE PASSWORD. RESET YOUR MASTER PIN FOR BETA TESTERS--> YOUR REQUEST HAS BEEN RECEIVED. An email has been sent to our Support Team and they will contact you at your registered email for assistance. Please allow up to 48 hours for a response, emails are processed in the order they are received. SET UP YOUR MASTER PIN FOR BETA TESTERS--> PLEASE ENTER YOUR REGISTERED EMAIL AND SAFEZONE PASSWORD. SET UP YOUR MASTER PIN FOR BETA TESTERS--> Your SafeZone Pass is protected by two-step authentication. For every login process, or if you need to change your profile data, you need a one- time pin which has been randomly generated from your 6-digit Master Pin. SET UP YOUR MASTER PIN FOR BETA TESTERS--> Oops! There is already a Master PIN set up for this account. Please either login using your existing Master PIN or you may reset your Master PIN. SET UP YOUR MASTER PIN FOR BETA TESTERS--> Your Master Pin has been set up successfully! Let us test your first One-Time Pin, which is randomly generated from your Master Pin. Please enter the matching digits of your Master Pin: SafeZone APK. SafeZone app is only available at organizations using the SafeZone solution . -

Launch! Advertising and Promotion in Real Time
Launch! Advertising and Promotion in Real Time Saylor.org This text was adapted by The Saylor Foundation under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share-Alike 3.0 License without attribution as requested by the work’s original creator or licensee. Saylor URL: http://www.saylor.org/books Saylor.org 1 Chapter 1 Meet SS+K: A Real Agency Pitches a Real Client Figure 1.1 Fourteen Months to Launch! Saylor URL: http://www.saylor.org/books Saylor.org 2 1.1 Why Launch!? LEARNING OBJECTIVE After studying this section, students should be able to do the following: 1. Recognize the bold new approach for delivering information to today’s college students (aka digital natives). Knowledge Is a Flat World The textbook publishing industry is undergoing staggering change as many traditional business models and practices quickly lose relevance. Peer-to-peer textbook trading networks, online used-book sellers, and a gray market that allows low-priced international editions to displace expensive U.S. texts push publishers to reconsider outmoded ways of delivering content. Likewise, the digital natives who make up our university student bodies (that’s you!) inspire educators to think about the transfer of knowledge in exciting new ways. How do we best communicate the most current thinking in our disciplines to students who expect up-to- the-minute information at a keystroke and who view educational materials as community—indeed, world—resources that can and should be freely shared and interactively constructed? We’ve created a new kind of text—one premised on the idea that college course material can wield wider influence and be of greatest public benefit as it becomes easily and inexpensively available to anyone with a desire to learn. -

Belkasoft Forensic IM Analyzer New Release Belkasoft Announces 4 New Editions of Its Flagship Tool
Belkasoft Forensics made easier For immediate release June 28, 2010 Contact: Yuri Gubanov Company: Belkasoft Title: Owner and CEO E-mail: [email protected] Belkasoft Forensic IM Analyzer new release Belkasoft announces 4 new editions of its flagship tool Belkasoft, computer forensics software vendor, announces today the release of 4 new editions of its flagship tool called Belkasoft Forensic IM Analyzer. The tool is aimed to help forensic investigators with instant messengers history extraction and supports more than 20 various messenger histories including ICQ (all versions starting 97a to ICQ 7), Skype, Live Messenger/MSN, Yahoo! Messenger, Miranda, Trillian, MySpace IM etc. While before today it existed in two editions (Personal and Corporate), now there are four: Home, Standard, Professional and Ultimate. Home edition is targeted for individuals, the rest three will be used by organizational users. Comparing to Standard, Professional edition adds up an ability to mount drive images in popular formats such as Encase or DD. It also support QQ 2009/2010 and Skype chatsync extraction. Ultimate version provides for deleted information retrieval (so-called carving). The information can be found on FAT and NTFS drives, drive images and Live RAM images made with the help of win32dd/win64dd or FTK Imager tools. "Our goal was to ease complicated work of those who need to conduct a deep investigation of messenger histories, including deleted history and live RAM analysis," says Yuri Gubanov, owner and CEO at Belkasoft. "Now it is possible to get the single tool providing for that instead of purchasing a set of tools. Others may not overspend the money on functionality they do not need by choosing minor edition of the tool." New editions of Belkasoft Forensic IM Analyzer product are available on Belkasoft site at http://belkasoft.com . -
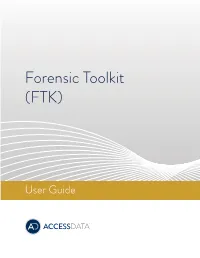
Forensic Toolkit (FTK)
Forensic Toolkit (FTK) User Guide | 1 AccessData Legal and Contact Information Document date: November 2, 2017 Legal Information ©2017 AccessData Group, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of the publisher. AccessData Group, Inc. makes no representations or warranties with respect to the contents or use of this documentation, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, AccessData Group, Inc. reserves the right to revise this publication and to make changes to its content, at any time, without obligation to notify any person or entity of such revisions or changes. Further, AccessData Group, Inc. makes no representations or warranties with respect to any software, and specifically disclaims any express or implied warranties of merchantability or fitness for any particular purpose. Further, AccessData Group, Inc. reserves the right to make changes to any and all parts of AccessData software, at any time, without any obligation to notify any person or entity of such changes. You may not export or re-export this product in violation of any applicable laws or regulations including, without limitation, U.S. export regulations or the laws of the country in which you reside. AccessData Group, Inc. 588 West 400 South Suite 350 Lindon, UT 84042 USA AccessData Trademarks and Copyright Information The following are either registered trademarks or trademarks of AccessData Group, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. AccessData® DNA® PRTK® AccessData Certified Examiner® (ACE®) Forensic Toolkit® (FTK®) Registry Viewer® AD Summation® Mobile Phone Examiner Plus® Summation® Discovery Cracker® MPE+ Velocitor™ SilentRunner® Distributed Network Attack® Password Recovery Toolkit® AccessData Legal and Contact Information | 2 A trademark symbol (®, ™, etc.) denotes an AccessData Group, Inc.