Die Einführung Der Sechsstufigen Realschule
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
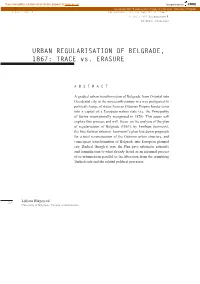
Urban Regularisation of Belgrade, 1867: Trace Vs. ERASURE
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by RAF - Repository of the Faculty of Architecture - University of Belgrade S A J _ 2009 _ 1 _ UDK BROJEVI: 711.432.168(497.11)”1867”; 71.071.1:929 Ј о с и м о в и ч Е. ID BROJ: 172311820 URBAN REGULARISATION OF BELGRADE, 1867: TRACE vs. ERASURE A B S T R A C T A gradual urban transformation of Belgrade from Oriental into Occidental city in the nineteenth century in a way prefigured its political change of status from an Ottoman Empire border town into a capital of a European nation state (i.e. the Principality of Serbia internationally recognised in 1878). This paper will explore this process, and will focus on the analysis of the plan of regularisation of Belgrade (1867), by Emilijan Josimović, the first Serbian urbanist. Josimović’s plan laid down proposals for a total reconstruction of the Ottoman urban structure, and consequent transformation of Belgrade into European planned city. Radical though it was, the Plan gave urbanistic rationale and formalisation to what already lasted as an informal process of re-urbanisation parallel to the liberation from the crumbling Turkish rule and the related political processes. Ljiljana Blagojević 27 University of Belgrade - Faculty of Architecture S A J _ 2009 _ 1 _ Belgrade’s position at the confluence of the river Sava into the Danube, is marked historically by the condition of constantly shifting borders of divided and conflicting empires. The river Sava marked a geographical and political borderline from the fourth century division of the Roman Empire into the Eastern and Western Empires, until the mid-twentieth century Third Reich’s remapping of Europe. -

Standing up for Equality in Germany’S Schools Standing up for Equality in Germany’S Schools 1
STANDING UP FOR EQUALITY IN GERMANy’S SCHOOLS STANDING UP FOR EQUALITY IN GERMANy’S SCHOOLS 1 INTRODUCTION No country wants to believe that it is It is clear that children from a “migration failing its children in any way. It is difficult background”1 perform significantly to imagine a government that would not worse at school than their native German support the idea of equal education for counterparts. The term “migration back- all. Germany is no exception. And yet, ground” covers children from families in Germany, children of varied ethnic who are still perceived as “foreigners” and racial backgrounds have vastly because of their racial or ethnic identity, different educational opportunities and even though their families may have experiences. arrived in Germany years ago. This should no longer be a surprise. In 2001, an influential European study shocked Germans with the news that their country, which long had prided itself on its excellent educational system, was at the low end of the compara- tive spectrum. The study, undertaken in 2000 by the Program for International Student Assessment (PISA) (an arm of the Organization for Economic Development and Cooperation (OECD)), showed that German children did poorly in reading, math, and science, in comparison to students from 56 other countries. The PISA study described the deep flaws in the German education system. In particular, it explained that at-risk students—including those of migration, or migrant, backgrounds—performed among the worst in the world. They were more often tracked into the lowest level Hauptschule; they were excluded from the best classrooms; and they had far fewer opportunities to attend Gymnasium, which meant they were not permitted to take the state Abitur examination and attend university. -

Germany's New Security Demographics Military Recruitment in the Era of Population Aging
Demographic Research Monographs Wenke Apt Germany's New Security Demographics Military Recruitment in the Era of Population Aging 123 Demographic Research Monographs A Series of the Max Planck Institute for Demographic Research Editor-in-chief James W. Vaupel Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany For further volumes: http://www.springer.com/series/5521 Wenke Apt Germany’s New Security Demographics Military Recruitment in the Era of Population Aging Wenke Apt ISSN 1613-5520 ISBN 978-94-007-6963-2 ISBN 978-94-007-6964-9 (eBook) DOI 10.1007/978-94-007-6964-9 Springer Dordrecht Heidelberg New York London Library of Congress Control Number: 2013952746 © Springer Science+Business Media Dordrecht 2014 This work is subject to copyright. All rights are reserved by the Publisher, whether the whole or part of the material is concerned, specifi cally the rights of translation, reprinting, reuse of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfi lms or in any other physical way, and transmission or information storage and retrieval, electronic adaptation, computer software, or by similar or dissimilar methodology now known or hereafter developed. Exempted from this legal reservation are brief excerpts in connection with reviews or scholarly analysis or material supplied specifi cally for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use by the purchaser of the work. Duplication of this publication or parts thereof is permitted only under the provisions of the Copyright Law of the Publisher’s location, in its current version, and permission for use must always be obtained from Springer. Permissions for use may be obtained through RightsLink at the Copyright Clearance Center. -

NAFSA08-Germany
GERMANY ELEMENTARY AND SECONDARY EDUCATION GENERAL INFORMATION: Location: Germany is located in Central Western Europe. It is surrounded by the Netherlands, Belgium, France, Switzerland, Austria, Czech Republic, and Poland. In the North, Germany borders with the North Sea, Denmark, and Baltic Sea. Language(s) of Instruction: German Grading Scales: Generally, the conventional six-mark scale is used in individual student assessment in schools. The 15-point scale is used on the Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife (Certificate of General University Maturity) awarded upon successful completion of a pre-university upper secondary school (Gymnasium) program. Conventional Gymnasiale Oberstufe (Higher Description six-mark scale Gymnasium Level) point system sehr gut (very good) well above required 1 13 – 15 standard 2 10 – 12 gut (good) fully meets required standard befriedigend (satisfactory) generally 3 7 – 9 meets the required standard ausreichend (adequate) generally meets 4 4 – 6 required standard, but with some deficiencies mangelhaft (poor) does not meet the required standard, but the basic 5 1-3 knowledge is there and deficiencies may be made up with time ungenügend (insufficient) deficiencies 6 0 too incomplete to make them up in a reasonable period of time Principal educational authority: The responsibilities of the Federal Government in education are defined in theGrundgesetz (Basic Law). Based on the Basic Law, education in each Land (state) is regulated by the appropriate administrative and legislative state authorities. Each state has its own Ministry of Education, regional, and local educational authorities. Educational reforms are implemented at the state level but discussed at the federal level through the Kultusministerkonferenz (Conference of Ministers for Education and Cultural Affairs)ю Academic Calendar: School year lasts 188 – 208 days (five-six day weeks) from August to July. -

Classifying Educational Programmes
Classifying Educational Programmes Manual for ISCED-97 Implementation in OECD Countries 1999 Edition ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Foreword As the structure of educational systems varies widely between countries, a framework to collect and report data on educational programmes with a similar level of educational content is a clear prerequisite for the production of internationally comparable education statistics and indicators. In 1997, a revised International Standard Classification of Education (ISCED-97) was adopted by the UNESCO General Conference. This multi-dimensional framework has the potential to greatly improve the comparability of education statistics – as data collected under this framework will allow for the comparison of educational programmes with similar levels of educational content – and to better reflect complex educational pathways in the OECD indicators. The purpose of Classifying Educational Programmes: Manual for ISCED-97 Implementation in OECD Countries is to give clear guidance to OECD countries on how to implement the ISCED-97 framework in international data collections. First, this manual summarises the rationale for the revised ISCED framework, as well as the defining characteristics of the ISCED-97 levels and cross-classification categories for OECD countries, emphasising the criteria that define the boundaries between educational levels. The methodology for applying ISCED-97 in the national context that is described in this manual has been developed and agreed upon by the OECD/INES Technical Group, a working group on education statistics and indicators representing 29 OECD countries. The OECD Secretariat has also worked closely with both EUROSTAT and UNESCO to ensure that ISCED-97 will be implemented in a uniform manner across all countries. -

Bioindication of Air Pollution by Epiphytic Lichens in Forest Decline Studies in Slovenia
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Phyton, Annales Rei Botanicae, Horn Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 36_3 Autor(en)/Author(s): Batic Franc, Mayrhofer Helmut Artikel/Article: Bioindication of Air Pollution by Epiphytic Lichens in Forest Decline Studies in Slovenia. 85-90 ©Verlag Ferdinand Berger & Söhne Ges.m.b.H., Horn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Phyton (Horn, Austria) Special issue: Vol. 36 Fasc. 3 (85)-(90) 15.09.96 "Bioindication ..." Bioindication of Air Pollution by Epiphytic Lichens in Forest Decline Studies in Slovenia By FRANC BATIC1-1 & HELMUT MAYRHOFER2) Key words: Bioindication, air pollution, epiphytic lichens, forest decline, Slovenia. Summary BATIC F. & MAYRHOFER H. 1996. Bioindication of air pollution by epiphytic lichens in forest decline studies in Slovenia. - Phyton (Horn, Austria) 36 (3): (85) - (90). Initial studies were based on mapping of cover and frequency of crustose, foliose and fructicose epiphytic lichens on trees and these were also assessed for decline symptoms. Since 1985 the epiphytic lichen vegetation has been assessed by such methods and the results, expressed as a lichen map of Slovenia were used as an air quality indicator for plots of forest die-back inventory. In collaboration with lichenologists from Graz University, Austria, all epiphytic lichen species were mapped in order to obtain better measures of air quality in the area studied. Very polluted and clean, well preserved forest were investigated. From the material collected and determined, a lichen herbarium has been established in the Slovenian Forestry Institute. Possibilities for further research and the use of epiphytic lichens as air quality indicators are discussed. -

Educational Mobility in 20Th Century-Denmark
THE MAKING AND UNMAKING OF OPPORTUNITY: EDUCATIONAL MOBILITY IN 20TH CENTURY-DENMARK KRISTIAN B. KARLSON RASMUS LANDERSØ STUDY PAPER 158 FEBRUARY 2021 The Making and Unmaking of Opportunity: Educational Mobility in 20th Century-Denmark Study Paper No. 158 Published by: © The ROCKWOOL Foundation Research Unit Address: The ROCKWOOL Foundation Research Unit Ny Kongensgade 6 1472 Copenhagen, Denmark Telephone +45 33 34 48 00 E-mail: [email protected] https://www.rockwoolfonden.dk/en February 2021 The Making and Unmaking of Opportunity: Educational Mobility in 20th Century-Denmark Kristian B. Karlson+ Rasmus Landersø† February 17, 2021 Abstract We study intergenerational educational mobility in Denmark over the 20th century during which the comprehensive Danish welfare state was rolled out. While mobility initially was low, schooling reforms benefiting children from disadvantaged backgrounds led to dramatic increases in mobility for cohorts born between 1940 and 1960. However, the college expansion affecting cohorts born from 1970 onward has mainly benefited children from affluent back- grounds, resulting in rapidly declining mobility. Comparisons to educational mobility trends in the U.S. reveal that the two countries converge in mobility levels for the most recent cohorts despite the dramatically different welfare policies in place. JEL: H0, I0, J0 Keywords: educational mobility, inequality, schooling reforms, skills ∗ We are indebted to generous feedback from many, especially Jesper Birkelund, Richard Breen, Steven Durlauf, Gøsta Esping-Andersen, James J. Heckman, Anders Hjorth-Trolle, Erik Lykke Mortensen, Helena Skyt Nielsen, Hans Henrik Sievertsen, and seminar participants at the ASA conference 2020, the Copenhagen Education Network, the Life-cycle working group at the University of Chicago, the University of Copenhagen, and the 5th IZA Workshop: The Economics of Education. -

The Schools of Austriain Their Preient Condition of Change, It Is, of Course,.Diappointing.To Be Unable
4' DEPARTMENT OFTHE INTERIOR BUREAU OF-EDUCATION BULLETIN,1919, No. 54 THESCHOOLSOF AUSTRIA-HUNGARY By PETER H. PEARSON DIVSDN OF FOREIGNEDUCATIONAL SYSTEMS BUREAU OF EDUCATION p. [Advance Sheets from theBiennial Survey of Education,,1916-1918] WASHINGTON.: GOVERNMENTPRINTING OFFICE 1919 a Apprriox AL COPI Or TRIS MOBLICATION IRV/ NZ TITS NUTICIENTENDF;112 Or 1 OCV INTS GOVERNMENT PRINTING()rims WASIIINGTON, D. C. AT 10 CENTS PER COPY yiEHE SCHOOLS OF ATTSTRIA-HUNGARY. C 5 lly Prrkla U. PEAltsoN. Division of foreign Educ,ttionoi .,yxteoox, Itureau ofEducation. CONTENTICConditions prior to the war- State or localcontrol The prothem of the EinheitsacauicProblems of higher tNiocatiouThe teacher, thepupils. a:: .l the war The responsibility mud the eervIce of the schools--Consolidationsof teachers' unions The new orderPolitical reorganization In its effect on theschools. CONDITIONS PRIOR TO THE WAR. The political now taking place inAustria-Hungary will be followed undoubtedly by far-reachingalterations in the school system, whereby old modes will be swept awayand new ones in- augurated.In the present sketch the attempt is made totreat only such 'problems and movements as are likely tocontinue in some form and thettby maintain a living interest, evenunder a new political administration.Whatever the new political units may be,school men will continue to giveattention to centralized control of schools as against local control,which is the substance of the Statepublic school problem that has long occupied theattention of teachers in Austria.In regard to school organization, the"Einheitsscliule," in which are involved the opportunities ofthe great mass of pupils, is likely to receive further attention, even under analtered administra- tion.In. -

Country Profile: Germany (Rhineland-Palatinate)
Towards universal participation in post-16 mathematics: lessons from high-performing countries Country profile: Germany (Rhineland-Palatinate) Population (end of 2011): 81,800,8001 Population aged 5-19 (2010): 11,672,4752 Population of aged 15-19 (2010): 4,140,3942 Registered school students: 11,424,9483 Number of schools: Primary & 34,4864 secondary: 8,876 Secondary: The Federal System In Germany, state education is free. Full-time education is compulsory between the ages of 6 and 15 or 16 (depending on the region), and part-time education is compulsory until the age of 18 for those who do not attend a full-time school. Germany is a federal republic and the ministers and senators of the federal states (the Länder) are responsible for education, higher education and research as well as cultural affairs. School policy is in the responsibility of the federal states.5 School-systems and curricula differ between the federal states dependent in part on the political parties. Responsibility for education lies primarily with the Länder.6 A particular issue in German mathematics education is referred to as the PISA crisis. The PISA 2000 survey results led to a considerable focus both at Länder and Federal level on increasing attainment (despite differences between the PISA focus on problem solving and 1 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2012/01/PD12_014_12411.html 2 Calculated from: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/ with support from country policy -

The Politics of Access to Advanced Education in Late Imperial Austria
The Politics of Access to Advanced Education In Late Imperial Austria Professor Gary B. Cohen Univeristy of Oklahoma September 1993; Working Paper 93-6 © 2002 by the Center for Austrian Studies. Permission to reproduce must generally be obtained from the Center for Austrian Studies. Copying is permitted in accordance with the fair use guidelines of the US Copyright Act of 1976. The the Center for Austrian Studies permits the following additional educational uses without permission or payment of fees: academic libraries may place copies of the Center's Working Papers on reserve (in multiple photocopied or electronically retrievable form) for students enrolled in specific courses: teachers may reproduce or have reproduced multiple copies (in photocopied or electronic form) for students in their courses. Those wishing to reproduce Center for Austrian Studies Working Papers for any other purpose (general distribution, advertising or promotion, creating new collective works, resale, etc.) must obtain permission from the Center. For Austria's peoples and the government, the development of advanced education during the late nineteenth century offered challenges as well as opportunities. Popular aspirations for secondary and higher education grew as modern class structures and an industrial market economy replaced the old corporate society. Study in Gymnasien, Realschulen, universities, and technical colleges opened the doors for entry into the growing sectors of white-collar and technical employment, the learnedprofessions, and government service. For the hitherto dominant German-speaking elements in the Alpine and Bohemian lands and for the Poles in Galicia, assuring their continued leadership in achanging social structure required maintaining privileges in secondary and higher education. -

Education in Germany
EDUCATION IN GERMANY German public education makes it possible for qualified kids to study up to university level, regardless of their families' financial status. The German education system is different in many ways from the ones in Anglo-Saxon countries, but it produces high-performing students. Although education is a function of the federal states, and there are differences from state to state, some generalizations are possible. Children aged one to six may attend Kindergarten . After that school is compulsory for nine or ten years. From grades 1 through 4 children attend elementary school (Grundschule ), where the subjects taught are the same for all. Then, after the 4th grade, they are separated according to their academic ability and the wishes of their families, and attend one of three different kinds of schools: Hauptschule , Realschule or Gymnasium . The Hauptschule (grades 5-9 in most German states) teaches the same subjects as the Realschule and Gymnasium , but at a slower pace and with some vocational-oriented courses. It leads to part-time enrollment in a vocational school combined with apprenticeship training until the age of 18. The Realschule (grades 5-10 in most states) leads to part-time vocational schools and higher vocational schools. It is now possible for students with high academic achievement at the Realschule to switch to a Gymnasium on graduation. The Gymnasium (grades 5-13 in most states) leads to a diploma called the Abitur and prepares students for university study or for a dual academic and vocational credential. The most common education tracks offered by the standard Gymnasium are classical language, modern language, and mathematics-natural science. -

Educational Pathways in Baden-Württemberg Qualifications and Connections 2 Contents
INFORMATION FOR PARENTS Educational pathways in Baden-Württemberg Qualifications and Connections 2 Contents Contents Educational pathways in Baden-Württemberg 3 General secondary school / Intermediate secondary school with focus on vocational orientation (Hauptschule / Werkrealschule) 6 Intermediate secondary school (Realschule) 9 Higher academic secondary school (allgemein bildendes Gymnasium) 12 Joint secondary school (Gemeinschaftsschule) 15 Special needs education and advisory centre (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum – SBBZ) 18 Vocational schools (Berufliche Schulen) 21 Inclusion 25 General information 26 Admission procedure 27 Addresses 29 Publishing information 31 Educational pathways in Baden-Württemberg 3 Educational pathways in Baden-Württemberg (see page 4-5) All paths are open. focus on vocational orientation (Werkreal- academic secondary school (allgemein Our chart (see page 4-5) illustrates the schule), or an intermediate secondary bildendes Gymnasium). numerous educational pathways. The most school (Realschule) or at a higher academic • When a student completes year 10 at a joint important fact is that each qualification offers secondary school (Gymnasium) by success- secondary school (Gemeinschaftsschule) the possibility of a further connection. Apart fully completing year 9 and thus attaining or higher vocational secondary school from the general, intermediate, higher acade- access to year 10. (berufliches Gymnasium) and has gained mic and joint secondary schools (Hauptschule, • at a joint secondary school (Gemeinschafts- access to the higher secondary level (Ober- Realschule, Gymnasium, Gemeinschafts- schule), providing that at the end of year stufe) of a higher academic secondary schule), the vocational schools, which offer 9 the level M or E has been attained and the school (Gymnasium), higher vocational a wide selection of courses, represent an student would have been given access to secondary school (berufliches Gymnasium), important stepping-stone on the route to year 10.