Barberfallenfänge in Der Marktgemeinde Arnoldstein
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Trofička Niša Mirmekofagnog Predatora Tijekom Ontogenetičkog Razvoja
Trofička niša mirmekofagnog predatora tijekom ontogenetičkog razvoja Gajski, Domagoj Master's thesis / Diplomski rad 2019 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Science / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:217:211948 Rights / Prava: In copyright Download date / Datum preuzimanja: 2021-09-26 Repository / Repozitorij: Repository of Faculty of Science - University of Zagreb University of Zagreb Faculty of Science Department of Biology Domagoj Gajski Trophic niche of an ant-eating predator during its ontogenetic development Graduation Thesis Zagreb, 2019. This thesis was made during an internship at the Masaryk University (Brno, Czech Republic) under the supervision of Prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. and Assoc. Prof. Dr. sc. Damjan Franjević from University of Zagreb, and submitted for evaluation to the Department of Biology, Faculty of Science, University of Zagreb in order to acquire the title Master of molecular biology. I would first like to thank my thesis advisors Prof. dr. mgr. Stanislav Pekar and dr. mgr. Lenka Petrakova of the arachnological lab at the Masaryk University. The door to their offices was always open whenever I ran into questions about my research or writing. They consistently allowed this paper to be my own work but steered me in the right direction whenever they thought I needed it. I would like to thank all the co-workers at the arachnological lab, that made each day of work more interesting by losing their spiders in the lab. They somehow always landed on my work desk. -

Ants Inhabiting Oak Cynipid Galls in Hungary
North-Western Journal of Zoology 2020, vol.16 (1) - Correspondence: Notes 95 Ants inhabiting oak Cynipid galls in Hungary Oaks are known to harbour extremely rich insect communi- ties, among them more than 100 species of gall wasps (Hy- menoptera: Cynipidae) in Europe (Csóka et al. 2005, Melika 2006). Some gall wasp species are able to induce large and structurally complex galls that can sometimes be abundant on oaks, providing attractive shelters for several arthropod taxa including ant species. Ants are among the most important players in many ecosystems and they are also considered to act as ecosystem engineers (Folgarait, 1998). They are also famous for having ecological or physical interactions with a great variety of other organisms, such as gall wasps. Ants are known to tend Figure 1. Inner structure of the asexual Andricus quercustozae gall in- aphid colonies on the developing galls and, as general pred- habited by ants. ators, they prey on arthropods approaching the protected aphid colonies. Some oak cynipid galls secrete honeydew on their surface. This sweet substrate attracts ants and, in re- turn, the ants protect the galls from predators and parasi- toids (Abe, 1988, 1992; Inouye & Agrawal 2004; Nicholls, 2017). Beyond this obvious ecological interaction between gall wasps and ants, this association continues after the gall wasp’s life cycle has ceased. Certain galls are known to serve as either temporary or permanent shelter for many ant species. Some galls (e.g. An- dricus hungaricus (Hartig), Andricus quercustozae (Bosc), Aphelonyx cerricola (Giraud)) are large enough even for re- productive ant colonies. The advantages of galls as nesting logs are multifaceted. -

Landscape-Scale Connections Between the Land Use, Habitat Quality and Ecosystem Goods and Services in the Mureş/Maros Valley
TISCIA monograph series Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mureş/Maros valley Edited by László Körmöczi Szeged-Arad 2012 Two countries, one goal, joint success! Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mureş/Maros valley TISCIA monograph series 1. J. Hamar and A. Sárkány-Kiss (eds.): The Maros/Mureş River Valley. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River and its Environment, 1995. 2. A. Sárkány-Kiss and J. Hamar (eds.): The Criş/Körös Rivers’ Valleys. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River and its Environment, 1997. 3. A. Sárkány-Kiss and J. Hamar (eds.): The Someş/Szamos River Valleys. A Study of the Geography, Hydrobiology and Ecology of the River and its Environment, 1999. 4. J. Hamar and A. Sárkány-Kiss (eds.): The Upper Tisa Valley. Preparatory Proposal for Ramsar Site Designation and an Ecological Background, 1999. 5. L. Gallé and L. Körmöczi (eds.): Ecology of River Valleys, 2000. 6. Sárkány-Kiss and J. Hamar (eds.): Ecological Aspects of the Tisa River Basin, 2002. 7. L. Gallé (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin, I. 2005. 8. L. Gallé (ed.): Vegetation and Fauna of Tisza River Basin, II. 2008. 9. L. Körmöczi (ed.): Ecological and socio-economic relations in the valleys of river Körös/Criş and river Maros/Mureş, 2011. 10. L. Körmöczi (ed.): Landscape-scale connections between the land use, habitat quality and ecosystem goods and services in the Mureş/Maros valley, 2012. -

Bee Viruses: Routes of Infection in Hymenoptera
fmicb-11-00943 May 27, 2020 Time: 14:39 # 1 REVIEW published: 28 May 2020 doi: 10.3389/fmicb.2020.00943 Bee Viruses: Routes of Infection in Hymenoptera Orlando Yañez1,2*, Niels Piot3, Anne Dalmon4, Joachim R. de Miranda5, Panuwan Chantawannakul6,7, Delphine Panziera8,9, Esmaeil Amiri10,11, Guy Smagghe3, Declan Schroeder12,13 and Nor Chejanovsky14* 1 Institute of Bee Health, Vetsuisse Faculty, University of Bern, Bern, Switzerland, 2 Agroscope, Swiss Bee Research Centre, Bern, Switzerland, 3 Laboratory of Agrozoology, Department of Plants and Crops, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium, 4 INRAE, Unité de Recherche Abeilles et Environnement, Avignon, France, 5 Department of Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 6 Environmental Science Research Center, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 7 Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 8 General Zoology, Institute for Biology, Martin-Luther-University of Halle-Wittenberg, Halle (Saale), Germany, 9 Halle-Jena-Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), Leipzig, Germany, 10 Department of Biology, University of North Carolina at Greensboro, Greensboro, NC, United States, 11 Department Edited by: of Entomology and Plant Pathology, North Carolina State University, Raleigh, NC, United States, 12 Department of Veterinary Akio Adachi, Population Medicine, College of Veterinary Medicine, University of Minnesota, Saint Paul, MN, United States, -

Planning Butterfly Habitat Restorations
Planning Butterfly Habitat Restorations Kim R. Mason Introduction Ecologists and entomologists in Britain and the United States have participated in numerous projects aimed at restoring, expanding, and mitigating losses of habitat for native butterflies. Some of these butterflies have been listed as threatened or endangered; others have been lost or are in decline in certain portions of their former ranges. The experiences and observations of these scientists illustrate potential needs and concerns when planning to restore or improve existing butterfly habitat. This paper will relate several cases in which complex biotic and abiotic interactions played important roles in the success or failure of butterfly habitat restoration and the reestablishment of butterfly populations. Although each butterfly species has its own unique combination of habitat requirements and life history, some fundamental principles concerning butterfly biology (New 1991) are significant in planning habitat restorations. Most caterpillars are herbivores, and many are specialists which feed on only one kind or a few related kinds of plants. Therefore, the presence of appropriate larval host plants is the primary requirement of habitat restoration. In addition, many butterfly species require that the larval food plant be in a particular growth stage, of a certain height, exposed to the proper amount of sunlight, or in close proximity to another resource. Adults typically utilize a wider range of plants or other resources as food, and flight gives them expanded mobility. However, adult dispersal ability varies from species to species. For some, physical features such as a few meters of open space, a stream, a hedge, or a change in gradient create intrinsic barriers to dispersal; other species routinely migrate long distances. -

Large Blue Priority Species Factsheet
t e e h s t c a f Large Blue Maculinea arion Conservation status Priority Species in UK Biodiversity Action Plan. Fully protected under Section 9 of the Wildlife and Countryside Act (1981). Bern Convention (Annexe IV) and 1995-9 Restoration EC Habitats and Species Directive (Annexe IV). sites 1970-82 °+ Pre 1970 This is the largest and rarest of our blue butterflies, distinguished by the unmistakable row of black spots on its upper forewing. The Large Blue has a remarkable life cycle that involves spending most of the year within the nests of red ants, where the larvae feed on ant grubs. The species has always been rare in Britain but declined rapidly during the twentieth century and became extinct in 1979. It has since been reintroduced successfully as part of a major conservation programme and by 2004 occurred on 9 sites. The Large Blue is declining throughout its world range and is a globally Endangered species. Life cycle The Large Blue is single brooded with adults flying from mid-June until late July. Eggs Foodplants are laid on the young flower buds of Wild Thyme. The larvae subsequently burrow into Larvae feed initially on the flower-heads of the flower head to feed on the flowers and developing seeds. Females lay eggs on Wild Thyme Thymus polytrichus but later feed plants growing in a range of vegetation heights, but survival is best in short turf where on ant grubs within the nests of the Myrmica the host ant M.sabuleti is most abundant. When the larvae are around 4 mm long they red ants. -
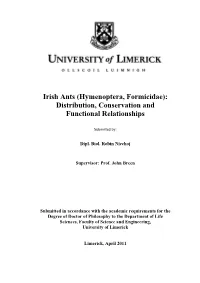
Irish Ants (Hymenoptera, Formicidae): Distribution, Conservation and Functional Relationships
Irish Ants (Hymenoptera, Formicidae): Distribution, Conservation and Functional Relationships Submitted by: Dipl. Biol. Robin Niechoj Supervisor: Prof. John Breen Submitted in accordance with the academic requirements for the Degree of Doctor of Philosophy to the Department of Life Sciences, Faculty of Science and Engineering, University of Limerick Limerick, April 2011 Declaration I hereby declare that I am the sole author of this thesis and that it has not been submitted for any other academic award. References and acknowledgements have been made, where necessary, to the work of others. Signature: Date: Robin Niechoj Department of Life Sciences Faculty of Science and Engineering University of Limerick ii Acknowledgements/Danksagung I wish to thank: Dr. John Breen for his supervision, encouragement and patience throughout the past 5 years. His infectious positive attitude towards both work and life was and always will be appreciated. Dr. Kenneth Byrne and Dr. Mogens Nielsen for accepting to examine this thesis, all the CréBeo team for advice, corrections of the report and Dr. Olaf Schmidt (also) for verification of the earthworm identification, Dr. Siobhán Jordan and her team for elemental analyses, Maria Long and Emma Glanville (NPWS) for advice, Catherine Elder for all her support, including fieldwork and proof reading, Dr. Patricia O’Flaherty and John O’Donovan for help with the proof reading, Robert Hutchinson for his help with the freeze-drying, and last but not least all the staff and postgraduate students of the Department of Life Sciences for their contribution to my work. Ich möchte mich bedanken bei: Katrin Wagner für ihre Hilfe im Labor, sowie ihre Worte der Motivation. -

F Auna Bohemiae Septentrionalis T Omus 41
FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS TOMUS 41/2016 SBORNÍK ODBORNÝCH PRACÍ ZOOLOGICKÉHO KLUBU, Z. S. A ZOOLOGICKÉ ZAHRADY ÚSTÍ NAD LABEM, P. O. FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS ABREVITATIO BIBLIOGRAPHICA: FAUNA BOHEMIAE SEPTENTRIONALIS ISSN 0231-9861 TOMUS 41 2016 Sborník odborných prací Sborník FBS 41 je věnován vzpomínce Zoologického klubu, z. s. a Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o. na pana Herberta TICHÉHO, Fauna Bohemiae septentrionalis dlouholetého člena ZK, Tomus 41, 2016 Náklad 200 kusů který zemřel po dlouhé nemoci Sazba a zajištění tisku: Jasnet, spol. s r. o., Moskevská 1365/3, 400 01 Ústí nad Labem 12. listopadu 2017 ve věku 82 let. Redakční rada: Ing. Věra Vrabcová, Pavlína Slámová Překlad: NaturTranslations Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Uzávěrka dalšího sborníku je 30. 6. 2018 Vydala Zoo Ústí nad Labem za podpory Ministerstva životního prostředí ČR Ministerstvo životního prostředí České republiky 5 OBSAH ZVÍŘATA CHOVANÁ V ZOO ÚSTÍ NAD LABEM K 31.12.2016 7 ORNITOLOGICKÁ POZOROVÁNÍ V ÚSTECKÉM KRAJI V ROCE 2016 79 CAPACITY OF ANIMALS AT THE USTI NAD LABEM ZOO BY 31.12.2016 RARE SIGHTINGS IN 2016 Jiří Vondráček ČINNOST ZOOLOGICKÉHO KLUBU V ROCE 2016 13 ACTIVITIES OF THE ZOOLOGICAL CLUB IN 2016 PŮVODNOST ŽELVY BAHENNÍ NA SEVERNÍ MORAVĚ Věra Vrabcová (S PŘIHLÉDNUTÍM K OKOLÍ MĚSTA OSTRAVY) 95 THE AUTHENTICITY OF THE EUROPEAN POND TURTLE (EMYS ORBICULARIS) IN NORTHERN MORAVIA (WITH CONSIDERATION TO ENVIRONMENT FAUNA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 17 OF THE TOWN OSTRAVA) THE FAUNA OF THE BOHEMIAN SWITZERLAND Jiří J. Hudeček Pavel -
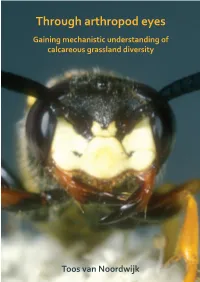
Through Arthropod Eyes Gaining Mechanistic Understanding of Calcareous Grassland Diversity
Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Toos van Noordwijk Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Van Noordwijk, C.G.E. 2014. Through arthropod eyes. Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity. Ph.D. thesis, Radboud University Nijmegen, the Netherlands. Keywords: Biodiversity, chalk grassland, dispersal tactics, conservation management, ecosystem restoration, fragmentation, grazing, insect conservation, life‑history strategies, traits. ©2014, C.G.E. van Noordwijk ISBN: 978‑90‑77522‑06‑6 Printed by: Gildeprint ‑ Enschede Lay‑out: A.M. Antheunisse Cover photos: Aart Noordam (Bijenwolf, Philanthus triangulum) Toos van Noordwijk (Laamhei) The research presented in this thesis was financially spupported by and carried out at: 1) Bargerveen Foundation, Nijmegen, the Netherlands; 2) Department of Animal Ecology and Ecophysiology, Institute for Water and Wetland Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands; 3) Terrestrial Ecology Unit, Ghent University, Belgium. The research was in part commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation as part of the O+BN program (Development and Management of Nature Quality). Financial support from Radboud University for printing this thesis is gratefully acknowledged. Through arthropod eyes Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann volgens besluit van het college van decanen en ter verkrijging van de graad van doctor in de biologie aan de Universiteit Gent op gezag van de rector prof. dr. Anne De Paepe, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 26 augustus 2014 om 10.30 uur precies door Catharina Gesina Elisabeth van Noordwijk geboren op 9 februari 1981 te Smithtown, USA Promotoren: Prof. -

Karner Blue Butterfly
Environmental Entomology Advance Access published April 22, 2016 Environmental Entomology, 2016, 1–9 doi: 10.1093/ee/nvw036 Plant–Insect Interactions Research Article The Relationship Between Ants and Lycaeides melissa samuelis (Lepidoptera: Lycaenidae) at Concord Pine Barrens, NH, USA Elizabeth G. Pascale1 and Rachel K. Thiet Department of Environmental Studies, Antioch University New England, 40 Avon St., Keene, NH 03431 ([email protected]; [email protected]) and 1Corresponding author, e-mail: [email protected] Received 5 December 2015; Accepted 20 April 2016 Abstract Downloaded from The Karner blue butterfly (Lycaeides melissa samuelis Nabokov) (Lepidoptera: Lycaenidae) is a federally listed, endangered species that has experienced dramatic decline over its historic range. In surviving populations, Karner blue butterflies have a facultative mutualism with ants that could be critically important to their survival where their populations are threatened by habitat loss or disturbance. In this study, we investigated the effects of ants, wild blue lupine population status (native or restored), and fire on adult Karner blue butterfly abundance http://ee.oxfordjournals.org/ at the Concord Pine Barrens, NH, USA. Ant frequency (the number of times we collected each ant species in our pitfall traps) was higher in restored than native lupine treatments regardless of burn status during both Karner blue butterfly broods, and the trend was statistically significant during the second brood. We observed a posi- tive relationship between adult Karner blue butterfly abundance and ant frequency during the first brood, partic- ularly on native lupine, regardless of burn treatment. During the second brood, adult Karner blue butterfly abun- dance and ant frequency were not significantly correlated in any treatments or their combinations. -

Based Alpha-Taxonomy of Eusocial Organisms
Myrmecological News 19 1-15 Vienna, January 2014 Application of Exploratory Data Analyses opens a new perspective in morphology- based alpha-taxonomy of eusocial organisms Bernhard SEIFERT, Markus RITZ & Sándor CSŐSZ Abstract This article introduces a new application of the Exploratory Data Analysis (EDA) algorithms Ward's method, Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean (UPGMA), K-Means clustering, and a combination of Non-Metric Multidimen- sional Scaling and K-Means clustering (NMDS-K-Means) for hypothesis formation in morphology-based alpha-taxonomy of ants. The script is written in R and freely available at: http://sourceforge.net/projects/agnesclustering/. The characte- ristic feature of the new approach is an unconventional application of linear discriminant analysis (LDA): No species hypothesis is imposed. Instead each nest sample, composed of individual ant workers, is treated as a separate class. This creates a multidimensional distance matrix between group centroids of nest samples as input data for the clustering methods. We mark the new method with the prefix "NC" (Nest Centroid). The performance of NC-Ward, NC-UPGMA, NC-K-Means clustering, and a combination of Non-Metric Multidimensional Scaling and K-Means clustering (NC- NMDS-K-Means) was comparatively tested in 48 examples with multiple morphological character sets of 74 cryptic species of 13 ant genera. Data sets were selected specifically on the criteria that the EDA methods are likely to lead to errors – i.e., for the condition that any character under consideration overlapped interspecifically in bivariate plots against body size. Morphospecies hypotheses were formed through interaction between EDA and a confirmative linear discri- minant analysis (LDA) in which samples with disagreements between the primary species hypotheses and EDA classifica- tion were set as wild-cards. -

Programme and Abstracts European Congress of Arachnology - Brno 2 of Arachnology Congress European Th 2 9
Sponsors: 5 1 0 2 Programme and Abstracts European Congress of Arachnology - Brno of Arachnology Congress European th 9 2 Programme and Abstracts 29th European Congress of Arachnology Organized by Masaryk University and the Czech Arachnological Society 24 –28 August, 2015 Brno, Czech Republic Brno, 2015 Edited by Stano Pekár, Šárka Mašová English editor: L. Brian Patrick Design: Atelier S - design studio Preface Welcome to the 29th European Congress of Arachnology! This congress is jointly organised by Masaryk University and the Czech Arachnological Society. Altogether 173 participants from all over the world (from 42 countries) registered. This book contains the programme and the abstracts of four plenary talks, 66 oral presentations, and 81 poster presentations, of which 64 are given by students. The abstracts of talks are arranged in alphabetical order by presenting author (underlined). Each abstract includes information about the type of presentation (oral, poster) and whether it is a student presentation. The list of posters is arranged by topics. We wish all participants a joyful stay in Brno. On behalf of the Organising Committee Stano Pekár Organising Committee Stano Pekár, Masaryk University, Brno Jana Niedobová, Mendel University, Brno Vladimír Hula, Mendel University, Brno Yuri Marusik, Russian Academy of Science, Russia Helpers P. Dolejš, M. Forman, L. Havlová, P. Just, O. Košulič, T. Krejčí, E. Líznarová, O. Machač, Š. Mašová, R. Michalko, L. Sentenská, R. Šich, Z. Škopek Secretariat TA-Service Honorary committee Jan Buchar,