Parsifal« Am 29
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
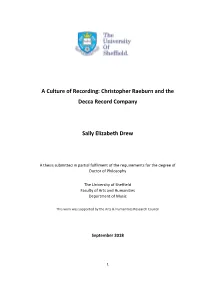
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company
A Culture of Recording: Christopher Raeburn and the Decca Record Company Sally Elizabeth Drew A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The University of Sheffield Faculty of Arts and Humanities Department of Music This work was supported by the Arts & Humanities Research Council September 2018 1 2 Abstract This thesis examines the working culture of the Decca Record Company, and how group interaction and individual agency have made an impact on the production of music recordings. Founded in London in 1929, Decca built a global reputation as a pioneer of sound recording with access to the world’s leading musicians. With its roots in manufacturing and experimental wartime engineering, the company developed a peerless classical music catalogue that showcased technological innovation alongside artistic accomplishment. This investigation focuses specifically on the contribution of the recording producer at Decca in creating this legacy, as can be illustrated by the career of Christopher Raeburn, the company’s most prolific producer and specialist in opera and vocal repertoire. It is the first study to examine Raeburn’s archive, and is supported with unpublished memoirs, private papers and recorded interviews with colleagues, collaborators and artists. Using these sources, the thesis considers the history and functions of the staff producer within Decca’s wider operational structure in parallel with the personal aspirations of the individual in exerting control, choice and authority on the process and product of recording. Having been recruited to Decca by John Culshaw in 1957, Raeburn’s fifty-year career spanned seminal moments of the company’s artistic and commercial lifecycle: from assisting in exploiting the dramatic potential of stereo technology in Culshaw’s Ring during the 1960s to his serving as audio producer for the 1990 The Three Tenors Concert international phenomenon. -

Premieren Der Oper Frankfurt Ab September 1945 Bis Heute
Premieren der Oper Frankfurt ab September 1945 bis heute Musikalische Leitung der Titel (Title) Komponist (Composer) Premiere (Conductor) Regie (Director) Premierendatum (Date) Spielzeit (Season) 1945/1946 Tosca Giacomo Puccini Ljubomir Romansky Walter Jokisch 29. September 1945 Das Land des Lächelns Franz Lehár Ljubomir Romansky Paul Kötter 3. Oktober 1945 Le nozze di Figaro W.A. Mozart Dr. Karl Schubert Dominik Hartmann 21. Oktober 1945 Wiener Blut Johann Strauß Horst-Dietrich Schoch Walter Jokisch 11. November 1945 Fidelio Ludwig van Beethoven Bruno Vondenhoff Walter Jokisch 9. Dezember 1945 Margarethe Charles Gounod Ljubomir Romansky Walter Jokisch 10. Januar 1946 Otto und Theophano Georg Friedrich Händel Bruno Vondenhoff Walter Jokisch 22. Februar 1946 Die Fledermaus Johann Strauß Ljubomir Romansky Paul Kötter 24. März 1946 Zar und Zimmermann Albert Lortzing Ljubomir Romansky Heinrich Altmann 12. Mai 1946 Jenufa Leoš Janáček Bruno Vondenhoff Heinrich Altmann 19. Juni 1946 Spielzeit 1946/1947 Ein Maskenball Giuseppe Verdi Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 29. September 1946 Così fan tutte W.A. Mozart Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 10. November 1946 Gräfin Mariza Emmerich Kálmán Georg Uhlig Heinrich Altmann 15. Dezember 1946 Hoffmanns Erzählungen Jacques Offenbach Werner Bitter Karl Puhlmann 2. Februar 1947 Die Geschichte vom Soldaten Igor Strawinsky Werner Bitter Walter Jokisch 30. April 1947 Mathis der Maler Paul Hindemith Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 8. Mai 1947 Cavalleria rusticana / Pietro Mascagni / Werner Bitter Heinrich Altmann 1. Juni 1947 Der Bajazzo Ruggero Leoncavallo Spielzeit 1947/1948 Ariadne auf Naxos Richard Strauss Bruno Vondenhoff Hans Strohbach 12. September 1947 La Bohème Giacomo Puccini Werner Bitter Hanns Friederici 2. November 1947 Die Entführung aus dem W.A. -

Constructing the Archive: an Annotated Catalogue of the Deon Van Der Walt
(De)constructing the archive: An annotated catalogue of the Deon van der Walt Collection in the NMMU Library Frederick Jacobus Buys January 2014 Submitted in partial fulfilment for the degree of Master of Music (Performing Arts) at the Nelson Mandela Metropolitan University Supervisor: Prof Zelda Potgieter TABLE OF CONTENTS Page DECLARATION i ABSTRACT ii OPSOMMING iii KEY WORDS iv ACKNOWLEDGEMENTS v CHAPTER 1 – INTRODUCTION TO THIS STUDY 1 1. Aim of the research 1 2. Context & Rationale 2 3. Outlay of Chapters 4 CHAPTER 2 - (DE)CONSTRUCTING THE ARCHIVE: A BRIEF LITERATURE REVIEW 5 CHAPTER 3 - DEON VAN DER WALT: A LIFE CUT SHORT 9 CHAPTER 4 - THE DEON VAN DER WALT COLLECTION: AN ANNOTATED CATALOGUE 12 CHAPTER 5 - CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 18 1. The current state of the Deon van der Walt Collection 18 2. Suggestions and recommendations for the future of the Deon van der Walt Collection 21 SOURCES 24 APPENDIX A PERFORMANCE AND RECORDING LIST 29 APPEDIX B ANNOTED CATALOGUE OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION 41 APPENDIX C NELSON MANDELA METROPOLITAN UNIVERSTITY LIBRARY AND INFORMATION SERVICES (NMMU LIS) - CIRCULATION OF THE DEON VAN DER WALT (DVW) COLLECTION (DONATION) 280 APPENDIX D PAPER DELIVERED BY ZELDA POTGIETER AT THE OFFICIAL OPENING OF THE DEON VAN DER WALT COLLECTION, SOUTH CAMPUS LIBRARY, NMMU, ON 20 SEPTEMBER 2007 282 i DECLARATION I, Frederick Jacobus Buys (student no. 211267325), hereby declare that this treatise, in partial fulfilment for the degree M.Mus (Performing Arts), is my own work and that it has not previously been submitted for assessment or completion of any postgraduate qualification to another University or for another qualification. -

Historie Premieren
Premieren der Oper Frankfurt ab September 1945 bis heute (alphabetisch nach Komponisten) Musikalische Leitung der Premiere Komponist (Composer) Titel (Title) Regie (Director) Premierendatum (Date) (Conductor) John Adams Nixon in China John Adams Peter Sellars 2. Juli 1992 Thomas Adès The Tempest (Der Sturm) Johannes Debus Keith Warner 10. Januar 2010 Eugen d'Albert Tiefland Werner Bitter Karl Puhlmann 23. April 1949 Tiefland Sebastian Weigle Anselm Weber 10. Dezember 2006 Francisco António de Almeida La Giuditta Felice Venanzoni Guillaume Bernardi 12. Juni 2010 (Bockenheimer Depot) Jörn Arnecke Unter Eis Johannes Debus Falk Richter 2. Juni 2008 (Bockenheimer Depot) Samuel Barber Vanessa Jonathan Darlington Katharina Thoma 2. September 2012 Béla Bartók Herzog Blaubarts Burg Hans Löwlein Harry Buckwitz 27. Februar 1964 Herzog Blaubarts Burg Christoph von Dohnányi Klaus Michael Grüber 26. Juni 1974 Herzog Blaubarts Burg Sylvain Cambreling Herbert Wernicke 13. März 1994 Herzog Blaubarts Burg Constantinos Carydis Barrie Kosky 5. Dezember 2010 Ludwig van Beethoven Fidelio Bruno Vondenhoff Walter Jokisch 9. Dezember 1945 Fidelio Bruno Vondenhoff Heinz Tietjen 28. Oktober 1954 Fidelio Sir Georg Solti Harry Buckwitz 1. November 1959 Fidelio Christoph Dohnányi Achim Freyer / Christoph von Dohnányi 2. April 1976 Fidelio Sylvain Cambreling Christoph Martaler 13. April 1997 Fidelio Paolo Carignani Christina Paulhofer / Alex Harb 1. Juni 2008 Vincenzo Bellini Il Pirata Imre Palló (konzertant ) 25. März 1990 (in der Alten Oper) I puritani Tito Ceccherini Vincent Boussard 2. Dezember 2018 Norma Michael Halász (konzertant) 19. Dezember 1976 Norma Pier Giorgio Morandi konzertant 28. Oktober 2008 Norma Antonino Fogliani Christof Loy (Änderung Team) 10. Juni 2018 La sonnambula Eun Sun Kim Tina Lanik 30. -

9Th International Solti-Competition Conditions
9th International Solti-Competition Conditions 9th International Conductors’ Competition Sir Georg Solti October 7 – 11, 2020 Frankfurt am Main, Germany Patroness Lady Valerie Solti Cooperation Partners Alte Oper Frankfurt Frankfurter Museums-Gesellschaft Hessischer Rundfunk / The Frankfurt Radio Symphony Oper Frankfurt Orchestras The Frankfurt Radio Symphony Frankfurter Opern- und Museumsorchester Made possible by Dr. Hans Feith and Dr. Elisabeth Feith Foundation Frankfurter Volksbank Das gemischte Doppel e.V. – Philipp Holzer Geldermann Privatsektkellerei CONDITIONS OF PARTICIPATION Applications All conductors born between including 1986 and 2002 are eligible to apply for participation in the competition. Former prize winners are not eligible to reapply. Applications must be received via www.dirigentenwettbewerb-solti.de or by email including application form only by the competition office by April 30, 2020 at the latest. No application received after that date will be accepted. Applications must be accompanied by the following documents (either in German or English): – Online application form (or pdf application form when applying by email) – Curriculum vitae (preferably in table form) – Copies in PDF format of documents evidencing applicant’s musical studies and conducting experience (cer- tificates, letters of recommendation, concert programs, etc.) – Video links (YouTube, coded video services etc.) showing recordings of representative conducting sessions (concerts or operas, including rehearsals if available) – Three different photos taken recently in HD file format (with at least one fine portrait) – Copy of birth certificate or passport (with translation if necessary) 1 of 4 There is no admission fee. Receipt of a complete set of documents will be acknowledged and confirmed. Please note that application documents and materials will not be returned. -

Florian Erdl Florian Erdl Has Been Assisting GMD Sebastian Weigle At
Florian Erdl * 1981 in München 2019 Guest conductor at Oper Frankfurt 2019 Guest conductor at LJO Hessen 2019 Concerts with the Sønderjyllands Symfoniorkester 2018 Concerts with the Philharmonie Merck since 2017 Assistant to Sebastian Weigle (Oper Frankfurt) since 2017 1st Kapellmeister and deputy GMD at Theater Pforzheim 2017 Guest conductor at Theater Coburg 2014–2017 1st Kapellmeister and deputy GMD at Landestheater in Flensburg 2012–2014 Kapellmeister at Oper Graz 2010/15 Guest conductor at Oper Kiel since 2010 Guest conductor at LJO Schleswig-Holstein 2010/12/14 Guest conductor at the Landestheater in Innsbruck since 2009 Music Director of Chamber Opera Frankfurt in the Palmengarten Florian Erdl has been assisting GMD Sebastian Weigle at Oper Frankfurt since november 2017. After the work on Richard Strauss’ Capriccio he will conduct at Oper Frankfurt Mozart’s Magic Flute (2018) and Schrekers Der Ferne Klang/The Distant Sound (2019). Coming saison he will lead four symphony concerts with the Symphonieorchester Bad Nauheim, the Badische Philharmonie Pforzheim, the Sønderjyllands Symfoniorkester and the LJO Hessen. Besides he will conduct Wagners Rhingold, Prokofieff’s L’Amour des Trois Oranges/The Love for the three Oranges and Bizets Perlenfischer/The Pearl Fishers. He also will take over the new productions of Donizettis Elisir d’amore und Stravinskis Firebird. Recent operas he has rehearsed and conducted have included besides Mozart’s Magic Flute, Così fan tutte and 20th century music (Stravinsky’s A Soldiers Tale, Bartók’s Bluebeard’s Castle) especially ones by Verdi (La Traviata, Macbeth and Un Ballo in maschera). His symphonic concert repertoire (he is also good at introducing works to an audience) ranges from late romantic & expressionistic pieces to works by Hans Werner Henze. -

Premiere TRISTAN UND ISOLDE Story in Three Acts by Richard Wagner Libretto by the Composer Based on the Narrative Poem Tristan (C
Premiere TRISTAN UND ISOLDE Story in three acts by Richard Wagner Libretto by the composer based on the narrative poem Tristan (c. 1210) by Gottfried von Straßburg Sung in German with German and English surtitles Conductor: Sebastian Weigle Director: Katharina Thoma Set Designer: Johannes Leiacker Costume Designer: Irina Bartels Lighting Designer: Olaf Winter Chorus Master: Tilman Michael Dramaturge: Mareike Wink Tristan: Vincent Wolfsteiner Isolde: Rachel Nicholls King Marke: Andreas Bauer Kanabas / Falk Struckmann (June, July 2020) Brangäne: Claudia Mahnke / Tanja Ariane Baumgartner (June, July 2020) Kurwenal: Christoph Pohl / Simon Bailey (June, July 2020) Melot: Iain MacNeil A Shepherd: Tianji Lin Helmsman: Liviu Holender A Young Sailor’s Voice: Michael Porter / Michael Petruccelli (February 14th, 23rd 2020) Oper Frankfurt’s Male Chorus; Frankfurter Opern- und Museumsorchester Tristan und Isolde is regarded as one of the best operas written by Richard Wagner (1813-1883) and an enormous milestone in music. The way his „Tristan chord“ resolves towards the end of the work during Isolde’s „Liebestod“ was unthinkable in those days. The composer was well aware how difficult it would be to stage this three act work: „Only mediocre productions might save me“, he wrote to Mathilde Wesendonck. The World Premiere on June 10th 1865 in the National Theatre in Munich, at the command of King Ludwig II, was a great success. The last production of Tristan in Frankfurt opened in 2003, directed by Christof Nel. The story: Although Tristan killed Isolde’s betrothed in battle, the Irish princess nursed the wounded knight back to health, incapable of carrying out her revenge. -

2021/22 Season
2021/22 Season New Productions George Frideric Handel Amadigi Saturday September 25 2021 (Bockenheimer Depot) Conductor: Roland Böer Director: Andrea Bernard Set Designer: Alberto Beltrame Costume Designer: Elena Beccaro Lighting Designer: Jan Hartmann Dramaturge: Zsolt Horpácsy Domenico Cimarosa L'italiana in Londra Sunday September 26 2021 Conductor: Leo Hussain Director: R.B. Schlather Set Designer: Paul Steinberg Costume Designer: Doey Lüthi Lighting Designer: Joachim Klein Dramaturge: Mareike Wink Carl Nielsen Maskerade (Masquerade) Sunday October 31 2021 Conductor: Titus Engel Director: Tobias Kratzer Set & Costume Designer: Rainer Sellmaier Lighting Designer: Joachim Klein Choreographer: Kinsun Chan Chorus Master: Tilman Michael Dramaturge: Konrad Kuhn With generous support from the Danish Ministry for Culture and Royal Danish Embassy Nikolai A. Rimsky-Korsakov Die Nacht vor Weihnachten (The Night Before Christmas) Sunday December 5 2021 Conductor: Sebastian Weigle Director: Christof Loy Set Designer: Johannes Leiacker Costume Designer: Ursula Renzenbrink Lighting Designer: Olaf Winter Choreographer: Klevis Elmazaj Flying Choreographer: Ran Arthur Braun Chorus Master: Tilman Michael Dramaturge: Maximilian Enderle 1 Hauke Berheide The People Out There (World Premiere) Wednesday December 22 2021 (Bockenheimer Depot) Conductor: Roland Böer Director: Amy Stebbins Set Designer: Christian Wiehle Costume Designer: Belén Montoliu Video: Lukas Rehm Lighting Designer: Joachim Klein Dramaturge: Mareike Wink The Ensemble Modern Commissioned -

Decca Discography
DECCA DISCOGRAPHY >>V VIENNA, Austria, Germany, Hungary, etc. The Vienna Philharmonic was the jewel in Decca’s crown, particularly from 1956 when the engineers adopted the Sofiensaal as their favoured studio. The contract with the orchestra was secured partly by cultivating various chamber ensembles drawn from its membership. Vienna was favoured for symphonic cycles, particularly in the mid-1960s, and for German opera and operetta, including Strausses of all varieties and Solti’s “Ring” (1958-65), as well as Mackerras’s Janá ček (1976-82). Karajan recorded intermittently for Decca with the VPO from 1959-78. But apart from the New Year concerts, resumed in 2008, recording with the VPO ceased in 1998. Outside the capital there were various sessions in Salzburg from 1984-99. Germany was largely left to Decca’s partner Telefunken, though it was so overshadowed by Deutsche Grammophon and EMI Electrola that few of its products were marketed in the UK, with even those soon relegated to a cheap label. It later signed Harnoncourt and eventually became part of the competition, joining Warner Classics in 1990. Decca did venture to Bayreuth in 1951, ’53 and ’55 but wrecking tactics by Walter Legge blocked the release of several recordings for half a century. The Stuttgart Chamber Orchestra’s sessions moved from Geneva to its home town in 1963 and continued there until 1985. The exiled Philharmonia Hungarica recorded in West Germany from 1969-75. There were a few engagements with the Bavarian Radio in Munich from 1977- 82, but the first substantial contract with a German symphony orchestra did not come until 1982. -

Magazin Saison 2015/16 September ––– Oktober
Carmen MAGAZIN SAISON 2015/16 SEPTEMBER ––– OKTOBER Premieren: Der Sandmann Paul Bunyan Martha oder Der Markt zu Richmond Wiederaufnahmen: Carmen Falstaff Lohengrin Stiffelio 1 Carmen 1 BERLIN FRANKFURT KÖLN STUTTGART Kantstraße Bleichstraße Kaiser-Wilhelm-Ring Königstraße DÜSSELDORF HAMBURG MÜNCHEN E-SHOP 2 Grünstraße Große Elbstraße Ludwigstraße tobias-grau.com Partner Inhalt 6 Besonderer Dank gilt dem Frankfurter Patronatsverein Der Sandmann der Städtischen Bühnen e.V. Andrea Lorenzo Scartazzini — Sektion Oper 14 Paul Bunyan Benjamin Britten 20 Hauptförderer Ur- und Erstaufführungen Martha oder Der Markt zu Richmond Friedrich von Flotow 28 Liederabend Hauptförderer Opernstudio Andreas Schager 29 Carmen Georges Bizet 29 Falstaff Giuseppe Verdi Produktionspartner 30 Lohengrin Richard Wagner Projektpartner 29 Stiffelio Giuseppe Verdi 32 JETZT! Oper für dich 37 Konzerte Ensemble Partner MeisterSinger Uhren 36 Stiftung Ottomar Päsel, Neu im Ensemble Königstein/Ts. AJ Glueckert Josef F. Wertschulte 38 Education Partner Service BHF-BANK-Stiftung Deutsche Vermögens- beratung AG Europäische Zentralbank Fraport AG Klassik Partner Commerzbank AG FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 4 Liebe Freunde der Oper Frankfurt, liebes Publikum, natürlich sind Sie, wenn Sie dieses Magazin unmittelbar vor erschien mir die Stimme zu schwer für Mozart – ein kerniger, den ersten Vorstellungen der neuen Saison in die Hand metallisch geprägter Klang, der später bei Wagner besser nehmen, auf Neuigkeiten, auf stimulierende Ankündigungen, aufgehoben war. 81 Jahre wurde Alberto Remedios alt und auf Hinweise aus erster Hand fixiert. Dieses Vorwort aber war sein Leben lang dem FC Liverpool verbunden… wurde lange vor Spielzeitbeginn formuliert – und zwar an einem geschichtsträchtigen Tag: Am Morgen dieses 24. Juni Jetzt, im September, wird ein neues Spiel gespielt: Es gibt 2016 wurde der Fernseher eingeschaltet und Fachleute eine neue Stadtregierung, eine neue Kulturdezernentin debattierten bereits darüber, wie sich der Austritt Großbri- und einen, zumindest teilweise, neuen Aufsichtsrat. -

Die Spielzeit 2005/06 Der Oper Frankfurt, Die Dritte Spielzeit Unter
Spielzeit 2018/19 „Ein pralles Angebot erwartet unser Publikum auch in der Saison 2018/19 – ein mutiges Programm, von der Vision geprägt, dass die Freunde unseres Hauses unseren Vorschlägen folgen und aufs Neue der Erweiterung des Repertoires zustimmen. Und unsere Zukunft? Die Römer-Koalition lässt prüfen, inwiefern eine Sanierung auf kleinem Niveau die längerfristige Bespielung der Bühnen begründen, wie auch in Zukunft die Sicherheit der hier Arbeitenden und die des Publikums garantieren könnte. Zwingende Arbeitsschutzmaßnahmen wie Fragen der Energetik und viele im Detail zu lösende Aufgaben sollen neu gewichtet und bewertet werden. Natürlich ist nachvollziehbar, dass eine Stadt wie Frankfurt mit ihren vielfältigen Aufgaben und sozialen Verpflichtungen eine kostengünstige Lösung anstrebt. Die Vision eines neuen Opernhauses in einer stetig wachsenden Stadt, das neue Touristenströme anzieht, eine größere Internationalität anstrebt und auch die vorhandene Basis mit weiteren hochklassigen Produktionen füttert, mag erlaubt sein. Man muss nicht die Elbphilharmonie im Blick haben, wenn man die Frankfurter Situation als Chance des Theaters als Ort der Begegnung rund um die Uhr begreifen möchte – doch der erste Schritt muss vor dem zweiten getan werden.“ Soweit Bernd Loebes Gedanken kurz vor seiner 17. Frankfurter Spielzeit. Der Spielplan der Oper Frankfurt in der Saison 2018/19 bietet wieder mehr als 500 Veranstaltungen insgesamt, davon 189 Musiktheatervorstellungen. Auf dem Programm stehen erneut 12 Premieren mit insgesamt 90 Vorstellungen, davon finden 8 szenische und eine konzertante Premiere mit 73 Vorstellungen im Opernhaus sowie 3 Premieren mit 17 Vorstellungen im Bockenheimer Depot statt. Darüber hinaus sind 17 Wiederaufnahmen mit 99 Vorstellungen sowie 8 Liederabende im Opernhaus geplant. Dort bildet am 9. -

Premiere LADY MACBETH of MTSENSK Opera in Four Acts (Nine Scenes) by Dmitri D
Premiere LADY MACBETH OF MTSENSK Opera in four acts (nine scenes) by Dmitri D. Shostakovitch Libretto by the composer and Alexander G. Preis based on Nikolai S. Leskov Sung in Russian with German and English surtitles Conductor: Sebastian Weigle Director: Anselm Weber Set and Costume Designer: Kaspar Glarner Lighting Designer: Olaf Winter Video: Bibi Abel Chorus and Extra Chorus Master: Tilman Michael Dramaturge: Konrad Kuhn Katerina Ismailowa: Anja Kampe Axinja: Julia Dawson Sergei: Dmitry Golovnin House boy: Mikołaj Trąbka Boris Ismailow / Old forced labourer: Dmitry Belosselskiy Policeman / Guard: Dietrich Volle Sinowi Ismailow: Evgeny Akimov Teacher / 1st foreman: Theo Lebow Shabby man: Peter Marsh Drunk guest / 2nd foreman: Michael McCown Sonjetka: Zanda Švēde 3rd foreman: Hans-Jürgen Lazar Pope: Alfred Reiter Female labourer: Barbara Zechmeister Chief of Police: Iain MacNeil Coachman: Alexey Egorov Custodian / Sergeant: Anthony Robin Schneider Miller: Yongchul Lim Oper Frankfurt's Chorus, Extra Chorus and Extras; Frankfurter Opern- und Museumsorchester With generous support from the Frankfurt Patronatsverein – Sektion Oper January 22nd 1934 was the day when Lady Macbeth of Mtsensk by Dmitri D. Shostakovitch (1906-1975) was a great success at its world premiere in the Maly Theater in Saint Petersburg. The libretto for his second opera, written by this Russian composer in collaboration with Alexander G. Preis, was based on the novel by the same name by Nikolai S. Leskov (1865). The work vanished from the repertoire of theatres in the Soviet Union for many years after Stalin banned it from being performed in 1936. It is more than a quarter of a century since Lady Macbeth of Mtsensk was seen in Frankfurt, in Werner Schroeter's production, which opened on March 7 1993.