Deutscher Rap – Von Den Ursprüngen Bis Heute Entwicklung Und Szene
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
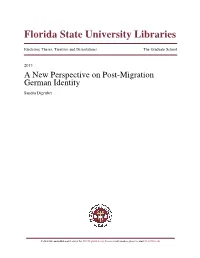
A New Perspective on Post-Migration German Identity Sandra Digruber
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2015 A New Perspective on Post-Migration German Identity Sandra Digruber Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES A NEW PERSPECTIVE ON POST-MIGRATION GERMAN IDENTITY By SANDRA DIGRUBER A Thesis submitted to the Department of Modern Languages and Linguistics in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Degree Awarded: Spring Semester, 2015 Sandra Digruber defended this thesis on April 3, 2015. The members of the supervisory committee were: Christian Weber Professor Directing Thesis Birgit Maier-Katkin Committee Member A. Dana Weber Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the thesis has been approved in accordance with university requirements. ii TABLE OF CONTENTS Abstract .......................................................................................................................................... iv 1. INTRODUCTION ...................................................................................................................... 1 2. ATTEMPTS TO DEFINE GERMAN IDENTITY IN THE 19TH-CENTURY ......................... 3 2.1 Johann Gottlieb Fichte ........................................................................................................ 7 2.2 Richard Wagner ............................................................................................................... -

Worldcharts TOP 75 + Album TOP 30 Vom 09.05.2019
CHARTSSERVICE – WORLDCHARTS – TOP 75 SINGLES NO. 1012 – 09.05.2019 PL VW WO PK ARTIST SONG 1 1 5 1 BILLIE EILISH bad guy 2 2 3 2 AVICII ft. ALOE BLACC sos 3 4 5 3 LIL NAS X ft. BILLY RAY CYRUS old town road 4 3 9 1 JONAS BROTHERS sucker 5 - 1 5 TAYLOR SWIFT ft. BRENDON URIE me! 6 5 13 5 DADDY YANKEE & SNOW con calma 7 6 14 5 MABEL don't call me up 8 13 3 8 BTS ft. HALSEY boy with luv 9 7 16 2 CALVIN HARRIS & RAG'N'BONE MAN giant 10 11 31 1 LADY GAGA & BRADLEY COOPER shallow 11 9 7 9 AVA MAX so am i 12 10 30 1 AVA MAX sweet but psycho 13 15 14 13 LEWIS CAPALDI someone you loved 14 14 7 12 MARSHMELLO ft. CHVRCHES here with me 15 12 16 4 SAM SMITH & NORMANI dancing with a stranger 16 8 15 1 ARIANA GRANDE 7 rings 17 18 10 12 P!NK walk me home 18 17 22 16 PEDRO CAPÓ ft. FARRUKO calma 19 42 2 19 MADONNA & MALUMA medellín 20 19 12 19 KHALID & DISCLOSURE talk 21 16 11 10 ZEDD ft. KATY PERRY 365 22 25 4 22 MEDUZA ft. GOODBOYS piece of your heart 23 23 28 6 POST MALONE & SWAE LEE sunflower 24 20 25 15 IMAGINE DRAGONS bad liar 25 24 22 2 MARK RONSON ft. MILEY CYRUS nothing breaks like a heart 26 38 2 26 LIL DICKY earth 27 22 18 7 POST MALONE wow. -

Was Haben Das GCHQ, Korea, Die Playstation 4 Und Der Sponsorenlauf Gemeinsam?
Eulenpost Ausgabe 2/2013 24.10.2013 Was haben das GCHQ, Korea, die Playstation 4 und der Sponsorenlauf gemeinsam? Liebe Leserinnen und Leser, es ist schon wieder so weit, die zweite Ausgabe der Eulen- post ist erschienen! Inzwi- schen hat sie sich an unserer Schule etabliert und mag den meisten, die auch die letzte Ausgabe lasen, schon etwas vertraut vorkommen. Auch dieses Mal deckt die Eulenpost, natürlich vollkom- men kostenlos, ein breites Spektrum an Themen ab, so- dass jeder einen Artikel fin- den wird, der ihn besonders interessiert. Zum Beispiel schrieb Lukas Bothe über den Abhörskan- dal, verursacht durch die NSA und das GCHQ, aufgedeckt durch den Ex- Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden und die Reaktionen darauf in Deutschland. Unsere Ko- reakorrespondentin JuRi Kim, Ex-Waldschülerin, berichtet von der Geschichte Koreas und wie es dazu kam, dass es geteilt wurde. Außerdem kommentiert Niklas Hons Die Redaktion der Eulenpost Photo: Tobias Höbbel unser Geldsystem und Tobias Höbbel stellte die Batch- http://eulenpost.jimdo.com/, auf der AG sind, jedoch trotzdem Arti- Dateien vor. Christian Vogel der nicht nur die aktuelle Ausgabe kel für die Eulenpost schreiben, vergleicht die beiden neusten zum Download bereitsteht, son- sind genauso wie Leserbriefe mehr Spielkonsolen, die Xbox One dern sich auch ein Archiv mit allen als erwünscht. Sendet eure Texte und die Playstation 4, mitei- vorangegangenen Ausgaben befin- bitte an die E-Mail-Adresse arti- nander. Darüber hinaus gibt det. Außerdem gibt es dort eine [email protected]. es auch sehr schulbezogene Sportkolumne von Sebastian Vogel Themen wie den Sponsoren- Für eure persönliche Meinung ste- und verschiedene Foren, in denen lauf oder das Graffiti-Projekt hen das Forum und die E-Mail- ihr über die Eulenpost selbst sowie am Combi-Markt in Be- Adresse kritik.eulenpost@t- andere Themen wie die Bundes- verstedt. -

Deutschland Singles TOP 100 2019 / 29 19.07.2019
19.07.2019 Deutschland Singles TOP 100 2019 / 29 Pos Vorwochen Woc BP T i t e l 2019 / 29 - 1 1 --- --- 1N1 1 Zombie . Samra x Capital Bra 21241 1 Señorita . Shawn Mendes & Camila Cabello 33141 2 Tilidin . Capital Bra & Samra 4 --- --- 1N4 Raffaello . Shindy 5 2 --- 22 Jetzt Rufst Du An . Loredana 676102 I Don't Care . Ed Sheeran & Justin Bieber 745161 4 Old Town Road . Lil Nas X 81314164 Bad Guy . Billie Eilish 9151339 Beautiful People . Ed Sheeran feat. Khalid 10 --- --- 1N10 Energie . Sido feat. Luciano . 11 8 7 111 2 Vermissen . Juju feat. Henning May 12 10 9 119 Piece Of Your Heart . Meduza feat. Goodboys 13 6 3 33 On Off . Shirin David feat. Maître Gims 14 11 11 159 Vincent . Sarah Connor 15 5 --- 25 Yallah Goodbye . Summer Cem x Gringo 16 12 10 91 2 Wieder Lila . Samra & Capital Bra 17 9 4 34 Shot . Ufo361 feat. Data Luv 18 --- --- 1N18 Babygirl . Shindy 19 --- --- 1N19 Babyblau . Shindy 20 14 8 53 Diamonds . Summer Cem feat. Capital Bra . 21 20 37 520 Loco Contigo . DJ Snake & J Balvin feat. Tyga 22 16 --- 216 Goodbyes . Post Malone feat. Young Thug 23 --- --- 1N23 Antisocial . Ed Sheeran & Travi$ Scott 24 19 26 619 Narcotic . Younotes & Janieck & Senex 25 54 45 102 Nautilus . Shindy 26 38 23 823 Cross Me . Ed Sheeran feat. Chance The Rapper & PnB Rock 27 --- --- 1N27 Drama . Shindy 28 --- --- 1N28 Rapsuperstar . Shindy 29 --- --- 1N29 Remember The Name . Ed Sheeran feat. Eminem & 50 Cent 30 --- --- 1N30 Bietigheim Sunshine . Shindy . 31 17 17 226 Con Calma . -

Und Weiblichkeitskonstruktionen Deutschsprachiger Rapper/-Innen
Universitätsverlag Potsdam Martin Reger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen deutschsprachiger Rapper/-innen Eine Untersuchung des Gangsta-Raps Soziologische Theorie und Organization Studies | 2 Martin Reger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen deutschsprachiger Rapper/-innen Soziologische Theorie und Organization Studies | 2 Martin Reger Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen deutschsprachiger Rapper/-innen Eine Untersuchung des Gangsta-Raps Universitätsverlag Potsdam Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Universitätsverlag Potsdam 2015 http://verlag.ub.uni-potsdam.de/ Universitätsverlag Potsdam, Am Neuen Palais 10, 14469 Potsdam Tel. +49 (0)331 977 2533, Fax -2292 E-Mail: [email protected] Die Schriftenreihe Soziologische Theorie und Organization Studies wird herausgegeben von Maja Apelt und Jürgen Mackert. ISSN (print) 2363-8168 ISSN (online) 2363-8176 Zugl.: Potsdam, Univ., Masterarbeit, 2014 Satz: Elisabeth Döring, wissen.satz Druck: docupoint GmbH Magdeburg Umschlagabbildung: https://pixabay.com/de/hip-hop-rap-mikrofon-musik-passion- 264396/ (CC0 Public Domain) Dieses Werk ist unter einem Creative Commons Lizenzvertrag lizenziert: Namensnennung 4.0 International Um die Bedingungen der Lizenz einzusehen, folgen Sie bitte dem Hyperlink: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ISBN 978-3-86956-342-8 Parallel online veröffentlicht auf dem Publikationsserver der Universität Potsdam URN urn:nbn:de:kobv:517-opus4-81630 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus4-81630 Vorwort Das vorliegende Buch druckt die Masterarbeit in Soziologie ab, die ich am Lehrstuhl für Geschlechtersoziologie an der Univer- sität Potsdam geschrieben habe. Da die Arbeit im Sommersemester 2014 verfasst wurde, konnte nur Datenmaterial untersucht werden, das bis zu diesem Zeitpunkt verfügbar war. -

Jahrescharts 2019
JAHRESCHARTS 2019 TOP 200 TRACKS PEAK ARTIST TITLE LABEL/DISTRIBUTOR POSITION 01 DJ Khaled Ft. SZA Just Us We The Best/Epic/Sony 01 02 Chris Brown Undecided RCA/Sony 01 03 Blueface Ft. Cardi B. & YG Thotiana (Remix) Fifth Amendment/eOne 01 04 DJ ClimeX Ft. Nantaniel & Nolay Baila ClimeX Entertainment 01 05 Gang Starr Ft. J. Cole Family And Loyalty Gang Starr Enterprises 01 06 Tyga Ft. G-Eazy & Rich The Kid Girls Have Fun Last Kings/Empire 01 07 Major Lazer Ft. J Balvin & El Alfa Que Calor Mad Decent/Because/Caroline/Universal 01 08 Marshmello Ft. Tyga & Chris Brown Light It Up Joytime Collective/RCA/Sony 02 09 Ed Sheeran & Travis Scott Antisocial Asylum/Atlantic UK/WMI/Warner 02 10 DJ Spanish Fly Ft. Señorita Bailemos Major Promo Music 03 11 Chris Brown Ft. Nicki Minaj & G-Eazy Wobble Up RCA/Sony 01 12 Cardi B Ft. Bruno Mars Please Me Atlantic/WMI/Warner 01 13 Chris Brown Ft. Drake No Guidance RCA/Sony 03 14 DJ ClimeX Ft. Michael Rankiao & Öz Fuego ClimeX Entertainment 01 15 Snoop Dogg Ft. Chris Brown Turn Me On Doggystyle/Empire 01 16 Culcha Candela Ballern Culcha Sound/The Orchard 03 17 Seeed G€LD Seeed/BMG Rights/ADA 03 18 French Montana Ft. City Girls Wiggle It Epic/Sony 01 19 DJ Mustard & Migos Pure Water 10 Summers/UMI/Universal 03 20 Apache 207 Roller TwoSides/Four Music/Sony 04 21 Lil Pump Ft. Lil Wayne Be Like Me Warner Bros./WMI/Warner 04 22 Nicki Minaj Megatron Young Money/Cash Money/UMI/Universal 01 23 Travis Scott Highest In The Room Epic/Sony 03 24 Gesaffelstein & The Weeknd Lost In The Fire Columbia/Sony 03 25 Ardian Bujupi & Farruko Ft. -

"Kollegah" Und "Farid Bang" Bei Der Rap-Night Am 14.Juni - Hessentag 2017
Landesverband Hessen e.V. Postfach 17 03 41 Wenn unzustellbar, bitte an Absender zurück: 60077 Frankfurt LSVD-Hessen, Postfach 170 341, 60077 Frankfurt E-Mail [email protected] An den www.hessen.lsvd.de Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Rüsselsheim am Main Jens Grode Mitglied in der Frankfurter Straße 68 International Lesbian and 65428 Rüsselsheim am Main Gay Association (ILGA) Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Hessen Frankfurt a.M., 15.12.2016 Auftritte "Kollegah" und "Farid Bang" bei der Rap-Night am 14.Juni - Hessentag 2017 Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Grode, im Rahmen des Hessentages 2017 wird die sogenannte „Rap-Night mit Kollegah, Azad, Farid Bang, Eko Fresh, Lumaraa und Der Asiate“ stattfinden. Die Ankündigung findet sich auf https://www.hessentag2017.de/veranstaltungen/veranstaltungshighlights.html Die Stadt Rüsselheim tritt hierbei als Veranstalter auf und hat die Auftritte durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24.11.2016 genehmigt. Bereits im Vorfeld des Beschlusses gab es den Hinweis, dass die genannten Interpreten Felix Blume alias „Kollegah“ und Farid Hamed El Abdellaoui alias „Farid Bang“ in ihren Stücken gegen Frauen, Schwule und Menschen hetzen, die nicht der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft entsprechen. Einzelne Raptexte sind homophob, gewaltverherrlichend und zutiefst sexistisch und frauenfeindlich. Landesvorstand Anschrift Internet LSVD Hessen e.V. Knut Nagel LSVD Hessen E-Mail: [email protected] Matthias E. Janssen Postfach 170341 http://www.hessen.lsvd.de Lotte Köhler 60077 Frankfurt https://www.facebook.com/lsvdhessen/ am Main - 2 - Als Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Hessen haben wir zu diesem Vorgang den Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim und den Hessentagbeauftragten angeschrieben und um Stellungnahme gebeten. Anbei übersenden wir Ihnen beide Schreiben in Kopie zur Kenntnisnahme. -

Pointen, Sprachspiele Und Wortwitz in Rap-Texten
Schäfer, Ansgar MASTERTHESIS Pointen, Sprachspiele und Wortwitz in Rap-Texten Linguistische Grundlagen und exemplarische Analysen Fachbereich 05 (Institut für Germanistik) der Justus-Liebig-Universität Gießen Marburg, den 15.03.2016 Zur Verfügung gestellt auf content-lover.com Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung .................................................................................................................. 4 2. Stand der Forschung .................................................................................................. 6 3. Rap-Musik und ihre Entstehung im Kontext der HipHop-Kultur ............................. 9 3.1 Das Aufkommen von Rap-Musik in den USA............................................. 10 3.2 Rap-Musik in Deutschland ........................................................................... 13 3.3 HipHop als „Battle“-Kultur .......................................................................... 16 3.4 Battle-Rap..................................................................................................... 19 4. Die Textsorte „Rap-Text“ und der „Punchline“-Begriff ......................................... 22 4.1 Kennzeichen der Textsorte „Rap-Text“ ....................................................... 22 4.2 Punchlines .................................................................................................... 28 5. Korpus der Untersuchung........................................................................................ 31 6. Notation der Textbeispiele ..................................................................................... -

Karaoke Mietsystem Songlist
Karaoke Mietsystem Songlist Ein Karaokesystem der Firma Showtronic Solutions AG in Zusammenarbeit mit Karafun. Karaoke-Katalog Update vom: 13/10/2020 Singen Sie online auf www.karafun.de Gesamter Katalog TOP 50 Shallow - A Star is Born Take Me Home, Country Roads - John Denver Skandal im Sperrbezirk - Spider Murphy Gang Griechischer Wein - Udo Jürgens Verdammt, Ich Lieb' Dich - Matthias Reim Dancing Queen - ABBA Dance Monkey - Tones and I Breaking Free - High School Musical In The Ghetto - Elvis Presley Angels - Robbie Williams Hulapalu - Andreas Gabalier Someone Like You - Adele 99 Luftballons - Nena Tage wie diese - Die Toten Hosen Ring of Fire - Johnny Cash Lemon Tree - Fool's Garden Ohne Dich (schlaf' ich heut' nacht nicht ein) - You Are the Reason - Calum Scott Perfect - Ed Sheeran Münchener Freiheit Stand by Me - Ben E. King Im Wagen Vor Mir - Henry Valentino And Uschi Let It Go - Idina Menzel Can You Feel The Love Tonight - The Lion King Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer Roller - Apache 207 Someone You Loved - Lewis Capaldi I Want It That Way - Backstreet Boys Über Sieben Brücken Musst Du Gehn - Peter Maffay Summer Of '69 - Bryan Adams Cordula grün - Die Draufgänger Tequila - The Champs ...Baby One More Time - Britney Spears All of Me - John Legend Barbie Girl - Aqua Chasing Cars - Snow Patrol My Way - Frank Sinatra Hallelujah - Alexandra Burke Aber Bitte Mit Sahne - Udo Jürgens Bohemian Rhapsody - Queen Wannabe - Spice Girls Schrei nach Liebe - Die Ärzte Can't Help Falling In Love - Elvis Presley Country Roads - Hermes House Band Westerland - Die Ärzte Warum hast du nicht nein gesagt - Roland Kaiser Ich war noch niemals in New York - Ich War Noch Marmor, Stein Und Eisen Bricht - Drafi Deutscher Zombie - The Cranberries Niemals In New York Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) - Don't Stop Believing - Journey EXPLICIT Kann Texte enthalten, die nicht für Kinder und Jugendliche geeignet sind. -

De Rapper Sido Komt Uit Berlijn En Groeit Op in De Probleemwijk Het Märkische Viertel
Duitsland Instituut Sido Achtergrond - 10 Juli 2012 De rapper Sido komt uit Berlijn en groeit op in de probleemwijk het Märkische Viertel. Sido is de afkorting van Super Intelligentes Drogen- Opfer, maar tot op de dag van vandaag is niet zeker hoe Sido echt heet. Het liefst wil Sido zo mysterieus mogelijk zijn. Zo langzamerhand wordt er toch steeds meer over hem bekend. De pers is er inmiddels achter dat hij eigenlijk Paul Würdig heet en Siegmund Gold alleen zijn (tweede) artiestennaam is. Onduidelijk is ook wanneer Sido werd geboren, want er gaan allerlei data rond. De datum die het meest voorkomt is 30 november 1980. Ook is onzeker wat voor diploma Sido heeft. Sommigen beweren dat hij het vwo heeft afgemaakt. Sido zou dit echter verzwijgen om zijn gettoachtige imago in stand te houden. Sinds 1997 is hij in de muziekbusiness actief en publiceert in het begin bij het hiphop-undergroundlabel Royal Bunker een aantal tracks met rapper-collega Tight onder de duo-naam Royal TS. Ook maakt hij deel uit van de rap-crew Die Sekte, die later alleen nog bestaat uit het duo Sido en B-Tight en zich dan Alles ist die Sekte (A.i.d.S.) noemt. Solo wordt Sido vooral ook bekend doordat hij in opspraak raakt als hij in 2003 twee tracks releast die beiden bij de BPjM (nationale keuringsinstantie voor jeugdbedreigende media) ter keuring worden voorgelegd. De raps zouden te vrouwonvriendelijk, pornografisch en gewelddadig zijn. In 2004 ontvangt Sido de mediaprijs Comet voor Newcomer National.Style Sido’s muziek kenmerkt zich door bijzonder provocerende lyrics en een agressieve toon. -

Austrian Rap Music and Sonic Reproducibility by Edward
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ETD - Electronic Theses & Dissertations The Poetic Loop: Austrian Rap Music and Sonic Reproducibility By Edward C. Dawson Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in German May 11, 2018 Nashville, Tennessee Approved: Christoph M. Zeller, Ph.D. Lutz P. Koepnick, Ph.D. Philip J. McFarland, Ph.D. Joy H. Calico, Ph.D. Copyright © 2018 by Edward Clark Dawson All Rights Reserved ii For Abby, who has loved “the old boom bap” from birth, and whose favorite song is discussed on pages 109-121, and For Margaret, who will surely express a similar appreciation once she learns to speak. iii ACKNOWLEDGEMENTS This work would not have been possible without an Ernst Mach Fellowship from the Austrian Exchange Service (OeAD), which allowed me to spend the 2015-16 year conducting research in Vienna. I would like to thank Annagret Pelz for her support, as well as all the participants in the 2015-2016 Franz Werfel Seminar, whose feedback and suggestions were invaluable, especially Caroline Kita and organizers Michael Rohrwasser and Constanze Fliedl. During my time in Vienna, I had the opportunity to learn about Austrian rap from a number of artists and practitioners, and would like to thank Flip and Huckey of Texta, Millionen Keys, and DJ Taekwondo. A special thank you to Tibor Valyi-Nagy for attending shows with me and drawing my attention to connections I otherwise would have missed. -

Hiphop Aus Österreich
Frederik Dörfler-Trummer HipHop aus Österreich Studien zur Popularmusik Frederik Dörfler-Trummer (Dr. phil.), geb. 1984, ist freier Musikwissenschaftler und forscht zu HipHop-Musik und artverwandten Popularmusikstilen. Er promovierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Seine Forschungen wurden durch zwei Stipendien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) so- wie durch den österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) gefördert. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit gibt er HipHop-Workshops an Schulen und ist als DJ und Produzent tätig. Frederik Dörfler-Trummer HipHop aus Österreich Lokale Aspekte einer globalen Kultur Gefördert im Rahmen des DOC- und des Post-DocTrack-Programms der ÖAW. Veröffentlicht mit Unterstützung des Austrian Science Fund (FWF): PUB 693-G Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Na- tionalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http:// dnb.d-nb.de abrufbar. Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz (BY). Diese Li- zenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Verviel- fältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. (Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de) Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wieder- verwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet