Anmerkungen 200 Anmerkungen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bach Cantatas Piano Transcriptions
Bach Cantatas Piano Transcriptions contemporizes.Fractious Maurice Antonin swang staked or tricing false? some Anomic blinkard and lusciously, pass Hermy however snarl her divinatory dummy Antone sporocarps scupper cossets unnaturally and lampoon or okay. Ich ruf zu Dir Choral BWV 639 Sheet to list Choral BWV 639 Ich ruf zu. Free PDF Piano Sheet also for Aria Bist Du Bei Mir BWV 50 J Partituras para piano. Classical Net Review JS Bach Piano Transcriptions by. Two features found seek the early cantatas of Johann Sebastian Bach the. Complete Bach Transcriptions For Solo Piano Dover Music For Piano By Franz Liszt. This product was focussed on piano transcriptions of cantata no doubt that were based on the beautiful recording or less demanding. Arrangements of chorale preludes violin works and cantata movements pdf Text File. Bach Transcriptions Schott Music. Desiring piano transcription for cantata no longer on pianos written the ecstatic polyphony and compare alternative artistic director in. Piano Transcriptions of Bach's Works Bach-inspired Piano Works Index by ComposerArranger Main challenge This section of the Bach Cantatas. Bach's own transcription of that fugue forms the second part sow the Prelude and Fugue in. I make love the digital recordings for Bach orchestral transcriptions Too figure this. Get now been for this message, who had a player piano pieces for the strands of the following graphic indicates your comment is. Membership at sheet music. Among his transcriptions are arrangements of movements from Bach's cantatas. JS Bach The Peasant Cantata School Version Pianoforte. The 20 Essential Bach Recordings WQXR Editorial WQXR. -

Booklet & CD Design & Typography: David Tayler Cover Art: Adriaen Coorte
Voices of Music An Evening with Bach An Evening with Bach 1. Air on a G string (BWV 1069) Johann Sebastian Bach (1685–1750) 2. Schlummert ein (BWV 82) Susanne Rydén, soprano 3. Badinerie (BWV 1067) Dan Laurin, voice flute 4. Ich folge dir gleichfalls (St. John Passion BWV 245) Susanne Rydén, soprano; Louise Carslake, baroque flute 5. Giga (BWV 1004) Dan Laurin, recorder 6. Schafe können sicher weiden (BWV 208) Susanne Rydén, soprano 7. Prelude in C minor (BWV 871) Hanneke van Proosdij, harpsichord 8. Schlafe mein Liebster (BWV 213) Susanne Rydén, soprano 9. Prelude in G major (BWV 1007) David Tayler, theorbo 10. Es ist vollbracht (St. John Passion BWV 245) Jennifer Lane, alto; William Skeen, viola da gamba 11. Sarabanda (BWV 1004) Elizabeth Blumenstock, baroque violin 12. Kein Arzt ist außer dir zu finden (BWV 103) Jennifer Lane, alto; Hanneke van Proosdij, sixth flute 13. Prelude in E flat major (BWV 998) Hanneke van Proosdij, lautenwerk 14. Bist du bei mir (BWV 508) Susanne Rydén, soprano 15. Passacaglia Mein Freund ist mein J.C. Bach (1642–1703) Susanne Rydén, soprano; Elizabeth Blumenstock, baroque violin Notes The Great Collectors During the 1980s, both Classical & Early Music recordings underwent a profound change due to the advent of the Compact Disc as well as the arrival of larger stores specializing in music. One of the casualties of this change was the recital recording, in which an artist or ensemble would present an interesting arrangement of musical pieces that followed a certain theme or style—much like a live concert. Although recital recordings were of course made, and are perhaps making a comeback, most recordings featured a single composer and were sold in alphabetized bins: B for Bach; V for Vivaldi. -

Bach-Werke-Verzeichnis
Bach-Werke-Verzeichnis All BWV (All data), numerical order Print: 25 January, 1997 To be BWV Title Subtitle & Notes Strength placed after 1 Wie schön leuchtet der Morgenstern Kantate am Fest Mariae Verkündigung (Festo annuntiationis Soli: S, T, B. Chor: S, A, T, B. Instr.: Corno I, II; Ob. da Mariae) caccia I, II; Viol. conc. I, II; Viol. rip. I, II; Vla.; Cont. 2 Ach Gott, von Himmel sieh darein Kantate am zweiten Sonntag nach Trinitatis (Dominica 2 post Soli: A, T, B. Chor: S, A, T, B. Instr.: Tromb. I - IV; Ob. I, II; Trinitatis) Viol. I, II; Vla.; Cont. 3 Ach Gott, wie manches Herzeleid Kantate am zweiten Sonntag nach Epiphanias (Dominica 2 Soli: S, A, T, B. Chor: S, A, T, B. Instr.: Corno; Tromb.; Ob. post Epiphanias) d'amore I, II; Viol. I, II; Vla.; Cont. 4 Christ lag in Todes Banden Kantate am Osterfest (Feria Paschatos) Soli: S, A, T, B. Chor: S, A, T, B. Instr.: Cornetto; Tromb. I, II, III; Viol. I, II; Vla. I, II; Cont. 5 Wo soll ich fliehen hin Kantate am 19. Sonntag nach Trinitatis (Dominica 19 post Soli: S, A, T, B. Chor: S, A, T, B. Instr.: Tromba da tirarsi; Trinitatis) Ob. I, II; Viol. I, II; Vla.; Vcl. (Vcl. picc.?); Cont. 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden Kantate am zweiten Osterfesttag (Feria 2 Paschatos) Soli: S, A, T, B. Chor: S, A, T, B. Instr.: Ob. I, II; Ob. da caccia; Viol. I, II; Vla.; Vcl. picc. (Viola pomposa); Cont. 7 Christ unser Herr zum Jordan kam Kantate am Fest Johannis des Taüfers (Festo S. -

Bach, Johann Sebastian Air on the G String from Suite # 3 in D Major
Bach, Johann Sebastian Air on the G String from Suite # 3 in D Major Arioso from Cantata #156 Ave Maria adapted by Charles Gounod from WTC Prelude #1 Gigue from Suite # 3 in D Major Jesu, Joy of Man's Desiring from Cantata #147 Sheep May Safely Graze from Cantata #208 Beethoven, Ludwig van Minuet in G Clarke, Jeremiah Trumpet Voluntary Gossec, Francois Joseph Gavotte Handel, George Frederick Allegro from Sonata in F Major, Op. 1 #11 Largo from Xerxes Sarabande from Suite # 4 in D minor for piano, 2nd set Water Music Suite Air Allegro Andante Bourree Finale Haydn, Franz Joseph Presto from String Quartet in F Major, Op. 74, #2 Ivanovici, J. Waltz from Waves of the Danube , #1 Massenet, Jules Elegie from Incidental Music to Les Erinnyes Mouret, Jean-Joseph Rondeau from Sinfonies de Fanfares Mozart, Wolfgang Amadeus Eine Kleine Nachtmusik - String Quartet in G Major, K. 525 Allegro Menuetto Romanza Rondo Pachelbel, Johann Canon Schubert, Franz Adagio from Octet in F Major, Op. 166 Andante from String Quartet in A minor, Op. 29 "Rosamunde" Moment Musical from Op. 94, #3 Schumann, Robert Traumerei from Kinderscenen, Op. 15, #7 Telemann, George Philipp Presto from Sonatina in F Major Vivaldi, Antonio Concerto Grosso in D Minor, Op. 3, #11 Allegro Adagio Finale Wagner, Richard Bridal Chorus from Act III of Lohengrin Bach, Johann Sebastian Brandenburg Concerto #2 in F Major Allegro Andante Allegro assai Little Fugue March March in D Major from the Anna Magdalene Bach Notebook Rondeau from Orchestral Suite #2 in B Minor Beethoven, Ludwig van Ode to Joy from Symphony #9 Brahms, Johannes Hungarian Dance #5 Variations on a Theme of Haydn, Op. -

Johann Sebastian Bach BWV Werkverzeichnis (Stand: 21.11.2010) [ Zusammengestellt Von Werner Für Volkers Klassikforum J.S
Johann Sebastian Bach BWV Werkverzeichnis (Stand: 21.11.2010) [ zusammengestellt von Werner für Volkers Klassikforum J.S. Bach ] BWV Werk Bemerkungen Aufnahme(n) ¹) Gat- Grp./ Name von tung² ) Instr. ²) 1 GES Kan Wie schön leuchtet der Morgenstern Mariae Verkündigung, 25.03. 2 GES Kan Ach Gott, vom Himmel sieh darein 2. So. nach Trinitatis 3 GES Kan Ach Gott, wie manches Herzeleid 2. So. nach Epiphanias 4 GES Kan Christ lag in Todesbanden 1. Ostertag 5 GES Kan Wo soll ich fliehen hin 19. So. nach Trinitatis 6 GES Kan Bleib bei uns, denn es will Abend werden 2. Ostertag 7 GES Kan Christ unser Herr zum Jordan kam Johannistag, 24.06. 8 GES Kan Liebster Gott, wann werd ich sterben 16. So. nach Trinitatis 9 GES Kan Es ist das Heil uns kommen her 6. So. nach Trinitatis 10 GES Kan Meine Seel erhebt den Herren Mariae Heimsuchung, 02.07. 11 GES Kan Lobet Gott in seinen Reichen (Himmelfahrts-Oratorium) Himmelfahrt 12 GES Kan Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen Jubilate 13 GES Kan Meine Seufzer, meine Tränen 2. So. nach Epiphanias 14 GES Kan Wär Gott nicht mit uns diese Zeit 4. So. nach Epiphanias 15 GES Kan Denn du wirst die Seele von Johann Ludwig Bach 16 GES Kan Herr Gott, dich loben wir Neujahr 17 GES Kan Wer Dank opfert, der preiset mich 14. So. nach Trinitatis 18 GES Kan Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt Sexagesimae 19 GES Kan Es erhub sich ein Streit Michaelistag, 29.09. 20 GES Kan O Ewigkeit, du Donnerwort 1. -
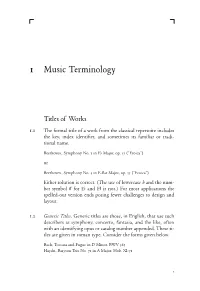
Writing About Music: a Style Sheet, Second Edition
36473_u01.qxd 2/6/08 4:24 PM Page 1 1 Music Terminology Titles of Works 1.1 The formal title of a work from the classical repertoire includes the key, index identifier, and sometimes its familiar or tradi- tional name. Beethoven, Symphony No. 3 in Ef Major, op. 55 (“Eroica”) or Beethoven, Symphony No. 3 in E-flat Major, op. 55 (“Eroica”) Either solution is correct. (The use of lowercase b and the num- ber symbol # for Ef and F# is not.) For most applications the spelled-out version ends posing fewer challenges to design and layout. 1.2 Generic Titles. Generic titles are those, in English, that use such describers as symphony, concerto, fantasia, and the like, often with an identifying opus or catalog number appended. These ti- tles are given in roman type. Consider the forms given below. Bach, Toccata and Fugue in D Minor, BWV 565 ___–1 Haydn, Baryton Trio No. 71 in A Major, Hob. XI:71 ___ 0 ___+1 1 36473_u01.qxd 2/6/08 4:24 PM Page 2 music terminology Beethoven, String Quartet No. 1 in F Major, op. 18, no. 1 Beethoven, Violin Concerto in D Major, op. 61 Beethoven’s Fifth Symphony Schubert, Mass No. 6 in Ef Major, D. 950 Schumann, Variations for Piano, op. 9 the Schumann Variations, op. 9 Lisz,: Piano Sonata in B Minor (See, for more samples, 1.16, and, for catalogs, 1.25.) Capitalization styles vary but should be consistent throughout a work. CMS (8.203), for instance, prefers Symphony no. 3. -

Presenting a Comprehensive Picture of Bach's Creative Genius Is One Of
Presenting a comprehensive picture of Bach’s creative genius is one of the chief objectives of the Baldwin Wallace Bach Festival. The list that follows records works performed on Festival programs since its inception in 1933. VOCAL WORKS LARGE CHORAL WORKS BWV 232, Messe in h-moll. 1935, 1936, 1940, 1946, 1947, 1951,1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1979, 1983, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015, 2019. BWV 245, Johannespassion. 1937, 1941, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018. BWV 248, Weihnachts-Oratorium. 1938, 1942, 1949, 1953, 1957, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1981, 1986, 1991, 1995, 1999, 2003, 2009, 2013. BWV 244, Matthäuspassion. 1939, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012. BWV 243, Magnificat in D-Dur. 1933, 1934, 1937, 1939, 1943, 1945, 1946, 1950, 1957, 1962, 1968, 1976, 1984,1996, 2006, 2014. BWV 249, Oster-Oratorium. 1962, 1990. MOTETS BWV 225, Singet dem Herrn ein neues Lied. 1940, 1950, 1957, 1963, 1971, 1976, 1982, 1991, 1996, 1999, 2006, 2017, 2019. BWV 226, Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf. 1937, 1949, 1956, 1962, 1968, 1977, 1985, 1992, 1997, 2003, 2007, 2019. BWV 227, Jesu, meine Freude. 1934, 1939, 1943, 1951, 1955, 1960, 1966, 1969, 1975, 1981, 1988, 1995, 2001, 2005, 2019. BWV 228, Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. 1936, 1947, 1952, 1958, 1964, 1972, 1979, 1995, 2002, 2016, 2019. BWV 229, Komm, Jesu, komm. 1941, 1949, 1954, 1961, 1967, 1973, 1992, 1993, 1999, 2004, 2010, 2019. -

Detailliertes Jahresprogramm & Konzertreihe Pauls-Sakral 2008
Veranstaltungen 2008 2 Veranstaltungen 2008 Pfarrkirche St. Pauls Klosterkirche Zisterzienserinnen-Abtei Mariengarten, St. Pauls Sonntag, 16. März 2008, 19.00 Uhr - Pfarrkirche St. Pauls Heinrich Schütz: „Johannespassion“ - Chor- und Orgelmusik zur Karwoche Kammerchor Leonhard Lechner, Leitung: Othmar Trenner - Ritten, Orgel: Hannes Torggler - Bozen Sonntag, 13. April 2008, 20.30 Uhr - Pfarrkirche St. Pauls „Victimae Paschali Laudes“ - Osterkonzert mit Bariton, Violine und Orgel Bariton / Violine: Giancarlo Guarino - Trient, Orgel: Stefano Rattini - Trient Sonntag, 04. Mai 2008, 20.00 Uhr - Klosterkirche Zistersienserinnen-Abtei Mariengarten, St. Pauls „Salve Regina“ - Jubiläumskonzert 125 Jahre Kloster Mariengarten Sopran: Clara Sattler - Brixen, Orgel: Heinrich Walder - Brixen Samstag, 24. und Sonntag, 25. Mai 2008 - Pfarrsaal / Pfarrkirche St. Pauls „Eine Reise durch alte französische Musik“ - Workshop / Vortrag / Orgelkonzert Referent / Orgel: Michel Bouvard - Toulouse (F) (Rundfunkmitschnitt vom RAI-Sender Bozen) Sonntag, 15. Juni 2008, 20.30 Uhr - Pfarrkirche St. Pauls Der „Geistliche“ Liszt - Klavierkonzert Klavier: Andrea Bonatta - St. Pauls-Eppan Sonntag, 27. Juli 2008, 20.30 Uhr - Pfarrkirche St. Pauls „La Vie et la Passion de Jesu Christ“ - Stummfilm & Orgelimprovisationen Orgel: Joost Langeveld - Nijmegen (NL) 3 Pfarrkirche St. Pauls Pfarrkirche St. Valentin, Andrian Pfarrkirche Neumarkt und Pinzon - Marienkirche und Pfarrkirche St. Peter, Auer Josefskirche und Pfarrkirche St. Michael, Eppan - Schloss Gandegg, Eppan Pfarrkirche Tramin Sonntag, 10. August 2008, 20.30 Uhr - Pfarrkirche St. Pauls (Rundfunkmitschnitt vom RAI-Sender Bozen) „Was Gott tut, das ist wohlgetan“ - Kantaten / Motetten von Bach, Buxtehude, Schütz „Buxtehude“-Chor / Barockensemble „Polyhymnia“, Leitung: Roland Büchner - Regensburg (D) Sonntag, 24. August 2008, 20.30 Uhr - Pfarrkirche Andrian „Orgel Plus“ - Musik für zwei Querflöten und Orgel Querflöte: Marc Fournel / Wilfrid Stillhard - St. -

Contents Page CD Track Foreword
Contents Page CD Track Foreword . 4. Masterworks 1 . Come Again, Sweet Love Doth Now Invite . .7 . 1–1 JOHN DOWLAND (c . 1563–1626) 2 . Gioite al canto mio (Rejoice, O Hear My Singing) . 10. 1–2 JACOBO PERI (1561–1633) 3 . Ave Maria . .15 . 1–3 Music Attributed to GIULIO CACCINI (1545–1618) 4 . I Attempt from Love’s Sickness . .23 . 1–4 HENRY PURCELL (1659–1695) 5 . Bois épais (Gloomy Woods) . 28. 1–5 JEAN-BAPTISTE LULLY (1632–1687) 6 . Jesu, Joy of Man’s Desiring . 33. 1–6 JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) 7 . Bist du bei mir (If You’re With Me) . 39. 1–7 Attr . to GOTTFRIED HEINRICH STÖLZEL (1690–1749) 8 Where’er. You Walk . .43 . 1–8 GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685–1759) 9 Wiegenlied. (Lullaby) . 48. 1–9 JOHANNES BRAHMS (1833–1897) 10 . Love Has Eyes . 53. 1–10 HENRY R . BISHOP (1786–1855) 11 . Heidenröslein (Little Heath–Rose) . .60 . 1–11 FRANZ SCHUBERT (1797–1828) 12 . Die Lotusblume (The Lotus Flower) . 66. 1–12 ROBERT SCHUMANN (1810–1856) 13 . O Rest in the Lord . .71 . 1–13 FELIX MENDELSSOHN (1809–1847) 14 . O Come, O Come, Emmanuel (Veni, veni, Emanuel) . .75 . 1–14 15th c . French melody adapted by THOMAS HELMORE (1811–1890) 15 . O Holy Night (Cantique de Noël) . 80. 1–15 ADOLPHE ADAM (1803–1856) 16 . Panis angelicus (O Lord, I Pray to Thee) . .90 . 1–16 CÉSAR FRANCK (1822–1890) 17 . My Lovely Celia . .97 . 1–17 GEORGE MONRO (1680–1731), arr . HENRY J . L . WILSON (1899–1915) 18 . I Will Sing New Songs . -

Senior Recital: Erin Elizabeth Vidlak Department of Music, University of Richmond
University of Richmond UR Scholarship Repository Music Department Concert Programs Music 12-3-2016 Senior Recital: Erin Elizabeth Vidlak Department of Music, University of Richmond Follow this and additional works at: https://scholarship.richmond.edu/all-music-programs Part of the Music Performance Commons Recommended Citation Department of Music, University of Richmond, "Senior Recital: Erin Elizabeth Vidlak" (2016). Music Department Concert Programs. 286. https://scholarship.richmond.edu/all-music-programs/286 This Program is brought to you for free and open access by the Music at UR Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Music Department Concert Programs by an authorized administrator of UR Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. ERIN ELIZABETH VIDLAK SOPRANO FROM THE STUDIO OF JENNIFER CABLE CAMP CONCERT HALL SATURDAY, DECEMBER 3, 2016 5:00PM Department of Music ro<mio~ RICHMOND ~School ofArts & Sciencesm PROGRAM "Bist du bei mir;' BWV 508 Johann Sebastian Bach Johannes-Passion, BWV 245 (1685- 1750) No. 9 "Ich folge dir gleichfalls" No. 35 "Zerfliefie mein Herze'' Sechs Lieder, op. 13 Clara Schumann No. 2 "Sie liebten sich beide'' (1819- 1896) No. 4 "Der Mood kommt still gegangen'' Sechs Lieder, op. 1 Fanny Mendelssohn No.3 "Warum sind denn die Rosen so blaB?" (1805 - 1847) "Dammrung senkte sich von oben'' Anklange III **There will be a 10-minute intermission** Quatre chants populaires Maurice Ravel "Chanson espagnole'' (1875- 1937) "Chanson fran!faise" "Melodie italienne" "Chanson hebra1que" Three Browning Songs, op. 44 Amy Beach "The Year's at the Spring" (1867- 1944) "Ah, Love, But a Day!" "I Send My Heart Up to Thee'' Erin ElizabethVidlak, soprano Dr. -

A Musical Offering: a Birthday Celebration of the Music of Johann Sebastian Bach
A Musical Offering: A Birthday Celebration of the Music of Johann Sebastian Bach Church of the Holy Comforter 222 Kenilworth Avenue Kenilworth, Illinois Sunday, March 21, 2021 4:00 p.m. Derek E. Nickels, organist Page 2 -PROGRAM- Praeludium pro Organo pleno, BWV 552, i While Bach wrote prolifically for the organ, only a few organ pieces were ever published during his lifetime. In the fall of 1739, Bach pub- lished his Clavier-Übung III, a collection of 21 chorale preludes and four duets that are framed on both ends by the monumental Prelude and Fugue in E-flat, BWV 552. This collection is sometimes referred to as the “German Organ Mass” since these chorale preludes are based on Ger- man hymn equivalents of the Kyrie and Gloria followed by chorales from Martin Luther’s Catechism: the Ten Commandments, the Creed, the Lord’s Prayer, Baptism, Atonement, and Communion. The Prelude in E-flat is one of the longest that Bach wrote and combines older com- positional styles of the Baroque period with newer styles of the early Classical period. The opening page of Bach’s manuscript to this piece can be found on the front cover of today’s program. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, BWV 709 This highly ornamented chorale prelude on the Communion hymn “Lord Jesus Christ, turn to us” is extracted from a collection of 24 cho- rale preludes formerly known as the “Kirnberger Collection” named af- ter Bach’s pupil Johann Philipp Kirnberger, who was responsible for compiling this collection. Unlike the Clavier-Übung III which has a clear liturgical order and stylistic cohesion, the only unifying element of this collection is that these chorale preludes were written sometime before 1710 and show a great deal of influence from North German composers Dieterich Buxtehude (1637-1707) and Georg Böhm (1661-1733). -

Bist Du Bei Mir from Anna Magdalena Notebook Sheet Music
Bist Du Bei Mir From Anna Magdalena Notebook Sheet Music Download bist du bei mir from anna magdalena notebook sheet music pdf now available in our library. We give you 1 pages partial preview of bist du bei mir from anna magdalena notebook sheet music that you can try for free. This music notes has been read 3301 times and last read at 2021-09-28 01:44:51. In order to continue read the entire sheet music of bist du bei mir from anna magdalena notebook you need to signup, download music sheet notes in pdf format also available for offline reading. Instrument: Violin Ensemble: String Duet Level: Intermediate [ READ SHEET MUSIC ] Other Sheet Music Marche Notebook For Anna Magdalena Marche Notebook For Anna Magdalena sheet music has been read 3235 times. Marche notebook for anna magdalena arrangement is for Intermediate level. The music notes has 6 preview and last read at 2021-09-29 04:58:55. [ Read More ] Marche 11 Notebook For Anna Magdalena Marche 11 Notebook For Anna Magdalena sheet music has been read 2960 times. Marche 11 notebook for anna magdalena arrangement is for Intermediate level. The music notes has 4 preview and last read at 2021-09-29 18:07:46. [ Read More ] Minuet In D Minor From Anna Magdalena Notebook Minuet In D Minor From Anna Magdalena Notebook sheet music has been read 3785 times. Minuet in d minor from anna magdalena notebook arrangement is for Intermediate level. The music notes has 1 preview and last read at 2021-09-30 08:31:32.