Karl-Ulrich Gelberg, Die Protokolle Des
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The United States and German Demilitarization, 1942- 1947
FROM ENMITY TOWARDS ALLIANCE: THE UNITED STATES AND GERMAN DEMILITARIZATION, 1942- 1947 Oliver Haller B.A., Wilfrid Laurier University, 199 1 M.A. Thesis Submitted to the Department of History in partial fulfilment of the requirements for the Master of Arts Degree Wilfrid MerUniversity 1996 @ Oliver Haller 1996 National Library Bibliothèque nationale du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Seivices seMces bibliographiques 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON KIA ON4 canada Canada YovrW voarrréfefmce Our Ne NonerrlHhena, The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, districbute or sell reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in microforni, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/fïh, de reproduction sur papier ou sur fomat électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in this thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts from it Ni la thése ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorkation. Table of Contents Abstract ............................................... iii Introduction........................................... I Notes: Introduction .................................... 13 Chapter One: The Versailles Precedent and Initial Arnerican Perceptions of Civil-Military Government...... 18 Notes: Chapter One ..................................... 40 Chapter Two: The Formulation of an Amencan Civil-Military Direcive and the Ascendendcy of Demilitarimion through Deindustrialization....... -

Witness to History
WITNESS TO HISTORY A book by Michael Walsh This book will not break your heart, it will crush your heart in sorrow and compassion for all mankind. This one book, ABOVE ALL OTHERS I've read, puts together information using statements from historical figures in a way that, I believe, will erase doubts from any doubting Thomas that one of the biggest lies -- or mass of massive lies -- we've ever been told involve WWII, German National Socialism; its Chancellor, Adolf Hitler; and in fact WHO made that war happen. As I was reading this book to the listeners of our Sweet Liberty radio broadcast, we discovered the REAL hot-button. I received a phone call from WWCR questioning my 'motives' for presenting this information. THAT was a first, and reinforced my desire to share the information with as many as will listen/read/hear/see through the biggest lie. I continued to read until finally it became nearly impossible for listeners to hear the broadcast on a once-crystal clear frequency; on two occasions we were actually knocked off the air-waves. When the subject matter changed, the reception cleared up. From this I've realized that the lie must be maintained at all costs; we MUST hate Adolf Hitler with all the venom a serpent can muster or the perpetrators of the lie begin frothing at the mouth. Although the material presented on the broadcast is always controversial, and although the quality of our short-wave reception seems to be manipulated depending upon the topic at hand, this one subject is taboo, period. -

Landauer-POC.Pdf
Prophet of Community Gustav Landauer (1870-1919) Prophet of Community The Romantic Socialism of Gustav Landauer by EUGENE LUNN UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS BERKELEY LOS ANGELES LONDON I973 University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California Press, Ltd. London, England Copyright © 1973 by The Regents of the University of California ISBN : 0-520-02207-6 Library of Congress Catalog Card Number: 70-186105 Designed by Dave Pauly Printed in the United States of America Acknowledgments I should like to acknowledge the help I have received in the preparation of this book. I owe a debt to the excellent staff of the International Institute of Social History, Am sterdam, especially to Mr. Rudolf de Jong, for assistance in locating materials and for permission to read the manu scripts contained in the Landauer Archives. I would also like to thank Professor Gerald Feldman of the University of California, Berkeley, for the thoughtful advice he offered while this study was in thesis form. At a later stage my work benefited from readings by Professors Robert A. Kann of Rutgers University and Peter Loewenberg of the Univer sity of California, Los Angeles. It it a particular pleasure to acknowledge the invaluable guidance I have received from Professor Carl E. Schorske, teacher and friend, currently of the History Department at Princeton University, whose searching and thorough critique of my work included nu merous helpful suggestions, especially with regard to ques tions of method. Finally, my wife Myra provided the moral support that again and again renewed the energies needed to complete, and twice revise, the manuscript. -
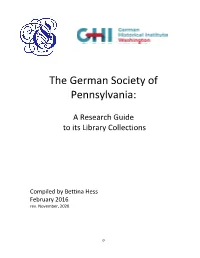
Research Guide to Its Library Collections
& The German Society of Pennsylvania: A Research Guide to its Library Collections Compiled by Bettina Hess February 2016 rev. November, 2020 0 Introduction p. 2 History and Brief Overview of the Collections p. 2 Books Main Collection p. 5 German American Collection p. 9 Carl Schurz Collection p. 30 Reference Collection p. 30 Pamphlets Main Collection p. 31 German American Collection p. 31 cataloged p. 31 uncataloged legal size boxes with call numbers p. 40 legal size boxes without call numbers p. 52 Carl Schurz Collection pamphlet box lists p. 54 Ephemera German American Collection Letter size boxes with call numbers p. 148 Letter size boxes without call numbers p. 163 Legal size boxes without call numbers p. 176 Manuscripts Mss. I Collections with finding aids p. 179 Collections with catalog entries p. 199 collections by size with inventories: Mss. IIa -- Letter size boxes p. 202 Mss. IIb -- Legal size boxes p. 207 Mss. III -- flat boxes (12 x 16 “) p. 210 Mss. IV -- flat boxes (14 x 18 “) p. 215 Mss. Oversize (20 x 24”) p. 219 Mss. Oversize Gallery (24 x 36”) p. 224 Minimally processed manuscript collections p. 228 Newspapers/Periodicals Newspapers on microfilm p. 292 German American imprints -- bound volumes p. 296 German imprints -- bound volumes p. 313 1 Introduction This research guide to the German Society of Pennsylvania’s Joseph Horner Memorial Library is an update to the original guide written by Kevin Ostoyich in 2006 (The German Society of Pennsylvania: A Guide to its Book and Manuscript Collections) and published by the German Historical Institute. -

Dn1929 1945–1950
DN1929 RECORDS OF THE PROPERTY CONTROL BRANCH OF THE U.S. ALLIED COMMISSION FOR AUSTRIA (USACA) SECTION, 1945–1950 Danielle DuBois and Kylene Tucker prepared this introduction and, along with M’Lisa Whitney, supervised the arrangement of these records for digitization. National Archives and Records Administration Washington, DC 2010 United States. National Archives and Records Administration. Records of the Property Control Branch of the U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950.— Washington, D.C. : National Archives and Records Administration, 2010. p. ; cm.– (National Archives digital publications. Pamphlet describing ; DN 1929) Cover title. ―Danielle DuBois and Kylene Tucker prepared this introduction and, along with M’Lisa Whitney, supervised the arrangement of these records for digitization‖ – Cover. ―These records are part of Records of United States Occupation Headquarters, World War II, Record Group (RG) 260‖ – P. 1. 1. Allied Commission for Austria. U.S. Element. Reparations, Deliveries, and Restitutions Division. Property Control Branch – Records and correspondence – Catalogs. 2. Austria -- History – Allied occupation, 1945–1955 – Sources – Bibliography – Catalogs. I. DuBois, Danielle. II. Tucker, Kylene. III. Whitney, M’Lisa. IV. Title. INTRODUCTION On the 413 disks of this digital publication, DN1929, are reproduced cases and reports, claims processed by, and general records of the Property Control Branch of the U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section, 1945–1950. These records are part of Records of United States Occupation Headquarters, World War II, Record Group (RG) 260. BACKGROUND The U.S. Allied Commission for Austria (USACA) Section was responsible for civil affairs and military government administration in the American section (U.S. -

Classified List of OTS Printed Reports, October, 1947
PB 81500 DEPARTMENT OF COMMERCE W. Averell Harriman, Secretary CLASSIFIED LIST OF OTS PRINTED REPORTS A List of Reports on German and Japanese Technology Prepared by American Investigators Which Are Available in Printed Form From the Office of Technical Services Property of Technical Reports Section SCIENCE AND TECHNOLOGY DIVISION Library of Congress OFFICE OF TECHNICAL SERVICES John C. Green, Director OFFICE OF TECHNICAL SERVICES CLASSIFIED LIST OF OTS PRINTED REPORTS Compiled by 0. Willard Holloway and Oliver B. Isaac Reports Division October 1947 (i) INTRODUCTION This classified list catalogs about 1,800 reports on German technology prepared by American investigators who have searched German firms and laboratories over the past two years for Information of value to American business and industry, unlike most OTS reports, which are available only In photostat or microfilm, the reports listed here are available in mimeograph, multlllth, or other printed form, included are the bulk of the reports received from the u. S. Army's Field information Agency, Technical, the Combined intelligence Objectives Agency, and the joint intelligence Objectives Agency. The list refers the reader to the page number of the Bibliography of Scientific and Industrial Reports where abstracts of reports are found. For convenience this publication is arranged In three parts: PART I Classified list of reports giving author, title, date, pages, price, PB number, volume, and page reference to the Bibliography of Scientific and industrial Reports* where an abstract of the report may be found. PART II Series list naming the series Included with reference to the PB number. PART III An index from PB number to the page number in the publication where the complete entry may be found. -

Lionel Gossman Brownshirt Princess a Study of the “Nazi Conscience” to Access Digital Resources Including: Blog Posts Videos Online Appendices
Lionel Gossman Brownshirt Princess A Study of the “Nazi Conscience” To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/18 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. BROWNSHIRT PRINCESS Lionel Gossman is M. Taylor Pyne Professor of Romance Languages emeri- tus at Princeton University. Most of his work has been on 17th and 18th century French literature, 19th century European cultural history, and the theory and practice of historiography. His publications include Men and Masks: A Study of Molière; Medievalism and the Ideologies of the Enlightenment; French Society and Culture: Background for 18th Century Literature; The Em- pire Unpossess’d: An Essay on Gibbon’s “Decline and Fall”; Between History and Literature; Basel in the Age of Burckhardt: A Study in Unseasonable Ideas; The Making of a Romantic Icon: The Religious Context of Friedrich Overbeck’s “Ita- lia und Germania”; and several edited volumes: The Charles Sanders Peirce Symposium on Semiotics and the Arts; Building a Profession: Autobiographical Perspectives on the Beginnings of Comparative Literature in the United States (with Mihai Spariosu); Geneva-Zurich-Basel: History, Culture, and National Identity, and Begegnungen mit Jacob Burckhardt (with Andreas Cesana). He is currently working on a study of the Jugendstil artist Heinrich Vogeler. 1. Heinrich Vogeler. Frontispiece for Marie Adelheid Reuß, Prinzessin zur Lippe, Gott in mir(1921). Lionel Gossman Brownshirt Princess A Study of the “Nazi Conscience” Cambridge 2009 40 Devonshire Road, Cambridge, CB1 2BL, United Kingdom http://www.openbookpublishers.com @ 2009 Lionel Gossman Some rights are reserved. -

Cantonal Hospital Zurich State Technical School Mannheim Competition Entries
1933/34 CANTONAL HOSPITAL ZURICH STATE TECHNICAL SCHOOL MANNHEIM COMPETITION ENTRIES Cantonal hospital Zurich, 1933/34 The ideas competition for a new cantonal hospital in Zurich was put out to tender in 1933 among Swiss architects. The architects' offices Steger in Zurich employed Pius Pahl to take part in the design for their entry. Pius Pahl did all the drawings. The project was placed 6th. From the Jury protocol: "The project is an independent solution for the greater hospital complex. The centralization of administration and all poly-clinics in a 470m long and approximately 50 m wide saw-tooth roofed building with rectangular treatment tracts connected and the four in- patient high rise buildings receiving maximum light because of their oblique position. This organisational arrangement emphasizes the importance of the poly-clinics within the entire complex. It is a setting that creates strongly centralized operational possibilities [...] The forecourts, main entrance portal with porter's lodge and traffic flow are well designed. The administration and reception offices are well structured. The general administrative areas and neatly arranged reception and counter halls are appropriately connected. The inner connections to the in-patient areas run smoothly. The connecting corridors are perfectly fitting, short and directly lit [...]." State Technical School Mannheim, 1933 Pius Pahl had successfully concluded his Bauhaus training, when he, together with Bauhaus graduate Max Enderlin, participated in the competition for a State Technical College in Mannheim. The design features a clear compact structure of the entire complex and functional individual ground plan solutions. Architectural design elements are referred to as elements of a new style of building.