Hymenoptera, Symphyta: Argidae Und Cimbicidae)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Alien and Invasive Species of Harmful Insects in Bosnia and Herzegovina
Alien and invasive species of harmful insects in Bosnia and Herzegovina Mirza Dautbašić1,*, Osman Mujezinović1 1 Faculty of Forestry University in Sarajevo, Chair of Forest Protection, Urban Greenery and Wildlife and Hunting. Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo * Corresponding author: [email protected] Abstract: An alien species – animal, plant or micro-organism – is one that has been introduced as a result of human activity to an area it could not have reached on its own. In cases where the foreign species expands in its new habitat, causing environmental and economic damage, then it is classified as invasive. The maturity of foreign species in the new area may also be influenced by climate changes. The detrimental effect of alien species is reflected in the reduction of biodiversity as well as plant vitality. A large number of alien species of insects are not harmful to plants in new habitats, but there are also those that cause catastrophic consequences to a significant extent. The aim of this paper is to present an overview of newly discovered species of insects in Bosnia and Herzegovina. The research area, for this work included forest and urban ecosystems in the territory of Bosnia and Herzegovina. For the purposes of this paper, an overview of the species found is provided: /HSWRJORVVXVRFFLGHQWDOLV Heidemann; (Hemiptera: Coreidae) - The western conifer seed bug, found at two sites in Central Bosnia, in 2013 and 2015; $UJHEHUEHULGLVSchrank; (Hymenoptera: Argidae) - The berberis sawfly, recorded in one locality (Central Bosnia), in 2015; -

Prioritising the Management of Invasive Non-Native Species
PRIORITISING THE MANAGEMENT OF INVASIVE NON-NATIVE SPECIES Olaf Booy Thesis submitted to the School of Natural and Environmental Sciences in fulfilment for the requirements of the degree of Doctor of Philosophy Newcastle University October 2019 Abstract Invasive non-native species (INNS) are a global threat to economies and biodiversity. With large numbers of species and limited resources, their management must be carefully prioritised; yet agreed methods to support prioritisation are lacking. Here, methods to support prioritisation based on species impacts, pathways of introduction and management feasibility were developed and tested. Results provide, for the first time, a comprehensive list of INNS in Great Britain (GB) based on the severity of their biodiversity impacts. This revealed that established vertebrates, aquatic species and non-European species caused greater impacts than other groups. These high impact groups increased as a proportion of all non-native species over time; yet overall the proportion of INNS in GB decreased. This was likely the result of lag in the detection of impact, suggesting that GB is suffering from invasion debt. Testing methods for ranking the importance of introduction pathways showed that methods incorporating impact, uncertainty and temporal trend performed better than methods based on counts of all species. Eradicating new and emerging species is one of the most effective management responses; however, practical methods to prioritise species based both on their risk and the feasibility of their eradication are lacking. A novel risk management method was developed and applied in GB and the EU to identify not only priority species for eradication and contingency planning, but also prevention and long term management. -
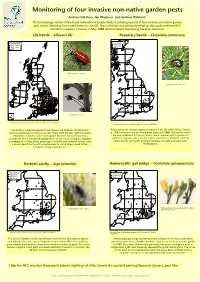
Monitoring of Four Invasive Non-Native Garden Pests
Monitoring of four invasive non-native garden pests Andrew Salisbury, Ian Waghorn and Andrew Halstead The Entomology section of the Royal Horticultural Society (RHS) is collating records of four invasive non-native garden pest insects following their establishment in the UK. Data collection has previously relied on data gathered from RHS members’ enquiries, however in May 2008 internet- based monitoring has been launched. Lily beetle – Lilioceris lilii Rosemary beetle – Chrysolina americana First reported Firs t rec orded 1994-1999 1939-1989 2000-2004 1990-1999 2005- 2000+ Adult lily beetle (Photo R. Key) Rosemary beetle adult (RHS) Lily beetle larvae (RHS) Distribution of the Lily beetle in Britain and Ireland (December 2007). Produced using DMAP© Distribution of Rosemary beetle in Britain. (January 2008). Produced using DMAP© Lily beetle is a defoliating pest of lilies (Lilium) and fritillaries (Fritillaria) that Rosemary beetle was first reported outdoors in the UK at RHS Wisley Garden became established in Surrey in the late 1930s. Until the late 1980s the beetle in 1994, however it was not found there again until 2000. During that time it remained confined to south east England. However during the past two became established in London, and is now a common pest in gardens in decades the beetle has spread rapidly and it is now found throughout England, south east England, with scattered reports from the rest of Britain. Both the is widespread in Wales and is spreading in Scotland and Northern Ireland. Little adults and the grey grubs defoliate rosemary, lavender and some other is known about the threat this beetle poses to native Snake’s head fritillary related plants. -

Contribution to the Knowledge of Sawfly Fauna (Hymenoptera, Symphyta) of the Low Tatras National Park in Central Slovakia Ladislav Roller - Karel Beneš - Stephan M
NATURAE TUTELA 10 57-72 UITOVSKY MIM li AS 'nix, CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF SAWFLY FAUNA (HYMENOPTERA, SYMPHYTA) OF THE LOW TATRAS NATIONAL PARK IN CENTRAL SLOVAKIA LADISLAV ROLLER - KAREL BENEŠ - STEPHAN M. BLANK JAROSLAV HOLUŠA - EWALD JANSEN - M ALTE JÄNICKE- SIGBERT KALUZA - ALEXANDRA KEHL - INGA KEHR - MANFRED KRAUS - ANDREW D. LISTON - TOMMI NYMAN - HAIYAN NIE - HENRI SAVINA - ANDREAS TAEGER - MEICAI WEI L. Roller, K. Beneš, S. M. Blank, J. Iloluša, E. Jansen, M. Jänicke, S. Kaluza, A. Kehl, 1. Kehr, M. Kraus, A. D. Liston,T. Nyman, II. Nie, II. Savina, A. Taeger, M. Wei: Príspevok k poznaniu fauny hrubopásych (Hymenoptera, Symphyta) Národného parku Nízke Tatry Abstrakt: Počas deviateho medzinárodného pracovného stretnutia špecialistov na hrubopáse blanokrídlovce (Hymenoptera, Symphyta) v júni 2005 bol vykonaný ľaunistický prieskum hrubopásych na viacerých lokalitách Národného parku Nízke Tatry. Celkovo bolo zaznamenaných 200 druhov a osem čeľadí hrubopásych. Ďalších dvanásť taxónov nebolo identifikovaných do druhu. Dolerus altivolus, D. hibernicus, Eriocampa dorpatica, Euura hastatae, Fenella monilicornis, Nematus yokohamensis tavastiensis, Pachynematus clibrichellus. Phyllocolpa excavata, P. polita, P. ralieri, Pontania gallarum, P. virilis, Pristiphora breadalbanensis, P. coactula a Tenthredo ignobilis boli zistené na Slovensku po prvýkrát. Významný počet ľaunistický zaujímavých nálezov naznačuje vysokú zachovalosť študovaných prírodných stanovíšť v širšom okolí Demänovskej a Jánskej doliny, Svarína a v národnej prírodnej rezervácii Turková. Kľúčové slová: Hymenoptera, Symphyta, Národný park Nízke Tatry, ľaunistický výskum INTRODUCTION Sawflies are the primitive phytophagous hymenopterans (suborder Symphyta), represented in Europe by 1366 species (LISTON, 1995; TAEGER & BLANK, 2004; TAEGER et al., 2006). In Slovakia, about 650 species belonging to 13 families of the Symphyta should occur (ROLLER, 1999). -

The Big Sawfly Survey
The Big Sawfly Survey What is a sawfly? Sawflies are a group of insects closely related to bees, wasps and ants but they don’t sting. They have a larval stage that feeds on certain plants. Some species of sawfly will only feed on one species of plant, which makes them easier to identify! Where can we find them? Gardens are like mini nature reserves for insects. You can help us to find sawflies by looking for their larvae (they look like caterpillars) in your garden. Have a look around your garden this summer. Some larvae may be easy to spot and others harder to find. You may notice leaf damage before you notice the larvae. Be aware that some species deliberately drop from the plant when disturbed (to avoid being eaten by birds) so you may want to catch any that fall in your hand or on a piece of paper to get a better look. How you can help Sawflies are under-recorded and we want to better understand how they are doing in our changing climate and other environmental pressures such as pesticides and habitat loss. Have a look at the list of sawflies in this leaflet and see if you can find any in your garden. You can help by taking pictures of any sawfly larvae that you see from the list and submitting your images online (www.brc.ac.uk/irecord/garden-sawflies). Sawfly larvae to look for… Gooseberries and currants There are four sawfly species that feed on gooseberry, blackcurrant and redcurrant plants: Common Gooseberry Sawfly (Euura ribesii), Pale-spotted Gooseberry Sawfly (Euura leucotrocha), Blackcurrant Sawfly (Euura olfaciens) and the Small Gooseberry Sawfly (Pristiphora appendiculata). -

Sawfly Study Group Newsletter 2
Newsletter 2 JANUARY 2007 Editor: Guy Knight, National Museums Liverpool William Brown Street, Liverpool, L3 8EN, UK [email protected] Thank you all for the encouragement and notes contributed since the previous newsletter was sent out last spring. This issue contains a variety of articles dealing with national and local recording, conservation status, behaviour and taxonomy. I am especially pleased that some of the notes in the last issue have been followed up and enhanced by what appears in this one. Because of costs, this is the last newsletter that will be sent out as printed copies unless specifically requested, so, if you have not already done so, please let me know if you can receive it electronically or require it on paper. Best wishes for a productive new year and please continue to send any contributions to me at the address above. RECENT LITERATURE This list is not exhaustive, but highlights some key literature and websites that have come to my attention in the past year. The end of last year saw the publication of the excellent Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects edited by S. Blank, S. Schmidt & A. Taeger (Goecke & Evers, Keltern, ISBN 3- 937783-19-9, 704pp). The book is a collection of about 40 papers detailing recent research on European and world sawfly life history & ecology, taxonomy, faunistics and checklists as well as reviews, biographies and a CD ROM of valuable ‘historic’ literature and colour plates. Several of the papers mentioned as ‘in prep’ or ‘in press’ in the note on recent additions to the British list in the last newsletter have now been published. -

Newsletter 2 JANUARY 2007
Newsletter 2 JANUARY 2007 Editor: Guy Knight, National Museums Liverpool William Brown Street, Liverpool, L3 8EN, UK [email protected] Thank you all for the encouragement and notes contributed since the previous newsletter was sent out last spring. This issue contains a variety of articles dealing with national and local recording, conservation status, behaviour and taxonomy. I am especially pleased that some of the notes in the last issue have been followed up and enhanced by what appears in this one. Because of costs, this is the last newsletter that will be sent out as printed copies unless specifically requested, so, if you have not already done so, please let me know if you can receive it electronically or require it on paper. Best wishes for a productive new year and please continue to send any contributions to me at the address above. RECENT LITERATURE This list is not exhaustive, but highlights some key literature and websites that have come to my attention in the past year. The end of last year saw the publication of the excellent Recent Sawfly Research: Synthesis and Prospects edited by S. Blank, S. Schmidt & A. Taeger (Goecke & Evers, Keltern, ISBN 3- 937783-19-9, 704pp). The book is a collection of about 40 papers detailing recent research on European and world sawfly life history & ecology, taxonomy, faunistics and checklists as well as reviews, biographies and a CD ROM of valuable ‘historic’ literature and colour plates. Several of the papers mentioned as ‘in prep’ or ‘in press’ in the note on recent additions to the British list in the last newsletter have now been published. -

The Plantsman Index 1994 to 2014
PlantsmanThe Abbs, Barbara, on: serrata N8 79, 80P P9 44 Gallic style rose naming N3 138–142 spathulata N8 79 P9 44, 44P The nurserymen William and f. colorata N8 79 Charles Wood N1 117–126 var. sanguinea N8 79 Index Abelia tereticalyx N8 82 1994–2014 hardiness N8 90 tetrasepala P9 44 key to cultivated species N8 91 triflora N8 82, 87 P9 45 P13 76 Names of plants new research, by Sven Landrein P9 var. parvifolia N8 88 Except for a very few cases, in which 40–47 tyaihyoni P9 45 obvious typographic errors have been section Abelia (Euabelia) N8 79 umbellata N8 90 silently corrected, names are given as section Zabelia N8 87 uniflora N8 81, 84 P9 41, 41P, 42, they appear on the page in question. biflora N8 88 P9 45 P13 76 43, 44 For reasons of space, no attempt has chinensis N8 87, 89P P9 42, 43, 43P, verticillata N8 82 been made to cross-refer all synonyms, 44 zanderi N8 88, 89 selling names or orthographic variants. x uniflora N8 84 Abies N1 20, 25 N6 54 This means that in some cases, the coreana N8 88 beshanzuensis P11 210 same plant may appear under several coriacea P9 47 bracteata P8 241 different names. To find alternative corymbosa P9 45 californica N1 22 names for a given plant, please visit the deutziifolia N8 82 cilicica P2 83 RHS website at http://apps.rhs.org. dielsii N8 88, 89 densa N2 68 uk/horticulturaldatabase/index.asp ‘Edward Goucher’ N8 81P, 83 P9 douglasii N1 21, 22 and enter the plant name in the search 40P, 43, 44 kweichowensis P2 143 box. -

Sawfly Study Group Newsletter 1
Newsletter 1 MARCH 2006 Editor: Guy Knight, National Museums Liverpool William Brown Street, Liverpool, L3 8EN, UK [email protected] Welcome to the new Sawfly Study Group newsletter. Your name has been passed on to me as someone who was either involved with the group when it was last active in the 1980s, or who has shown an interest in recording and sharing information on sawflies since then. I hope that you enjoy the newsletter and support it with you own contributions in the future. CONTENTS About the Sawfly Study Group ........................................................................................................ 1 Please provide some feedback ....................................................................................................... 2 An online discussion group I. F. Smith ........................................................................................... 2 Recent additions to the British sawfly list G. T. Knight.................................................................... 2 Finding the Poplar sawfly A. J. Halstead........................................................................................ 6 Blasticotoma filiceti in north Wales G. T. Knight & M. A. Howe...................................................... 7 Member profiles .............................................................................................................................. 8 ABOUT THE SAWFLY STUDY GROUP The Sawfly Study Group was initiated by David Sheppard in 1987 as a means of facilitating -

Apports a La Chorologie Des Hymenopteres Symphytes De Belgique Et Du Grand-Duche De Luxembourg
BulletinS.RB.E.IKB.V.E., 135 (1999): 159-163 Apports a la chorologie des Hymenopteres Symphytes de Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg. XX par Noel MAGIS Faculte universitaire des Sciences agronomiques, Unite de Zoologie generale et appliquee (Prof. Ch. Gaspar), B- 5030 Gembloux (Belgique (e-mail: [email protected]). Abstract Original records for the Belgian fauna of some interesting species of Symphyta are presented. Those belong to the Blenocampinae, Heterarth.rinae, Tenthredininae, Nematinae {Tenthredinidae) and one to the Argidae. The utilisation ofMOERICKE trap (yellow plates) appears of great interest to collect some small, and little mobile species, such the Heterarthrinae. The case of 8 among themselves, trapped by this procedure in "Montagne-St-Pierrre", is analysed. Arge berberidis ScHRANK is yet in expansio:Q. in Belgium. This positive drift would be correletated with the rehabilitation of Berberis and the important and frequent use of Mahonia sp. in the sub- and periurban areas. Keywords : Hymenoptera, Symphyta, faunistic, MOERICKE trap, faunistic drift, Belgium. Resume Des informations originales sont donnees sur differentes especes de Symphytes interessantes pour la faune de Belgique. Elles appartiennent aux Blennocampinae, Heterarth.rinae, Tenthredininae, Nema tinae (Tenthredinidae) et une espece aux Argidae. L'interet du piegeage a l'aide de bacs a eau jaunes (pieges MOERICKE) est souligne par l'etude des Heterarthrinae captures par ce procede a la Montagne St-Pierre, en 1994. Arge berberidis ScHRANK est actuellement dans une phase d'expansion; celle-ci pourrait trouver son origine dans la rehabilitation des plantations de Berberis et !'utilisation de plus en plus importante, des Mahonia comme plantes d'omement dans les jardins publics et prives des milieux sub- et periurbains. -

Invertebrate Survey of Vc 34 a Report to David Gibbs 2006
Invertebrate Survey of Troopers Hill LNR Bristol (ST 6273) vc 34 a report to Bristol City Council David Gibbs 2006 Summary 1 The approximately 4 /2 days of survey yielded 276 species, which is an excellent diversity. True Flies (Diptera) are the most diverse making up a little over half of the dataset. The diversity of Hymenoptera found is very high even for such an open sunny site, making up about a third of the dataset. Of the 276 species found, 23 of them are considered to be of conservation significance. This is a proportion of 8.3% which places Troopes Hill amongst the most important reserves in the region. Five of the species found (1.8%) have RDB or equivalent status, further confirming the importance of the site. The results suggest that the quality of Troopers Hill is still high and not appreciably degraded since the 2000 report. However, there is some concern over two missing species, Andrena labiata and its very rare cleptoparasitoid Nomada guttulata. Introduction Troopers Hill is a small area of flower rich grassland developed on the very poor soils left over after metal mining operations. It has been saved from development by its steep topography and from succession to woodland by the thin and probably toxic nature of the substrate. It was formerly known for its colony of Grayling Hipparchia semele (not seen for many years and certainly extinct), one of the primary reasons for Troopers Hill’s status as a Local Nature Reserve. More recently its great importance for less well known insects, particularly Hymenoptera and the Dotted beefly Bombylius discolor, has been recognised. -

England Biodiversity Indicators 2020
20. Pressure from invasive species England Biodiversity Indicators 2020 This document supports 20. Pressure from invasive species Technical background document Colin A. Harrower, Stephanie L. Rorke, Helen E. Roy For further information on the England Biodiversity Indicators visit: https://www.gov.uk/government/statistics/england-biodiversity-indicators 1 20. Pressure from invasive species 20. Pressure from invasive species – technical document – September 2020 Colin A. Harrower, Stephanie L. Rorke, Helen E. Roy Centre for Ecology & Hydrology Overview There are currently 193 invasive non-native species in Great Britain that are included within the indicator for 2020. The current indicator is the result of incremental updating of an indicator initially produced in 2014. In 2014, the first indicator was created using a 2-stage process beginning with extent estimation using a statistical process fitted to occurrence data available through the NBN Gateway which were then validated and modified, where required, by taxonomic experts. The rationale for using a statistical process to produce extent estimates was to attempt to control for the patchy nature of the occurrence data. The expert validation in 2014 determined that the extent estimates produced algorithmically typically underestimated the true extent due to much of the occurrence data not being easily available, particularly for earlier decades, and therefore most of the estimates required revision by the taxonomic experts. In 2015, the species list and the classification of extent (derived for the 2014 indicator) were reviewed and updated by taxonomic experts. The existing species list and the classification of extents were reviewed again in 2017, 2018, 2019 and 2020 to update the indicator.