Des Nationalparks Thayatal. Josef Harl
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Manual of Transnational Green Infrastructure Assessment – Decision Support Tool
Manual of Transnational Green Infrastructure Assessment – Decision Support Tool MANUAL OF TRANSNATIONAL GREEN INFRASTRUCTURE ASSESSMENT Decision Support Tool MANUAL OF TRANSNATIONAL GREEN INFRASTRUCTURE ASSESSMENT – DECISION SUPPORT TOOL This English manual version was compiled as Output O.T1.2 of the Interreg Central Europe Project MaGICLandscapes „Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes“ funded by the European Regional Development Fund (ERDF). This publication and its short versions in Czech, German, Italian and Polish languages can be downloaded from the project website. Project Lead Partner: Technische Universität Dresden Faculty of Environmental Sciences Chair of Remote Sensing, Prof. Dr. Elmar Csaplovics Helmholtzstr. 10 01069 Dresden Authors of this Manual: Marco Neubert5, Henriette John5, Christopher Marrs1, Simonetta Alberico9, Gabriele Bovo9, Simone Ciadamidaro10, Florian Danzinger7, Martin Erlebach6, David Freudl8, Stefania Grasso9, Anke Hahn1, Zygmunt Jała4, Ines Lasala2, Mariarita Minciardi10, Gian Luigi Rossi10, Hana Skokanová2, Tomáš Slach2, Kathrin Uhlemann3, Paola Vayr9, Dorota Wojnarowicz4, Thomas Wrbka7 1 Technische Universität Dresden, Germany 2 Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Czech Republic 3 The Saxony Foundation for Nature and Environment, Germany 4 Karkonosze National Park, Poland 5 Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Germany 6 The Krkonoše Mountains National Park, Czech Republic 7 University of Vienna, Austria 8 Thayatal National Park, Austria 9 Metropolitan City of Turin, Italy 10 ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Italy Editors: Marco Neubert, Henriette John Layout: Anke Hahn Illustrations cover and icons: Anja Maria Eisen Suggested Citation: Neubert, M., John, H. (ed., 2019). Manual of Transnational Green Infrastructure Assessment – Decision Support Tool. -

National Parks Austria. Time for Nature
Time for nature. 6 national parks Nothing touches us under one roof. NATIONALPARK THAYATAL like the untouched. Nationalparkhaus, 2082 Hardegg T: +43 29 49 / 70 05-0 www.np-thayatal.at NATIONALPARK NATIONALPARK @nationalparkthayatal npthayatal Austria's six national parks, Thayatal (Thaya Valley), Hohe Tauern, DONAU-AUEN KALKALPEN Donau-Auen (Danube wetland), Gesäuse, Neusiedlersee- schlossORTH Nationalpark- Nationalpark Zentrum Molln parks the national of Austria for Time Zentrum, 2304 Orth/Donau Nationalpark Allee 1, 4591 Molln Seewinkel and the Kalkalpen (Limestone alps), protect the T: +43 22 12 / 35 55 T: +43 75 84 / 36 51 greatest natural treasures of our nation. Across a total of 2,380 www.donauauen.at www.kalkalpen.at square kilometres, they accommodate astonishing natural @np_donau_auen @nationalparkkalkalpen donauauen WaldWildnis NATIONALPARK landscapes and provide vital habitats for a large number of HOHE TAUERN endangered animals and plant species. Here in these enclosures, Carinthia: Besucherzentrum Mallnitz nature has enough space to evolve freely. It is the expressed Mallnitz 36, 9822 Mallnitz purpose of the national parks to safeguard these areas and keep T: +43 48 25 / 61 61 Salzburg: them alive for future generations Nationalparkzentrum Mittersill to come. NATIONALPARK NATIONALPARK Gerlosstraße 18, 5730 Mittersill T: +43 65 62 / 408 49 GESÄUSE NEUSIEDLER SEE Tyrol: Under the umbrella association “Nationalparks Austria”, these six Informationsbüro Admont – SEEWINKEL Nationalparkhaus Matrei Hauptstraße 35, 8911 Admont Kirchplatz 2, 9971 Matrei Austrian national parks are closely collaborating with the Federal Nationalpark Informations zentrum T: +43 36 13 / 211 60 20 T: +43 48 75 / 51 61-10 Illmitz, Hauswiese, 7142 Illmitz Ministry for Sustainability and Tourism, in a steady effort to raise www.nationalpark.co.at T: +43 21 75 / 34 42 www.hohetauern.at awareness for the immeasurable value of our natural heritage. -

Amphibien Im Nationalpark Thayatal. Andrea Waringer
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliche Mitteilungen Niederösterreichisches Landesmuseum Jahr/Year: 2010 Band/Volume: 21 Autor(en)/Author(s): Waringer-Löschenkohl Andrea, Ruzek Sabine, Werba Franziska Artikel/Article: Amphibien im Nationalpark Thayatal. 361-384 ©Amt der Niederösterreichischen Landesregierung,, download unter www.biologiezentrum.at Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 21 361-384 St. Pölten 2010 Amphibien im Nationalpark Thayatal Andrea Waringer-Löschenkohl, Sabine Ruzek, Franziska Werba Zusammenfassung Bei der Laichplatzkartierung 2006 und 2007 wurden zehn Amphibienarten an 26 Stillgewässern und einigen Bächen im Nationalpark und seiner Umgebung nachge- wiesen. Häufigste Art der stehenden Gewässer war der Grasfrosch, gefolgt vom Springfrosch mit den höchsten Dichten in Fugnitzsee und Fugnitzgraben. Die höch- sten Erdkrötendichten fanden sich im Wolfsteich. Artenreichstes Laichgewässer im Nationalpark war der Fugnitzsee mit sieben laichenden Amphibienarten. In der angrenzenden Agrarlandschaft war der Johanneskreuz-Graben mit einer Gesamtzahl von acht Amphibienarten, davon sechs mit Fortpflanzungsnachweis, das artenreich- ste Gewässer des Untersuchungsgebiets. Die Bäche waren Laichgewässer für drei Amphibienarten: Feuersalamander, Grasfrosch und Erdkröte. Abstract Amphibians of the Thayatal National Park In 2006 and 2007 ten amphibian species bred in 26 stagnant waters and some brooks in the Thayatal National Park and its surrounding agricultural landscape. Rana tem- poraria was the most frequent species, followed by Rana dalmatina reaching the hig- hest densities at Fugnitzsee and Fugnitzgraben. The spawning density of Bufo bufo was highest at the Wolfsteich. The location with most spawning species was the Fugnitzsee (seven breeding species). Within the agricultural landscape the Johanneskreuz-Graben with eight species, six of them breeding, was most diverse. -
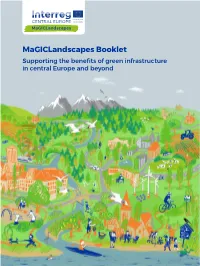
Magiclandscapes Booklet
MaGICLandscapes MaGICLandscapes Booklet Supporting the benefits of green infrastructure in central Europe and beyond MaGICLandscapes Booklet – Supporting the benefits of green infrastructure in central Europe and beyond This Booklet was compiled as Deliverable D.C.6.3 of the Interreg Central Europe Project MaGICLandscapes “Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes“ funded by the European Regional Development Fund (ERDF). Lead Partner Technische Universität Dresden Faculty of Environmental Sciences Chair of Remote Sensing, Prof. Dr. Elmar Csaplovics Helmholtzstr. 10 01069 Dresden, Germany Project Partners Technische Universität Dresden, Germany Silva Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Czech Republic The Saxony Foundation for Nature and Environment, Germany Karkonosze National Park, Poland Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development, Germany The Krkonoše Mountains National Park, Czech Republic University of Vienna, Austria Thayatal National Park, Austria Metropolitan City of Turin, Italy ENEA - Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development, Italy Editors: Anke Hahn, Christopher Marrs Layout: Anke Hahn Cover illustration and benefit icons: Anja Maria Eisen The MaGICLandscapes Booklet is published online: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes. html#Outputs This publication is licensed under a Creative Commons Attribution - Non Commercial - No Derivative Works 4.0 International License. Dresden, October 2020 -

319 Konference “15 Let Národního Parku Podyjí
THAYENSIA (ZNOJMO) 2007, 7: 319–332. ISSN 1212-3560 KONFERENCE “15 LET NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ – VÝZKUM A OCHRANA”, ZNOJMO, 1.–3. LISTOPADU 2006: ABSTRAKTA PREZENTACÍ, KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTY V TOMTO SBORNÍKU FORMOU ČLÁNKU CONFERENCE “15 YEARS OF THE PODYJÍ NATIONAL PARK – RESEARCH AND PROTECTION”, ZNOJMO, NOVEMBER 1–3, 2006: ABSTRACTS OF PAPERS NOT INCLUDED IN THIS ISSUE DIPTERA OF THE PODYJÍ NATIONAL PARK AND ITS ENVIRONS Miroslav B a r t á k Czech University of Agriculture, Department of Zoology and Fisheries, CZ–165 21 Praha 6, Czech Republic The area of the Podyjí NP and its close environs were thoroughly investigated in 2001–2004 in order to learn more information about the Diptera fauna. Altogether, 3,606 species were identi- fi ed. In the fi nal monograph resulting from our research (BARTÁK M., KUBÍK Š. (eds.) 2005: Diptera of Podyjí National Park and its Environs. – ČZU Praha, 432 pp.) we reported 137 records of new species in the Czech Republic and another 155 in Moravia. The most striking feature of the Podyjí NP’s Diptera fauna is the surprisingly frequent occurrence of species with clear affi nity to mounta- inous habitats. A relatively large number of the species collected in the Podyjí NP were obviously obtained due to the effi cient collecting methods used (Malaise traps, white and yellow pan water traps, emergence traps, sweeping, car nets, etc.). The Podyjí NP proved to be very important for nature conservation, altogether 252 species included in the recent regional Red list were found (= 26.1% of all Czech species included) and several species discovered for the fi rst time in the Czech Republic by the present investigations in this area were proposed in addition to this list. -

NPDA 42 2016: Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt. Schweiger
Heft 42/2016 Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Das Europäische Grüne Band erstreckt sich entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs durch ganz Europa und ver- bindet dabei ausgedehnte, naturnahe Biotopflächen und wertvolle Kulturlandschaften mit wachsenden Siedlungsräu- men und intensiv genutzten Agrarlandschaften. Diese Studie beschäftigt sich mit dem momentanen Status Quo der Initiative Grünes Band Österreich, sie gibt Einblick in den Wert der Landschaften dieser Region für den Naturschutz und bietet konkrete Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Initiative Grünes Band Österreich und der Nie- derösterreichischen Grenzgebiete. Eva Schweiger Guiding Concepts for Conservation of the Lower Austrian Green Belt Eva Schweiger, 2015 Abstract Stretching across Europe along the former Iron Curtain, the European Green Belt connects large undisturbed natural biotopes and valuable cultural landscapes with developing urban areas and intensively used agricultural landscapes. The European Green Belt initiative’s main goal is to preserve and restore a pan-European ecological network with a connecting function for species and habitats as well as for conservation work. This study investigates the current status quo of the Austrian Green Belt initiative in regard of organisational structures and conservation activities. Furthermore, a spatial analysis of one specific part of the Austrian borderlands, the Lower Austrian Green Belt, sheds light on the value of this region’s landscapes for nature conservation and clearly shows that the Iron Curtain’s preserving effect is still present in proximity to the border. The conserved valuable cultural landscapes and (semi-) natural biotope areas can and should contribute to the Lower Austrian Green Belt’s integrity and the functioning of the ecological network. -

Fledermäuse in Den Nationalparks Thayatal Und Podyjí, Sowie Erstnachweis Der Nymphenfledermaus (Myotis Alcathoe HELVERSEN & HELLER, 2001) in Niederösterreich
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliche Mitteilungen Niederösterreichisches Landesmuseum Jahr/Year: 2010 Band/Volume: 21 Autor(en)/Author(s): Hüttmeir Ulrich F.H., Reiter Antonin, Reiter Guido Artikel/Article: Fledermäuse in den Nationalparks Thayatal und Podyjí, sowie Erstnachweis der Nymphenfledermaus (Myotis alcathoe HELVERSEN & HELLER, 2001) in Niederösterreich. 433-444 ©Amt der Niederösterreichischen Landesregierung,, download unter www.biologiezentrum.at Wiss. Mitt. Niederösterr. Landesmuseum 21 433-444 St. Pölten 2010 Fledermäuse in den Nationalparks Thayatal und Podyjí, sowie Erstnachweis der Nymphenfledermaus (Myotis alca- thoe HELVERSEN & HELLER, 2001) in Niederösterreich1 Ulrich Hüttmeir, Antonin Reiter, Guido Reiter Zusammenfassung Im Nationalpark Thayatal wurde 2009 mit einer umfangreichen Untersuchung der Fledermausfauna begonnen. Dabei wurden verschiedene Untersuchungsmethoden wie Netzfänge, Begehungen mit Ultraschalldetektoren, Einsatz von automatischen Rufaufzeichnungsgeräten, sowie Kontrolle von Sommer- und Winterquartieren kom- biniert. Insgesamt konnten im Nationalpark und seinen angrenzenden Gebieten bis- lang 20 Fledermausarten nachgewiesen werden. Bemerkenswert ist die hohe Anzahl von Netzfängen im Jagdhabitat: 230 Individuen aus 16 Fledermausarten konnten an insgesamt 20 Standorten gefangen werden. Je zwei weitere Arten wurden anhand ihrer Ultraschallrufe bzw. im Sommerquartier nachgewiesen. -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit “Eco-Tourism as an Instrument for Sustainable Development in National Parks? An Analysis of the National Park Thayatal“ Verfasserin Mariana Huber Angestrebter akademischer Grad Magistra der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften (Mag. rer. soc. oec.) Wien, im September 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 157 Studienrichtung lt. Studienblatt: Internationale Betriebswirtschaft Betreuer/Betreuerin: Univ.-Prof. Dr. Gerhard Clemenz Eco-Tourism as an Instrument for Sustainable Development in National Parks 2 Eco-Tourism as an Instrument for Sustainable Development in National Parks Für meinen Papa „Die Natur schenkt und grenzenlos eine Chance nach der anderen. Wir nennen das Wiedergeburt und Tod, ohne uns in unserem Wahnsinn und unserer Angst vom dem Tod zu verstehen, dass es sich um einen neuen Tag handelt, um eine neue Seite, auf der man schreiben und sich selbst eine neue Zukunft schaffen kann… Die Wahrheit ist, dass mein Körper geboren wurde und sterben wird. Ich selbst bin ewig…“ (Parthasarathi Rajagopalachri) 3 Eco-Tourism as an Instrument for Sustainable Development in National Parks 4 Eco-Tourism as an Instrument for Sustainable Development in National Parks Table of contents I. Introduction .......................................................................................................... 10 II. Theoretical part, Explanation of the concepts ................................................... 13 1. Sustainalbe development ............................................................................................. -

Magiclandscapes Magicnews
MaGICNEWS no. 1 01/2018 interreg-central.eu/magiclandscapes MaGICLandscapes IN THIS ISSUE: MaGICLandscapes: an introduction to a “green infrastructure“ project | Page 1 Environmental equality and quality of life: benefits of green infrastructure | ageP 2 In portrait: MaGICLandscapes case study area Kyjovsko (CZ) | Page 3 MAGICLANDSCAPES: AN INTRODUCTION TO A “GREEN INFRASTRUCTURE“ PROJECT Green Infrastructure (GI) is a key strategy of the European Landscape Convention aimed at reconnecting vital natural areas to urban hubs and restoring and improving their functional roles. Thus, GI is an essential planning concept towards protecting natural capital and simultaneously enhancing quality of life. The project MaGICLandscapes will operationalise the GI concept in Central Europe providing land users, policy makers and communities adequate tools and the knowledge they need to ensure the persistence of GI functionality and consequent benefits to society. Statistics of the European Environment Agency state: soil sealing in Europe is accelerating at an unpresedented rate. Transport Leibniz Institute for Ecological Urban and Regional Development infrastructure, housing and The Saxony Foundation for Nature and Environment industrial development, modern The Karkonosze National Park The Krkonoše Mountains National Park agriculture requires more and TU Dresden more land and can have negative Silva Tarouca Research effects on biodiversity. Former Institute for Landscape and Ornamental Gardening green spaces are becoming part of Thayatal National Park the grey infrastructure of buildings, University of Vienna traffic routes etc.faster than ever before. Recent European and national publications acknowledge the fact that green spaces are an important and valuable asset in mitigating against the impacts of climate change, such as flooding and heatwaves, to improve human Metropolitan City of Turin health and to restore ecosystem Italian National Agency for New Technologies, services. -

Interreg CE Magiclandscapes Final Conference (Online)
The Green Infrastructure Approach: MaGICLandscapes Multiple benefits for landscape planning and management in Interreg CE MaGICLandscapes central Europe Over the last three years 10 partners from across five central Final Conference (online) European countries have cooperated in the Interreg Central Europe th project MaGICLandscapes to develop tools for green infrastructure 6 October 2020, 14-17 CEST assessment across 9 case study areas. At the MaGICLandscapes Final Conference on 6th of October 2020 Register now! the partners will present the outputs and tools developed within the project. Transnational and regional studies and spatial analysis of green infrastructure in central Europe, its ecological functionality and its ecosystem services and potential will be discussed. Partners will demonstrate the functionality of green infrastructure and its public benefits in the case study areas and how their green infrastructure strategy and action plans were developed to address local and regional needs and opportunities. The conference will take place online and in English language. Click HERE to register until 2nd of October 2020! VÚKOZ The MaGICLandscapes Final Conference is a partner event of the EU Green Week 2020. interreg-central.eu/MaGICLandscapes CEMaGICLandscapes InterregML Interreg CE MaGICLandscapes PROGRAMME Krkonoše National Park (Liberec Region and Hradec Králové 14:00 Welcome of the Lead Partner Region, Czech Republic) Elmar Csaplovics, TU Desden Martin Erlebach, Krkonoše Mountains National Park 14:05 Transnational cooperation -
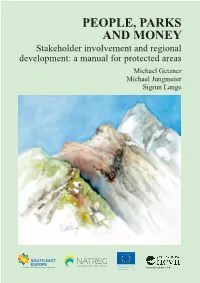
PEOPLE, PARKS and MONEY Stakeholder Involvement and Regional Development: a Manual for Protected Areas Michael Getzner Michael Jungmeier Sigrun Lange
PEOPLE, PARKS And MOnEY Stakeholder involvement and regional development: a manual for protected areas Michael Getzner Michael Jungmeier Sigrun Lange www.verlagheyn.at PeoPle, Parks and Money stakeholder involveMent and regional develoPMent: a Manual for Protected areas Michael getzner, Michael Jungmeier, sigrun lange 1 2 PeoPle, Parks and Money stakeholder involvement and regional development: a manual for protected areas Michael getzner, Michael Jungmeier, sigrun lange With contributions by roger crofts, Barbara Müller and thomas topp research assistance: anna unterköfler daniel Zollner a NATREG training manual for partners this publication is financed by the NATREG project. the NATREG project is financed by the south east europe transnational cooperation Programme Published with support of the research council of the alps-adriatic-university of klagenfurt (forschungsrat der alpen-adria-universität klagenfurt) series: Proceedings in the Management of Protected areas, vol. 2 series editors: Michael getzner, Michael Jungmeier this publication reflects the views only of the authors, and the south east europe Programme Managing authority cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein 3 Title page: © Blaha 2010 © by verlag Johannes heyn klagenfurt, 2010 druck: druckerei theiss gmbh, a-9431 st. stefan isBn 978-3-7084-0413-4 4 To our kids 5 5 6 FOREWORD Currently, there are a number of books on the market dealing with protected ar- eas management from different perspectives. However, there is no book available that emphasises regional development and stakeholder involvement along the “life-cycle” of protected areas and that additionally has a focus on the European perspective of managing protected areas. -

Forschung Im Nationalpark 2005/2006
Forschung im Nationalpark 2005/2006 Scientific research in national parks 2005/2006 IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Stubenbastei 5, 1010 Wien www.lebensministerium.at Gesamtkoordination: Ingrid Adelpoller, Abt. II/4 Fotos: Nationalparks Hohe Tauern, Kalkalpen, Thayatal, Donau-Auen, Neusiedler See – Seewinkel, Gesäuse Titel – großes Bild: Scheuchzer Wollgras (Nationalpark Hohe Tauern) Titel – kleine Bilder von links nach rechts: Libelle (Nationalpark Donau-Auen/Kracher) Nachtfalter (Nationalpark Donau-Auen/Kracher) Thayatal im Morgengrauen (Nationalpark Thayatal/Dieter Manhart) Fischotter (Nationalpark Gesäuse) Bisher erschienen: Forschungsbericht 2000, Forschungsbericht 2002 und Forschungsbericht 2004 Copyright: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Alle Rechte vorbehalten Gestaltung: Skibar Grafikdesign Druck: Gedruckt auf: Biberist Furioso, holzfrei, matt gestrichen Gedruckt nach der Richtlinie „Schadstoffarme Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens. AV + Astoria Druckzentrum GmbH Vorwort/Foreword 0100km Nationalparks 5 Staatsgrenze Niederösterreich Linz Landesgrenze Wien 4 Oberösterreich St. Pölten d n Eisenstadt a Salzburg 2 l 3 6 n e Steiermark Bregenz g r Vorarl- Innsbruck Salzburg u berg Tirol 1 B Graz Kärnten Klagenfurt Umwelt und Natur profitieren von der angewandten For- 1 Hohe Tauern 2 Kalkalpen 3 Neusiedler See – Seewinkel 4 Donau-Auen 5 Thayatal 6 Gesäuse schung in den sechs österrei- chischen Nationalparks. Großschutzgebiete wie National- Nature and the environment benefit from the applied sci- parks geben zukunftsweisende Impulse für die Natur- entific research conducted in the six Austrian national schutzforschung in unserem Land. Damit helfen sie, öko- parks. Large protected areas, such as national parks, give logische Zusammenhänge und die Dynamik der verschie- impulses for the future development of conservation re- denen Lebensräume besser zu verstehen.