Für Führer, Volk Und Vaterland (PDF, 3,9
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Development and Character of the Nazi Political Machine, 1928-1930, and the Isdap Electoral Breakthrough
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1976 The evelopmeD nt and Character of the Nazi Political Machine, 1928-1930, and the Nsdap Electoral Breakthrough. Thomas Wiles Arafe Jr Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Arafe, Thomas Wiles Jr, "The eD velopment and Character of the Nazi Political Machine, 1928-1930, and the Nsdap Electoral Breakthrough." (1976). LSU Historical Dissertations and Theses. 2909. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2909 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. « The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1.The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing pega(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

Luxembourg Resistance to the German Occupation of the Second World War, 1940-1945
LUXEMBOURG RESISTANCE TO THE GERMAN OCCUPATION OF THE SECOND WORLD WAR, 1940-1945 by Maureen Hubbart A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree MASTER OF ARTS Major Subject: History West Texas A&M University Canyon, TX December 2015 ABSTRACT The history of Luxembourg’s resistance against the German occupation of World War II has rarely been addressed in English-language scholarship. Perhaps because of the country’s small size, it is often overlooked in accounts of Western European History. However, Luxembourgers experienced the German occupation in a unique manner, in large part because the Germans considered Luxembourgers to be ethnically and culturally German. The Germans sought to completely Germanize and Nazify the Luxembourg population, giving Luxembourgers many opportunities to resist their oppressors. A study of French, German, and Luxembourgian sources about this topic reveals a people that resisted in active and passive, private and public ways. ii ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank Dr. Elizabeth Clark for her guidance in helping me write my thesis and for sharing my passion about the topic of underground resistance. My gratitude also goes to Dr. Brasington for all of his encouragement and his suggestions to improve my writing process. My thanks to the entire faculty in the History Department for their support and encouragement. This thesis is dedicated to my family: Pete and Linda Hubbart who played with and took care of my children for countless hours so that I could finish my degree; my husband who encouraged me and always had a joke ready to help me relax; and my parents and those members of my family living in Europe, whose history kindled my interest in the Luxembourgian resistance. -

Lt. (Jg), Us:M 10 November 1945
I NTH E I~ITERNATIONAL MILITARY TRIDUNAL TRIAL BRIEF CRDHNALITY 0;;' DAS KORPS DER.. FDLITISCHE' !EITER Dill HATIONAlSOZIAL- ISTISCrlliN DEUTSCHEN k1BEITERPARTEI I (LEADERSHIP CORPS OF THE K\ZI PARTY) FOR ROBERT H. JACKSON UNITED STATES CHIEF OF COUNSEl BY THOYtAS F. W.BERT, .ill, Lt. (jg), us:m 10 November 1945 OFFICE OF U.S. CHIEF OF CourSEL SECTIO~! 6 GEORGE E. SEAY LT. COL., A.C. CHIZF OF SECTION I..BGAL S'.".'lFF T1UAL O::CA:r:r:ZATJO!'T INDEX TOPICAT INDEX Page No. Section of Indictment. .. .. ... xii Count One, IV (H), Sentence 2 .. .. xii Appendix. B••..•••••••• xii legal Ref~rences •••••••.....•.•••• • xiii ChQrter of Intern~tion~l .:ilitQry Tribunal . • • ·. Article 6 (n), (b), & (c) .. ... .. ·. .. xiii J.rticle 9 xiv OP13l.I :G STATEf.'.E 'T . .. 1 1 :,iTj.Ti:L::JJT OF EVIDENCE . .. •• 2 - 72 I. Composition, Functions and Powers of the LCQdership Corps of the Nazi Party · . ·2 12 ~. Definition of the Loadership Corps • 2 B. Hierarchical Organization of the leadership Corps .••.......... 2 - 7 1. Th-.; :r.eichsl(;itl.:r (Reich !GC1.ders) • 2 - 4 2. The GC'uleiter (District I,e<.'.ders) 4 - 5 3. Th(; l~reisleiter (County lenders) •• · ... 5 4. The Ortsgruppenleiter (Local Chapter leaders) ••• 5 - 6 5. The Zellenleiter (Cell ~~~ders) 6 6. Tht; :310c ~leiter (Dlock J.eaders) .. .. 6 - 7 C. The "Hoheitstmger" ("Bearers of :;overeignty") • '1 - 8 D. Org~nization of l~~dership Corps under the ''It;Qdership Principle" 9 - 10 1. Provisions of P~rty !.{anu.:'..l . .. · . 9 2. Oath of ~olitic['J. Leaders to Hitler ·... 9 3. Appointm",nt of PoliticnJ. -

Verhaltensmuster Von Frauen Im NS Alltag (1933-1945): Am Beispiel Denunziantinnen
Verhaltensmuster von Frauen im NS Alltag (1933-1945): am Beispiel Denunziantinnen von der Fakultät 1 - Geisteswissenschaften - der Technischen Universität Berlin genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktorin der Philosophie vorgelegt von Vandana Joshi aus Ranikhet, Indien Berlin, 2002 D 83 Berichterin: Prof. Dr. Karin Hausen Berichterin: Priv.-Doz. Dr. Karen Hagemann Tag der Wissenschaftlichen Aussprache: 21 Dezember 2001 2 Women’s Modes of Behaviour in National Socialist Alltag (1933-1945): A Study of Denouncers Dissertation approved by the Faculty 1-Humanities- Technical University, Berlin, for obtaining the degree of Doctor of Philosophy Vandana Joshi, Ranikhet, India Berlin, 2002 D 83 3 Acknowledgements I started work on this thesis in October 1995 when I landed in Prof. Annette Kuhn's seminar on Lehrgebiet Frauengeschichte, University of Bonn as a DAAD fellow. Prof. Kuhn and Dr. Valentina Rothe never allowed me to feel home sick and often called me over to their place. Their generous helpings of good food and lots of affection kept me in good spirits. Prof. Kuhn put me on to various archivists to explore material for research and I finally settled in the State Archives of Düsseldorf where I worked for a year under her supervision. I began writing in Berlin the next year at Prof. Karin Hausen’s Centre for Interdisciplinary Research on Women and Gender at the Technical University, Berlin. Her colloquium provided me with an intellectually stimulating and friendly atmosphere and I managed to write two important chapters during my stay there. Prof. Hausen personally has been extremely encouraging. She patiently listened to what I had to say not necessarily on my thesis alone but on other matters of life. -

3) KONTROLLE UND EINSCHÜCHTERUNG Mag
1 WAIDHOFEN 1938 - 1945 3) KONTROLLE UND EINSCHÜCHTERUNG Mag. Walter Zambal INHALT: 1) DIE MACHTÜBERNAHME DURCH DIE NSDAP 2) DIE TOTALE ERFASSUNG DER BEVÖLKERUNG 3) DENUNZIATIONEN 4) DER „BOTE VON DER YBBS“ ALS INSTRUMENT DER EINSCHÜCHTERUNG 5) DIE VERSCHÄRFUNG DER SITUATION GEGEN ENDE DES KRIEGES 6) LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS 7) ANHANG 1) DIE MACHTÜBERNAHME DURCH DIE NSDAP Nach dem Anschluss wird die Einheitspartei des Ständestaates, die „Vaterländische Front“ sofort aufgelöst. Als nunmehr einzige Partei ist die NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) mit ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden zugelassen. Aber bereits vor dem Anschluss gibt es in Waidhofen 271 „organisierte Parteigenossen“, wie aus einem Artikel im „Boten“ vom 25.März 1938 hervorgeht: ► „Die ‚paar jugendlichen Unentwegten’, wie es immer hieß, umfaßten in unserer Stadt die stattliche Zahl von 271 organisierten Parteigenossen, davon in der SS 33, SA 106, NSKK 44, PO 106, HJ 88, BDM 24, NSF 50.“1 Noch im Juni 1938 kommt es zu einer „Vergeltungsaktion“ die gegen die Vertreter des Ständestaates gerichtet ist: ► Inspektor Pitzel berichtet über Vergeltungsmaßnahmen der SA im Juni 1938: „Im Juni inszenierte die SA eines Abends schlagartig eine sogenannte Vergeltungsaktion, bei der ihr mißliebige Gegner, hauptsächlich solche, welche in den ehemaligen Wehrformationen sich hervorgetan hatten, aus den Wohnungen geholt und zur Polizeidienststelle gebracht wurden. Dort hatte sich eine große Menschenmenge angesammelt, die an den Vorgängen anscheinend Gefallen fand. Mehrere der unrechtmäßig Festgenommenen wurden insultiert, einige nicht unerheblich verletzt.“2 Diese Vorfälle werden auch im Situationsbericht des Landrats des Kreises Amstetten an die Gestapo Wien vom 1.7.1938 erwähnt: „Der Monat Juni (1938) ist im Bezirke im allgemeinen politisch vollkommen ruhig verlaufen. -

The Concept of Stare Decisis in the German Legal System – a Systematically Inconsistent Concept with High Factual Importance
Pobrane z czasopisma Studia Iuridica Lublinensia http://studiaiuridica.umcs.pl Data: 01/10/2021 21:41:15 Part 4. Studia Iuridica Lublinensia vol. XXVII, 1, 2018 DOI: 10.17951/sil.2018.27.1.121 Peter Stainer Attorney-at-law, Frankfurt am Main, Germany [email protected] Dominik König Inhouse legal counsel, Bad Homburg, Germany [email protected] The Concept of Stare Decisis in the German Legal System – A Systematically Inconsistent Concept with High Factual Importance Koncepcja stare decisis w systemie prawa niemieckiego – niespójna systemowo koncepcja posiadająca wysoką realną wartość SUMMARY It is worth mentioning that the German legal system is based on the codified law. This system lacks in stare decisis and precedentsUMCS in general, which – in principle – does not raise doubts. The role of precedent in the decisional process is relative and dependent on the question as to whether the case may be resolved pursuant to a legal act. In that case, precedents would not play any or almost any role at all. However, the role of precedents increases, when there is a lack of appropriate legal rights, or if legal rights require inter- pretation. It should be emphasised that stare decisis understood as a formally binding precedent refers only to rulings issued by the Federal Constitutional Court, whereas precedents of higher courts have a significant meaning to everyday judicial practice in Germany, despite the fact that they are not formally binding. Keywords: stare decisis; precedent; German legal system; Federal Constitutional Court INTRODUCTION Stare decisis is an abbreviation of the Latin phrase stare decisis et non quieta movere, meaning “to stand by decisions and not to disturb settled matters”1. -
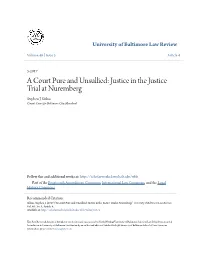
Justice in the Justice Trial at Nuremberg Stephen J
University of Baltimore Law Review Volume 46 | Issue 3 Article 4 5-2017 A Court Pure and Unsullied: Justice in the Justice Trial at Nuremberg Stephen J. Sfekas Circuit Court for Baltimore City, Maryland Follow this and additional works at: http://scholarworks.law.ubalt.edu/ublr Part of the Fourteenth Amendment Commons, International Law Commons, and the Legal History Commons Recommended Citation Sfekas, Stephen J. (2017) "A Court Pure and Unsullied: Justice in the Justice Trial at Nuremberg," University of Baltimore Law Review: Vol. 46 : Iss. 3 , Article 4. Available at: http://scholarworks.law.ubalt.edu/ublr/vol46/iss3/4 This Peer Reviewed Articles is brought to you for free and open access by ScholarWorks@University of Baltimore School of Law. It has been accepted for inclusion in University of Baltimore Law Review by an authorized editor of ScholarWorks@University of Baltimore School of Law. For more information, please contact [email protected]. A COURT PURE AND UNSULLIED: JUSTICE IN THE JUSTICE TRIAL AT NUREMBERG* Hon. Stephen J. Sfekas** Therefore, O Citizens, I bid ye bow In awe to this command, Let no man live Uncurbed by law nor curbed by tyranny . Thus I ordain it now, a [] court Pure and unsullied . .1 I. INTRODUCTION In the immediate aftermath of World War II, the common understanding was that the Nazi regime had been maintained by a combination of instruments of terror, such as the Gestapo, the SS, and concentration camps, combined with a sophisticated propaganda campaign.2 Modern historiography, however, has revealed the -

86A Stgb Im Spiegel Der Rechtsprechung
Wissenschaftliche Dienste Infobrief Das strafbare Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen § 86a StGB im Spiegel der Rechtsprechung Roman Trips-Hebert © 2014 Deutscher Bundestag WD 7 - 3010 - 028/14 Wissenschaftliche Dienste Infobrief Seite 2 WD 7 - 3010 - 028/14 Das strafbare Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen § 86a StGB im Spiegel der Rechtsprechung Verfasser: Oberregierungsrat Dr. Roman Trips-Hebert Aktenzeichen: WD 7 - 3010 - 028/14 Abschluss der Arbeit: 28. Februar 2014 Fachbereich: Fachbereich WD 7: Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Umweltschutzrecht, Verkehr, Bau und Stadtentwicklung Ausarbeitungen und andere Informationsangebote der Wissenschaftlichen Dienste geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Der Deutsche Bundestag behält sich die Rechte der Veröffentlichung und Verbreitung vor. Beides bedarf der Zustimmung der Leitung der Abteilung W, Platz der Republik 1, 11011 Berlin. Wissenschaftliche Dienste Infobrief Seite 3 WD 7 - 3010 - 028/14 Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 4 2. Tatbestand, Systematik und Geschichte 5 2.1. Tatbestand 5 2.2. Systematik 6 2.3. Geschichte 6 3. Detailbetrachtung und Rechtsprechung 7 3.1. Erfasste Organisationen 7 3.1.1. Vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärte Partei oder eine Partei oder Vereinigung, von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatzorganisation einer solchen Partei ist (§86Absatz1Nummer1StGB) 8 3.1.2. Vereinigung, die unanfechtbar verboten ist, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet, oder von der unanfechtbar festgestellt ist, dass sie Ersatzorganisation einer solchen verbotenen Vereinigung ist (§ 86 Absatz 1 Nummer 2 StGB) 8 3.1.3. Ehemalige nationalsozialistische Organisation (§ 86 Absatz 1 Nummer 4 StGB) 10 3.2. -

Cr^Ltxj
THE NAZI BLOOD PURGE OF 1934 APPRCWBD": \r H M^jor Professor 7 lOLi Minor Professor •n p-Kairman of the DeparCTieflat. of History / cr^LtxJ~<2^ Dean oiTKe Graduate School IV Burkholder, Vaughn, The Nazi Blood Purge of 1934. Master of Arts, History, August, 1972, 147 pp., appendix, bibliography, 160 titles. This thesis deals with the problem of determining the reasons behind the purge conducted by various high officials in the Nazi regime on June 30-July 2, 1934. Adolf Hitler, Hermann Goring, SS leader Heinrich Himmler, and others used the purge to eliminate a sizable and influential segment of the SA leadership, under the pretext that this group was planning a coup against the Hitler regime. Also eliminated during the purge were sundry political opponents and personal rivals. Therefore, to explain Hitler's actions, one must determine whether or not there was a planned putsch against him at that time. Although party and official government documents relating to the purge were ordered destroyed by Hermann GcTring, certain materials in this category were used. Especially helpful were the Nuremberg trial records; Documents on British Foreign Policy, 1919-1939; Documents on German Foreign Policy, 1918-1945; and Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1934. Also, first-hand accounts, contem- porary reports and essays, and analytical reports of a /1J-14 secondary nature were used in researching this topic. Many memoirs, written by people in a position to observe these events, were used as well as the reports of the American, British, and French ambassadors in the German capital. -

1. Evaluation of the Judicial Systems (2016-2018 Cycle) Germany Generated on : 29/08/2018 11:17
1. Evaluation of the judicial systems (2016-2018 cycle) Germany Generated on : 29/08/2018 11:17 Reference data 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016) Start/end date of the data collection campaign : 01/06/2017 - 31/12/2017 Objective : The CEPEJ decided, at its 28th plenary meeting, to launch the seventh evaluation cycle 2016 – 2018, focused on 2016 data. The CEPEJ wishes to use the methodology developed in the previous cycles to get, with the support of its national correspondents' network, a general evaluation of the judicial systems in the 47 member states of the Council of Europe as well as two observer states (Israel and Morocco). This will enable policy makers and judicial practitioners to take account of such unique information when carrying out their activities. The present questionnaire was adapted by the Working group on evaluation of judicial systems (CEPEJ-GT-EVAL) in view of the previous evaluation cycles and considering the comments submitted by CEPEJ members, observers, experts and national correspondents. The aim of this exercise is to increase awareness of judicial systems in the participating states, to compare the functioning of judicial systems in their various aspects, as well as to have a better knowledge of the trends of the judicial organisation in order to help improve the efficiency of justice. The evaluation questionnaire and the analysis of the results becomes a genuine tool in favour of public policies on justice, for the sake of the European citizens. Instruction : The ways to use the application and to answer the questions are guided by two main documents: -User manual -Explanatory note While the explanatory note gives definitions and explanations on the CEPEJ evaluation questionnaire and the methodology needed for replying, the User manual is a tool to help you navigate through this application. -

The Comparative Law of Flag Desecration: the United States and the Federal Republic of Germany, 15 Hastings Int'l & Comp
Hastings International and Comparative Law Review Volume 15 Article 2 Number 4 Summer 1992 1-1-1992 The ompC arative Law of Flag Desecration: The United States and the Federal Republic of Germany Peter E. Quint Follow this and additional works at: https://repository.uchastings.edu/ hastings_international_comparative_law_review Part of the Comparative and Foreign Law Commons, and the International Law Commons Recommended Citation Peter E. Quint, The Comparative Law of Flag Desecration: The United States and the Federal Republic of Germany, 15 Hastings Int'l & Comp. L. Rev. 613 (1992). Available at: https://repository.uchastings.edu/hastings_international_comparative_law_review/vol15/iss4/2 This Article is brought to you for free and open access by the Law Journals at UC Hastings Scholarship Repository. It has been accepted for inclusion in Hastings International and Comparative Law Review by an authorized editor of UC Hastings Scholarship Repository. For more information, please contact [email protected]. The Comparative Law of Flag Desecration: The United States and the Federal Republic of Germany By PETER E. QUINT* I. INTRODUCTION I In the American constitutional system, as in many others, freedom of speech generally is viewed as an individual right. Yet, even though the initial focus is on individuals, definition of this right often depends on the weight of governmental interests and the implications of related political and social structures. Because the relationship between speech and poli- tics is particularly close, the definition of "freedom of speech" is often intertwined with the underlying presuppositions of the political system and past or present assessments of its stability. This relationship between speech and political structures is particu- larly evident in the case of political speech, which may stir individuals and groups to action or which may exert a more subtle influence on the nature and continuity of political processes. -

The Debate Over Japan's Rising Sun Flag
NIDS コメンタリー第 89 号 The Debate over Japan’s Rising Sun Flag SHOJI Junichiro, Vice President for Academic Affairs No. 89, November 26, 2019 Introduction Korea, just as Germany proscribed the Nazi’s In October 2018, South Korea hosted an international predominant symbol, the swastika (known in German as fleet review off the coast of Jeju Island. Their navy the Hakenkreuz, or “hooked cross”). requested that the vessels of participating countries only In this article, I set aside the Japanese Government’s fly their national flag and the South Korean flag at the legal justifications for displaying the Kyokujitsuki. event. This request was chiefly targeted at Japan because Instead, I analyze a key narrative behind the controversy, South Korea wanted Japanese vessels to refrain from which equates the symbol to the Nazi swastika and flying the Kyokujitsuki, or “Rising Sun Flag,” which is identifies it as a “war crime flag.” the naval ensign of the Japan Maritime Self-Defense Force (JMSDF). 1 The Nazi Swastika: Symbolizing a Regime and its Ideology Japan refused to comply with the request. The Minister of Defense, Itsunori Onodera, replied, “Our naval vessels The swastika is an ancient Sanskrit symbol that can be must display the ensign under domestic laws, according traced back millennia. It has been prominently featured to the Self-Defense Forces Act. Moreover, the United in religions that originated in India, such as Hinduism Nations Convention on the Law of the Sea mandates that and Buddhism. However, in the late nineteenth and early warships must bear an external mark distinguishing the twentieth century, the swastika became entwined with ship’s nationality, and that’s exactly what the flag in nationalist movements, especially in Germany, where it question is.” Since South Korea was unconvinced by this symbolized the Aryan “master race.”1 In the 1920s, the argument, the succeeding Minister of Defense in Japan, Nazi Party adopted the swastika as its official flag.