Die Ära Kohl Ein Literaturbericht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Der Spiegel-Confirmation from the East by Brian Crozier 1993
"Der Spiegel: Confirmation from the East" Counter Culture Contribution by Brian Crozier I WELCOME Sir James Goldsmith's offer of hospitality in the pages of COUNTER CULTURE to bring fresh news on a struggle in which we were both involved. On the attacking side was Herr Rudolf Augstein, publisher of the German news magazine, Der Spiegel; on the defending side was Jimmy. My own involvement was twofold: I provided him with the explosive information that drew fire from Augstein, and I co-ordinated a truly massive international research campaign that caused Augstein, nearly four years later, to call off his libel suit against Jimmy.1 History moves fast these days. The collapse of communism in the ex-Soviet Union and eastern Europe has loosened tongues and opened archives. The struggle I mentioned took place between January 1981 and October 1984. The past two years have brought revelations and confessions that further vindicate the line we took a decade ago. What did Jimmy Goldsmith say, in 1981, that roused Augstein to take legal action? The Media Committee of the House of Commons had invited Sir James to deliver an address on 'Subversion in the Media'. Having read a reference to the 'Spiegel affair' of 1962 in an interview with the late Franz Josef Strauss in his own news magazine of that period, NOW!, he wanted to know more. I was the interviewer. Today's readers, even in Germany, may not automatically react to the sight or sound of the' Spiegel affair', but in its day, this was a major political scandal, which seriously damaged the political career of Franz Josef Strauss, the then West German Defence Minister. -
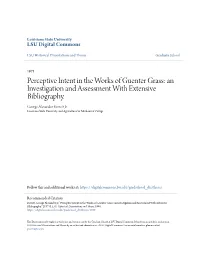
Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment with Extensive Bibliography
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1971 Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment With Extensive Bibliography. George Alexander Everett rJ Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Everett, George Alexander Jr, "Perceptive Intent in the Works of Guenter Grass: an Investigation and Assessment With Extensive Bibliography." (1971). LSU Historical Dissertations and Theses. 1980. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/1980 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. 71-29,361 EVERETT, Jr., George Alexander, 1942- PRECEPTIVE INTENT IN THE WORKS OF GUNTER GRASS: AN INVESTIGATION AND ASSESSMENT WITH EXTENSIVE BIBLIOGRAPHY. The Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, Ph.D., 1971 Language and Literature, modern University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. PRECEPTIVE INTENT IN THE WORKS OF GUNTER GRASS; AN INVESTIGATION AND ASSESSMENT WITH EXTENSIVE BIBIIOGRAPHY A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of Foreign Languages by George Alexander Everett, Jr. B.A., University of Mississippi, 1964 M.A., Louisiana State University, 1966 May, 1971 Reproduced with permission of the copyright owner. -

Central Europe
Central Europe West Germany FOREIGN POLICY wTHEN CHANCELLOR Ludwig Erhard's coalition government sud- denly collapsed in October 1966, none of the Federal Republic's major for- eign policy goals, such as the reunification of Germany and the improvement of relations with its Eastern neighbors, with France, NATO, the Arab coun- tries, and with the new African nations had as yet been achieved. Relations with the United States What actually brought the political and economic crisis into the open and hastened Erhard's downfall was that he returned empty-handed from his Sep- tember visit to President Lyndon B. Johnson. Erhard appealed to Johnson for an extension of the date when payment of $3 billion was due for military equipment which West Germany had bought from the United States to bal- ance dollar expenses for keeping American troops in West Germany. (By the end of 1966, Germany paid DM2.9 billion of the total DM5.4 billion, provided in the agreements between the United States government and the Germans late in 1965. The remaining DM2.5 billion were to be paid in 1967.) During these talks Erhard also expressed his government's wish that American troops in West Germany remain at their present strength. Al- though Erhard's reception in Washington and Texas was friendly, he gained no major concessions. Late in October the United States and the United Kingdom began talks with the Federal Republic on major economic and military problems. Relations with France When Erhard visited France in February, President Charles de Gaulle gave reassurances that France would not recognize the East German regime, that he would advocate the cause of Germany in Moscow, and that he would 349 350 / AMERICAN JEWISH YEAR BOOK, 1967 approve intensified political and cultural cooperation between the six Com- mon Market powers—France, Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg. -

6. Party Finance, Party Donations and Corruption the German Case 6.1
6. Party Finance, Party Donations and Corruption 1 The German Case Ulrich von Alemann 6.1. The Study of Corruption in Germany Some 30 years ago in Germany corruption was an almost unknown term in politics and political science referring only to the fall of old regimes in ancient times or to the rise of bizarre puppet governments in the postcolonial developing countries. “The Germans spoiled by an extremely honest public administration for more than a century and a half, are sensitive to charges of corruption even today”, Theodor Eschenburg, one of the leading senior scholars of German postwar political science declared in Heidenheimer’s first edition of his famous handbook on corruption (Eschenburg, 1970: 259). In the mid-eighties one of the first German political scientists publishing on corruption, Paul Noack, still maintained: “The Germans have always nurtured a faith that theirs is one of those nations that has proved to be most resistant to corruption” (Noack, 1985: 113). Those times are gone forever. During the eighties the Flick-scandal shocked German politics, but also a number of local and regional affairs exposed the myth of a civil service clear of corruption. Sociology, political science, history, law and economics started to discover the issue of corruption. A first big volume was by the Austrian researcher Christian Brünner (1981). The monograph of Paul Noack was followed by a reader of Christian Fleck and Helmut Kuzmics titled “Korruption. Zur Soziologie nicht immer abweichenden Verhaltens” (1985). At the end of the eighties I myself published my first short piece of corruption research in the second edition of Heidenheimer’s handbook on political corruption (von Alemann, 1989). -

'L'europe Oui, Maastricht Non' from Der Spiegel (14 September 1992)
'L'Europe oui, Maastricht non' from Der Spiegel (14 September 1992) Source: Der Spiegel. Das Deutsche Nachrichten-Magazin. Hrsg. AUGSTEIN, Rudolf ; Herausgeber DR. KADEN, Wolfgang; KILZ, Hans Werner. 14.09.1992, n° 38; 46. Jg. Hamburg: Spiegel Verlag Rudolf Augstein GmbH. "L'Europe oui, Maastricht non", auteur:Augstein, Rudolf , p. 168-169. Copyright: (c) Translation CVCE.EU by UNI.LU All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site. URL: http://www.cvce.eu/obj/l_europe_oui_maastricht_non_from_der_spiegel_14_septe mber_1992-en-51dee566-fbc0-4361-adb9-d4596f4ce11b.html Last updated: 06/07/2016 1/5 L’Europe oui, Maastricht non Rudolf Augstein If anyone wants to know why the battle over the Treaties of Maastricht has now degenerated into a round of scare mongering, they should take a look at what is currently happening in France. François Mitterrand speaks of a ‘battle that will be harder than I had expected’ when talking about the referendum that he himself has set for 20 September. His Prime Minister, Pierre Bérégovoy, is of the opinion that: A ‘no’ would lead to a division between France and Germany. The Germans would then regain their autonomy and, in future, look more to the East than to the West. The former Prime Minister, Michel Rocard, is quite blatant in immediately bringing up the heavy artillery: We must not make 20 September into another political Munich. He also feels obliged to protect Germany from ‘its demons’, while the Minister for Humanitarian Affairs, Bernard Kouchner, suggests that Helmut Kohl’s generation will be the last pro-European one in Germany, because it will be succeeded by the Rostock skinheads. -

Family Businesses in Germany and the United States Since
Family Businesses in Germany and the United States since Industrialisation A Long-Term Historical Study Family Businesses in Germany and the United States since Industrialisation – A Long-Term Historical Study Industrialisation since States – A Long-Term the United and Businesses Germany in Family Publication details Published by: Stiftung Familienunternehmen Prinzregentenstraße 50 80538 Munich Germany Tel.: +49 (0) 89 / 12 76 400 02 Fax: +49 (0) 89 / 12 76 400 09 E-mail: [email protected] www.familienunternehmen.de Prepared by: Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte Platz der Göttinger Sieben 5 37073 Göttingen Germany Univ.-Prof. Dr. Hartmut Berghoff Privatdozent Dr. Ingo Köhler © Stiftung Familienunternehmen, Munich 2019 Cover image: bibi57 | istock, Sasin Tipchai | shutterstock Reproduction is permitted provided the source is quoted ISBN: 978-3-942467-73-5 Quotation (full acknowledgement): Stiftung Familienunternehmen (eds.): Family Businesses in Germany and the United States since Indus- trialisation – A Long-Term Historical Study, by Prof. Dr. Hartmut Berghoff and PD Dr. Ingo Köhler, Munich 2019, www.familienunternehmen.de II Contents Summary of main results ........................................................................................................V A. Introduction. Current observations and historical questions ..............................................1 B. Long-term trends. Structural and institutional change ...................................................13 C. Inheritance law and the preservation -

Peer Heinelt Financial Compensation for Nazi
www.wollheim-memorial.de Peer Heinelt Financial Compensation for Nazi Forced Laborers Introduction . 1 Compensation for Nazi Forced Labor? Attempt at a Definition . 5 Compensation of Nazi Forced Laborers, 1945–1990 . 10 Supplement 1: The Compensation of Nazi Forced Laborers in the GDR . 28 The Compensation of Nazi Forced Laborers since 1990 . 31 Supplement 2: The Compensation of Nazi Forced Laborers in Austria . 42 Conclusion . 43 Norbert Wollheim Memorial J.W. Goethe-Universität / Fritz Bauer Institut Frankfurt am Main, 2010 www.wollheim-memorial.de Peer Heinelt: Financial Compensation for Nazi Forced Laborers, p. 1 Introduction After tough negotiations with the Conference on Jewish Material Claims against Germany, the Krupp Group made the following announcement on December 23, 1959: At least DM 6 million but no more than DM 10 million would be paid to former Jewish concentration camp prisoners who could show that they ―were employed in plants of Krupp or its subsidiaries during the war as a result of Na- tional Socialist actions‖; each entitled claimant would receive the sum of DM 5,000. The sole owner Alfried Krupp, according to the company newsletter, had ―resolved upon this agreement in order to make a personal contribution toward the healing of the wounds suffered in the war.‖ By his own admission, the agreement signified ―no recognition of any legal obligation,‖ but instead represented a charitable gesture, further emphasized by the announcement of the signing of the document one day before Christmas.1 The Claims Conference, however, had to guarantee that no legal actions against Krupp would be taken in the future with regard to compensation. -

Beschlußempfehlung Und Bericht Des 1
Deutscher Bundestag Drucksache 10/5079 10. Wahlperiode 21.02.86 Sachgebiet 1 Beschlußempfehlung und Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes zu dem Antrag der Fraktion der SPD — Drucksache 10/34 — Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und den Ergänzungsanträgen der Fraktion der SPD — Drucksache 10/520 — der Fraktionen der CDU/CSU und FDP — Drucksache 10/521 — Beschlußempfehlung Der Bundestag wolle beschließen. Der Bericht des 1. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgeset- zes wird zur Kenntnis genommen. Bonn, den 21. Februar 1986 Der 1. Untersuchungsausschuß Dr. Langner Bohl Dr. Struck Vorsitzender Berichterstatter Drucksache 10/5079 Deutscher Bundestag — 10. Wahlperiode Inhaltsübersicht Tz. Seite 1. Abschnitt: Verlauf des Verfahrens A. Einsetzung des Ausschusses und dessen Auftrag I. Einsetzungsbeschluß und Ergänzungsbeschlüsse 1 1 H. Verfahrensregeln 2 2 III. Mitglieder des 1. Untersuchungsausschusses 3 2 B. Vorgeschichte und Parallelverfahren I. Vorgeschichte 4 3 II. Parallelverfahren 5 3 C. Ablauf des Untersuchungsverfahrens I. Konstituierung 6 4 II. Beweisaufnahme 4 1. Zeit- und Arbeitsaufwand 7 4 2. Vorbereitung der Beweisaufnahme 8 4 3. Aktenbeiziehung 9 4 4. Auskünfte, Berichte und Stellungnahmen 10 7 5. Zeugenvernehmung 11 7 6. Reichweite des Untersuchungsauftrags 12 8 III. Berichtsfeststellung 13 8 2. Abschnitt: Festgestellter Sachverhalt A. Überblick I. Verkauf der Aktien und Wiederanlage des Verkaufserlöses 14 9 II. Überblick über die Flick-Anträge 15 9 III. Steuerbegünstigung nach § 6b EStG und § 4 AIG; Bescheinigungsver- fahren und beteiligte staatliche Stellen 10 1. § 6b EStG 16 10 2. § 4 AIG 17 11 3. Der rechtliche Charakter der Entscheidung nach § 6b EStG und § 4 AIG 18 13 4. Bescheinigungspraxis 19 13 IV. Wichtige beteiligte Personen des Flick-Konzerns und beteiligte Amts- träger 14 1. -

Hanns Martin Schleyer-Stiftung Gemeinsam Mit Dem Bundespräsidenten Veröffentlichungen Der Hanns Martin Schleyer-Stiftung Band 91 Aus Anlass Des 40
Hanns Martin Schleyer-Stiftung gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Veröffentlichungen der Hanns Martin Schleyer-Stiftung Band 91 Aus Anlass des 40. Todestages von Hanns Martin Schleyer zum Gedenken und Nachdenken: Die Freiheit verteidigen, die Demokratie stärken – eine bleibende Heraus forderung 18. Oktober 2017 im Schloss Bellevue Hanns Martin Schleyer-Stiftung gemeinsam mit dem Bundespräsidenten Herausgegeben von Barbara Frenz Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme. Ein Titeldaten- satz für die Publikation ist bei der Deutschen Bibliothek erhält- lich. ISBN: 978-3-9809206-8-1 © 2017 Hanns Martin Schleyer-Stiftung Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberschutzgesetzes ist ohne Zustimmung der Hanns Martin Schleyer-Stiftung unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Satz: Mazany – Werbekonzeption und Realisation, Düsseldorf Printed in Germany Inhalt Ansprache Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier . 13 Grußwort Wilfried Porth . 23 Historische Einführung Stefan Aust . .29 Podiums- und Saaldiskussion . 39 Teilnehmende auf dem Podium: Stefan Aust Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank Prof. Dr. Renate Köcher Prof. Dr. Andreas Rödder Moderation: Ina Baltes Worte zum Ende der Gedenkveranstaltung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier . 67 Anhang: Redaktionelle Nachbemerkung . 73 Veröffentlichungen der Hanns Martin Schleyer-Stiftung. 74 Leitung Barbara Frenz Hanns Martin Schleyer-Stiftung 7 Ansprache des Bundespräsidenten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Lieber Hanns-Eberhard Schleyer, verehrte Familie Schleyer, verehrte Angehörige der Mordopfer der RAF, die Sie heute zu uns gekommen sind, Abgeordnete, verehrte Ministerpräsidenten Vogel und Biedenkopf, verehrter Herr Porth, Freunde und Förderer der Hanns Martin Schleyer-Stiftung, meine sehr verehrten Damen und Herren, Mord verjährt nicht. -

CCC Volume 25 Issue 1 Cover and Back Matter
FORTHCOMING Volume 25 Number 2 1992 ARTICLES Rethinking the Categories of the German Revolution of 1848: The Emergence of Popular Conservatism in Bavaria James F. Harris The Political Calculus of Capital: Banking and the Business Class in Prussia, 1848-1856 James M. Brophy The End of the "Final Solution"?: Nazi Plans to Ransom Jews in 1944 Richard Breitman and Shlomo Aronson Rehearsal for "Reinhard"?: Odilo Globocnik and the Lublin Selbstschutz Peter R. Black BOOK REVIEWS England and the German Hanse, 1157-1611: A Study of Their Trade and Commercial Diplomacy, by T. H. Lloyd (Herbert H. Kaplan) Frauen und Dissens: Frauen im Deutschkatholizismus und in den freien Gemeinden, 1841-1852, by Sylvia Paletschek Gonathan Sperber) Von Heidelberg nach Berlin: Friedrich Ebert 1871-1905, by Ronald A. Muench (William Carl Mathews) Fields of Knowledge. French Academic Culture in Comparative Perspective, 1890-1920, by Fritz Ringer (Charles E. McClelland) A Nation of Provincials. The German Idea of Heimat, by Celia Applegate (James H. Jackson, Jr.) On Socialists and "The Jewish Question" after Marx, by Jack Jacobs (Albert S. Lindemann) Genoa, Rapallo, and European Reconstruction in 1922, by Carol Fink, Axel Frohn, and Jiirgen Heideking, eds. Appeasing Fascism: Articles from the Wayne State University Conference on Munich after Fifty Years, by Melvin Small and Otto Feinstein, eds. (A. J. Nicholls) Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.202.226, on 27 Sep 2021 at 00:07:38, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://doi.org/10.1017/S0008938900019671 FORTHCOMING (cont.) On Heidegger's Nazism and Philosophy, by Tom Rockmore (Peter Bergmann) The Racial State: Germany 1933-1945, by Michael Burleigh and Wolfgang Wippermann (Lawrence D. -

'The Moment of Truth' from Der Spiegel (24 June 1985)
'The moment of truth' from Der Spiegel (24 June 1985) Source: Der Spiegel. Das Deutsche Nachrichten-Magazin. Hrsg. AUGSTEIN, Rudolf ; Herausgeber BÖHME, Erich; ENGEL, Johannes K. 24.06.1985, n° 26; 39. Jg. Hamburg: Spiegel Verlag Rudolf Augstein GmbH. "Stunde der Wahrheit", p. 22-24. Copyright: (c) Translation CVCE.EU by UNI.LU All rights of reproduction, of public communication, of adaptation, of distribution or of dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries. Consult the legal notice and the terms and conditions of use regarding this site. URL: http://www.cvce.eu/obj/the_moment_of_truth_from_der_spiegel_24_june_1985- en-c17b097e-eedb-4f04-8094-d0b98f482bd5.html Last updated: 06/07/2016 1/3 The moment of truth Helmut Kohl is facing the most unpleasant summit of his Chancellorship At the end of this week, nine of the ten EC Heads of State or Government will be setting off on quite a pleasant journey. Even before boarding their jets to fly to the EC Summit in Milan, the nine already know whom to blame for the failure of the Summit: Chancellor Helmut Kohl. Mr Kohl had hoped that, together with the French President, François Mitterrand, he could make a bold bid in Milan to move Europe forward. The right of veto of individual Member States was to be abolished so as to make way for majority decisions. But then, two weeks ago, the Germans of all people wielded the big stick of the veto in order to prevent a risible 1.8 % reduction in cereals prices. So it is now virtually impossible for the Milan Summit to succeed. -

Lutz Hachmeister Schleyer Eine Deutsche Geschichte C. H. Beck Verlag München 2004 ISBN 3-406-51863-X
Translated excerpts Translated Translated excerpts from: Lutz Hachmeister Schleyer Eine deutsche Geschichte C. H. Beck Verlag München 2004 ISBN 3-406-51863-X pp. 9-15, 132-136 and 252-257 Lutz Hachmeister Schleyer A German Story Translated by Philip Schmitz © Litrix.de 2004 Contents 1 Introduction 2 The Son of the Judge Youth and Political Imprinting 39 • The Father 44 • School Days and Entry into the Hitler Youth 57 • Stromer II. – A Member of “Teutonia” in Rastatt 68 • An SA Obergruppenführer as Father-in-Law 72 3 The Nazi Student Leader “University Revolution” in Heidelberg 79 • Conquering the School of Law 81 • The National Socialist University Revolution 86 • The Militant Fraternity Brothers: Gustav Adolf Scheel and Comrades 89 • The “Heidelberg Line” 100 • Schleyer As a Member of “Suevia” 105 • “The Blood and the Strength and the Self-confidence” 113 • An Affair in Freiburg 127 • Schleyer’s Ideas on “Political Education” 132 • The Heidelberg Student Convention of 1937 136 • Langemarck 140 • Working for the Student Association 145 • In Innsbruck 154 • The Conflict Concerning Legal Training 159 4 An Expert in Prague German Rule in “Bohemia and Moravia” 165 • The Protectorate and the SS 167 • A Mountain Trooper in France 173 • Student Politics and Working for the Student Association in Prague 176 • The Central Federation of Industry in Bohemia and Moravia 187 • Schleyer’s Mentor: Bernhard Adolf 190 • The Aryanization and Germanization of Czech Industry 193 • Adolf’s Germanization Program 198 • Reinhard Heydrich 199 • Friedrich Kuhn-Weiss 209 • The War Economy: “Rationalization” and “Labor Allocation” 212 • Escape from Prague 224 5 A Career in a Global Corporation From Internment to Rising at Daimler-Benz 227 • A Career Begins Anew 239 • Starting Out at Daimler 242 • Daimler-Benz during the Reconstruction Years 243 • The Backer: Fritz Könecke 247 • The Personnel Manager 252 • Schleyer and South America 257 • General Manager Walter Hitzinger, The Luckless Linzer 263 • The Duel, Schleyer vs.