Dissertation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Unesco Weltkulturerbe Graz Managementplan 2013
UNESCO 2013 WELTKULTURERBE GRAZ MANAGEMENTPLAN City of Graz - Historic Centre and Schloss Eggenberg World Heritage since 1999, 2010 UNESCO 2013 WELTKULTURERBE GRAZ MANAGEMENTPLAN City of Graz - Historic Centre and Schloss Eggenberg World Heritage since 1999, 2010 IMPRESSUM: Herausgeber: Stadt Graz, Stadtbaudirektion/Weltkulturerbe Koordination | Europaplatz 20, 8011 Graz, [email protected], www.graz.at | Projektleitung: DI Mag. Bertram Werle, Mag. Daniela Freitag | Redaktion: DI Christian Probst, Dr. Astrid Wentner, Mag. Daniela Freitag | Autoren Kapitel IV.: Dr. Wiltraud Resch, Arch. DI Christian Andexer | Mitarbeit & Lektorat: Internationales Städteforum in Graz; Handbuchstruktur: DI Andreas Ledl | Grafische Gestaltung: Taska | Druck: Medienfabrik Graz | Auflage: 1000 Exemplare | © Stadt Graz 2013. INHALT Seite Vorwort 6 I. EINLEITUNG ZUM WELTKULTURERBE-MANAGEMENTPLAN 2013 7 1. Projektauftrag 8 2. Grundsätze und Ziele 9 3. Der Managementplan – Aufbau und Inhalt 10 4. Realisierung und Implementierung 11 II. EINRICHTUNGEN & INSTITUTIONEN IM BEREICH DES WELTERBES 13 1. UNESCO 14 2. Welterbe in Österreich 16 1. Republik Österreich – Bund 16 2. Österreichische UNESCO-Kommission 17 3. Österreichisches Nationalkomitee des Internationalen Rates für Denkmalpflege 18 4. Internationales Städteforum in Graz 18 3. Welterbe in Graz 19 III. WELTKULTURERBESTÄTTE STADT GRAZ – HISTORISCHES ZENTRUM & SCHLOSS EGGENBERG 21 1. Umfang und Lage der Weltkulturerbestätte 22 2. Begründung der Aufnahme in die Welterbeliste 23 IV. BEFUND & HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN – MASTERPLAN 25 1. Einleitung 26 2. Kunsthistorischer Befund der Weltkulturerbestätte Graz 27 1. Einleitung und Übersicht 27 2. Befund und Beschreibung der historischen Viertel 29 3. Handlungsempfehlungen 65 1. Masterplan Struktur und Aufbau 65 2. Kategorisierung der Handlungszonen samt Handlungsempfehlungen 65 V. WELTKULTURERBE KOORDINATIONSSTELLE (WKE-STELLE) 95 1. Struktur 96 2. Aufgaben der WKE-Stelle 96 3. -
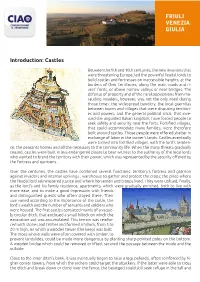
Introduction: Castles
Introduction: Castles Between the 9th and 10th centuries, the new invasions that were threatening Europe, led the powerful feudal lords to build castles and fortresses on inaccessible heights, at the borders of their territories, along the main roads and ri- vers’ fords, or above narrow valleys or near bridges. The defense of property and of the rural populations from ma- rauding invaders, however, was not the only need during those times: the widespread banditry, the local guerrillas between towns and villages that were disputing territori- es and powers, and the general political crisis, that inve- sted the unguided Italian kingdom, have forced people to seek safety and security near the forts. Fortified villages, that could accommodate many families, were therefore built around castles. Those people were offered shelter in exchange of labor in the owner’s lands. Castles eventually were turned into fortified villages, with the lord’s residen- ce, the peasants homes and all the necessary to the community life. When the many threats gradually ceased, castles were built in less endangered places to bear witness to the authority of the local lords who wanted to brand the territory with their power, which was represented by the security offered by the fortress and garrisons. Over the centuries, the castles have combined several functions: territory’s fortress and garrison against invaders and internal uprisings ; warehouse to gather and protect the crops; the place where the feudal lord administered justice and where horsemen and troops lived. They were utilised, finally, as the lord’s and his family residence, apartments, which were gradually enriched, both to live with more ease, and to make a good impression with friends and distinguished guests who often stayed there. -

Wine Menu (PDF)
Wine Menu Wine Philosophy Exploration, Discovery, Enrichment. In this order, many of the notable moments in life transpire. We have curated a collection of wines with this philosophy in mind. Within each varietal, you will find a selection that not only affords you the familiar, but, if you wish to explore, there is a selection that encompasses the noteworthy and often the exceptional, usually at an unrivaled value. Enjoy. About Our Wine To aid with your selection, the wines on this progressive list are grouped in flavor categories. Wines with similar profiles are listed in a simple sequence, starting with those that are sweeter and very mild in flavor, progressing to wines that are drier and more full-bodied in taste. Wine Types B BIODYNAMIC Wine produced according to biodynamic principles, which state that agriculture should be conducted in tune with basic forces of nature, both terrestrial and celestial O ORGANIC Wine produced by organic viticulture avoiding synthetic treatments, chemical pesticides, herbicides and fertilizers V VEGAN Wine that has been fined with no animal substances or that has not been fined at all PRINCESS RECOMMENDED Wine selections of unusual quality and value Sparkling Wines & Champagnes GLASS BOTTLE BIN 5 Domaine Ste. Michelle Brut 35 Washington 10 Prunotto Moscato d'Asti 38 Piedmont, Italy 15 Mionetto Prosecco Brut Gold 11 40 Veneto, Italy 20 Domaine Chandon Brut 44 California In 1973, Chandon established the first French winery in Napa Valley, using centuries-old winemaking techniques to create the finest range of premium sparkling wines in America. Brut classic is refreshing, elegant and easy to sip and share. -

Lowell Libson Limited
LOWELL LI BSON LTD 2 0 1 0 LOWELL LIBSON LIMITED BRITISH PAINTINGS WATERCOLOURS AND DRAWINGS 3 Clifford Street · Londonw1s 2lf +44 (0)20 7734 8686 · [email protected] www.lowell-libson.com LOWELL LI BSON LTD 2 0 1 0 Our 2010 catalogue includes a diverse group of works ranging from the fascinating and extremely rare drawings of mid seventeenth century London by the Dutch draughtsman Michel 3 Clifford Street · Londonw1s 2lf van Overbeek to the small and exquisitely executed painting of a young geisha by Menpes, an Australian, contained in the artist’s own version of a seventeenth century Dutch frame. Telephone: +44 (0)20 7734 8686 · Email: [email protected] Sandwiched between these two extremes of date and background, the filling comprises Website: www.lowell-libson.com · Fax: +44 (0)20 7734 9997 some quintessentially British works which serve to underline the often forgotten international- The gallery is open by appointment, Monday to Friday ism of ‘British’ art and patronage. Bellucci, born in the Veneto, studied in Dalmatia, and worked The entrance is in Old Burlington Street in Vienna and Düsseldorf before being tempted to England by the Duke of Chandos. Likewise, Boitard, French born and Parisian trained, settled in London where his fluency in the Rococo idiom as a designer and engraver extended to ceramics and enamels. Artists such as Boitard, in the closely knit artistic community of London, provided the grounding of Gainsborough’s early In 2010 Lowell Libson Ltd is exhibiting at: training through which he synthesised -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Kunst hat ihren Preis Ökonomische Aspekte der österreichischen Künstlerlandschaft in der frühen Neuzeit unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfeldes Verfasserin Katrin Elisabeth Leisch angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, September 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A315 Studienrichtung lt. Studienblatt: Kunstgeschichte Betreuer: Ao. Univ.- Prof. Dr. Peter Fidler INHALTSVERZEICHNIS 1. Vorwort................................................................................. 5 2. Einblick in das Österreich der frühen Neuzeit ...................... 7 2.1. Herrscher und Kriege ...........................................................................8 2.1.1. Die Habsburger – das Leben am Hof ...................................................8 2.1.2. Kriege und Unruhen – von den Bauernaufständen, dem Dreißigjährigen Krieg und der Türkenbelagerung Wiens....................12 2.2. Gesellschaftsstruktur – der Adel, das Bürgertum und die Bauern ......16 2.3. Religion – von der Reformation zur Gegenreformation ......................20 3. Wirtschaft, Handel und Geldwert........................................ 23 3.1. Geldwert, Preise und Löhne...............................................................24 3.1.1. Verdienst am Beispiel eines Maurergesellen......................................25 3.1.2. Preise von Lebensmitteln ...................................................................26 4. Vom Handwerker zum (Hof-)Künstler ................................ 28 -
![[Innsbruck,] Sunday Night, Probably the 17Th](https://docslib.b-cdn.net/cover/9039/innsbruck-sunday-night-probably-the-17th-919039.webp)
[Innsbruck,] Sunday Night, Probably the 17Th
0149. LEOPOLD MOZART TO HIS WIFE , SALZBURG [Innsbruck,] Sunday night, probably the 17 th December , [1769] I have no current calendar anymore. After I announced myself by my hired servant, 1 His Excellency Count Spaur 2 |: the brother of our Cathedral Canon 3 in Salzburg :| not only immediately sent a message via his servant, [5] with his compliments, that his coach would bring me to him at 2 o’clock on Saturday afternoon, but also, along with his spouse, received me graciously and placed his coach at my service, an offer of which I then also made use. Early on Sunday, [10] I received a note from him in which he invited us to a concert at 5 o’clock, to take place at the home of His Excellency Count Leopold Künigl. 4 In the meantime, I made use of his coach, drove twice to Herr von Kalckhammer, 5 then to Baron Cristani ,6 where I chatted about all kinds of things for 3 quarters of an hour, then to His Excellency Baron Enzenberg 7 and finally, at 5 o’clock, to the concert . Wolfgang was given a very beautiful concerto , which he played there prima vista .8 [15] We were received, as usual, with all honours, and then accompanied home by His Excellency Count Spauer personally. In short, we are entirely satisfied. Tomorrow I intend to pack everything, which will go all the faster since I have not unpacked very much and on Tuesday, if God will, I intend to set off. [20] I send my most humble thanks to Herr von Schidenhofen, 9 both for the letter of recommendation he sent and for the apology which he kindly made on my behalf and which is also entirely founded. -

Baroque Architecture in the Former Habsburg Residences of Graz and Innsbruck
EMBODIMENTS OF POWER? Baroque Architecture in the Former Habsburg Residences of Graz and Innsbruck Mark Hengerer Introduction Having overcome the political, religious, and economic crisis of the Thirty Years' War, princes in central Europe started to reconstruct their palaces and build towns as monuments of power. Baroque residences such as Karlsruhe combine the princely palace with the city, and even the territory, and were considered para digms of rule in the age of absolutism.' In Austrian Vienna, both the nobility and the imperial family undertook reshaping the city as a baroque residence only after the second Ottoman siege in 1683. Despite the Reichsstif of Emperor Karl VI, the baroque parts of the Viennese Hofburg and the baroque summer residence of Sch6nbrunn were executed as the style itself was on the wane, and were still incomplete in the Enlightenment period.2 It may be stated, then, that the com plex symbolic setting of baroque Viennese architecture reveals the complex power relations between the House of Habsburg and the nobility, who together formed a SOft of "diarchy," so that the Habsburgs did not exercise absolutist rule. 3 Ad ditionally, it cannot be overlooked that the lower nobility and burghers, though hardly politically influential, imitated the new style, which was of course by no means protected by any sort of copyright.4 For all these reasons, reading baroque cities as embodiments of powers is prob lematic. Such a project is faced with a phenomenon situated between complex actual power relations and a more or less learned discourse on princely power and 10 architecture (which was part of the art realm as well), and princes, noblemen, and citizens inspired to build in the baroque style. -

Universalmuseum Joanneum Comunicato Stampa Il Castello Di
Universalmuseum Joanneum Comunicato stampa Universalmuseum Joanneum [email protected] Mariahilferstraße 4, 8020 Graz, Austria Telefono +43-664-2061723 www.museum-joanneum.at Il castello di Eggenberg Il complesso del castello di Eggenberg costituisce un’incomparabile opera d’arte risalente al primo Barocco. Struttura ed interni si fondono in una complessa rappresentazione simbolica dell’universo: la dimora terrena di un uomo di stato colto e potente. La residenza del governatore imperiale Hans Ulrich von Eggenberg è architettura politica, pretenziosa legittimazione del dominio di una famiglia. La storia dell’edificio: da residenza principesca a museo universale L’ascesa di Hans Ulrich von Eggenberg a statista di levatura europea sotto il regno dell’imperatore Ferdinando II sollevò l’esigenza di ristrutturare la proprietà di famiglia, collocata nella zona ovest di Graz, trasformandola da provinciale dimora medievale in residenza degna di rivestire le più alte funzioni di rappresentanza. A partire dal 1625, dunque, si venne sviluppando un complesso in grado di esprimere debitamente il nuovo rango del padrone di casa. Eckhenberg: la residenza di famiglia sugli Algersdorfer Felder. Balthasar Eggenberger acquistò l’antica magione sui cosiddetti Algersdorfer Felder, ad un miglio dalla città residenziale di Graz, nel 1460. Negli anni successivi egli diede inizio a lavori di ampliamento e ristrutturazione della dimora nobiliare fortificata. Sul suo aspetto a quest’epoca poco si sa. Certo è che doveva disporre di una torre a pianta quadra e di un edificio a forma di L. Prima ancora del 1470 nella torre fu creata una piccola cappella dedicata alla Madonna, dotata di un prezioso altare con polittico. -

Landesmuseum Joanneum Graz Jahresbericht
©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at LANDESMUSEUM JOANNEUM GRAZ JAHRESBERICHT 1982 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at 2 Abteilung für Mineralogie LandesmuseumJoanneum Raub© rgçisee 10 A-8010 Graz, AUSTRIA ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at LANDESMUSEUM JOANNEUM GRAZ, JAHRESBERICHT 1982 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at LANDESMUSEUM JOANNEUM GRAZ JAHRESBERICHT 1982 NEUE FOLGE 12 - GRAZ 1983 ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at Nach den Berichten der Abteilungen redigiert von Eugen B r eg a n t und Dr. Detlef E rn et Graz 1983 Herausgegeben von der Direktion des Steiermärkischen Landesmuseums Joanneum, Raubergasse 10/1, A-8010 G raz Direktor: Dr. Friedrich W aidacher Gesamtherstellung: Buch- und Offsetdruckerei Styria, Judenburg Gesetzt aus Sabon — Berthold ©Digitalisierung Biologiezentrum Linz; download www.zobodat.at Inhalt Kuratorium 7 Bautätigkeit und Einrichtung 11 Sonderausstellungen 13 Veranstaltungen 19 Besuchsstatistik 1982 25 Verkäufliche Veröffentlichungen 27 Verkäufliche Diapositive und Bildpostkarten 33 Berichte Direktion 35 Referat für Jugendbetreuung 39 Abteilung für Geologie, Paläontologie und Bergbau 44 Abteilung für Mineralogie 51 Abteilung für Botanik 60 Abteilung für Zoologie 70 Abteilung für Vor- und Frühgeschichte und Münzensammlung 82 Abteilung für Kunstgewerbe 89 Landeszeughaus 95 Alte Galerie 101 Neue Galerie 105 Steirisches Volkskundemuseum 111 Außenstelle Stainz 116 Jagdmuseum 120 Abteilung Schloß Eggenberg 126 Landschaftsmuseum Schloß Trautenfels 134 Bild- und Tonarchiv 137 Beiträge K. R. Lorenz: Das geistige Erbe Erzherzog Johanns. Überlegungen zum Erzherzog-Johann-Gedenkjahr 145 F. Ebner: Erfahrungen mit der Wanderausstellung „Fossilien in der Steiermark — 500 Millionen Jahre Erdgeschichte“ 149 Z. -

Konsekrationsberichte Aus Dem Protokoll Der Diözese Seckau
QUELLEN ZUR GESCHICHTLICHEN LANDESKUNDE DER STEIERMARK Band 24 Herausgegeben von der Historischen Landeskommission für Steiermark Quellen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark Band 24 Herausgegeben von der Historischen Landeskommission für Steiermark Oskar Veselsky (Bearb.) Die Konsekrationsberichte aus dem Weihebuch der Diözese Seckau von 1680–1758 Dieses Werk ist nicht im Buchhandel erhältlich, steht aber im Sinne des open access kostenlos online unter www.hlkstmk.at zur Verfügung Version 2 – Juni 2013 Graz 2013 Im Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark Version 2 – Juni 2013 Graz 2013 Im Selbstverlag der Historischen Landeskommission für Steiermark A-8010 Graz, Karmeliterplatz 3 www.hlkstmk.at Satz: HLK Die Herausgabe dieser Veröffentlichung erfolgt ohne wirtschaftliche Gewinnabsicht, sondern vielmehr im Sinne der in den Statuten der Historischen Landeskommission für Steiermark festgelegten wissenschaftlichen Aufgaben. Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendung, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder ähnlichem Wege, der Wiedergabe im Internet und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. ISBN 978-3-901251-37-5 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort ...................................................................................................................................... 7 Einleitung .................................................................................................................................. -

OLD MASTER PAINTINGS Wednesday 4 July 2018
OLD MASTER PAINTINGS Wednesday 4 July 2018 BONHAMS OLD MASTERS DEPARTMENT Andrew McKenzie Caroline Oliphant Lisa Greaves Director, Head of Department, Group Head of Pictures Department Director London London and Head of Sale London – – – Poppy Harvey-Jones Brian Koetser Bun Boisseau Junior Specialist Consultant Junior Cataloguer, London London London – – – Mark Fisher Madalina Lazen Director, European Paintings, Senior Specialist, European Paintings Los Angeles New York Bonhams 1793 Limited Bonhams International Board Bonhams UK Ltd Directors – – Registered No. 4326560 Robert Brooks Co-Chairman, Colin Sheaf Chairman, Gordon McFarlan, Andrew McKenzie, Registered Office: Montpelier Galleries Malcolm Barber Co-Chairman, Harvey Cammell Deputy Chairman, Simon Mitchell, Jeff Muse, Mike Neill, Montpelier Street, London SW7 1HH Colin Sheaf Deputy Chairman, Antony Bennett, Matthew Bradbury, Charlie O’Brien, Giles Peppiatt, India Phillips, Matthew Girling CEO, Lucinda Bredin, Simon Cottle, Andrew Currie, Peter Rees, John Sandon, Tim Schofield, +44 (0) 20 7393 3900 Patrick Meade Group Vice Chairman, Jean Ghika, Charles Graham-Campbell, Veronique Scorer, Robert Smith, James Stratton, +44 (0) 20 7393 3905 fax Jon Baddeley, Rupert Banner, Geoffrey Davies, Matthew Haley, Richard Harvey, Robin Hereford, Ralph Taylor, Charlie Thomas, David Williams, Jonathan Fairhurst, Asaph Hyman, James Knight, David Johnson, Charles Lanning, Grant MacDougall Michael Wynell-Mayow, Suzannah Yip. Caroline Oliphant, Shahin Virani, Edward Wilkinson, Leslie Wright. OLD MASTER -

W Wesentl Liche in Nformat Tionen
Wesentliche Informationen zu den offiziellen Repräsentationsräumlichkeiten des Landes Steiermark Vorwort Als Fortführung und Ergänzung unserer Reihe „Protokollarische Richtlinien“ werden nach der „Darlegung gewisser Form-Erfordernisse“ bei offiziellen Anlässen in der vorliegenden Broschüre nunmehr die Repräsentations-Räumlichkeiten des Landes Steiermark vorgestellt. Neben den bereits seit längerer Zeit zu Repräsentationszwecken genutzten Örtlichkeiten Weißer Saal, Palais Attems und Schloss Eggenberg wurde in den Jahren 2005 und 2006 nicht nur die Orangerie im Burggarten renoviert und für Veranstaltungen zugänglich gemacht, auch die Aula der seit dem 16. Jahrhundert bestehenden Jesuiten-Universität konnte nach 100-jähriger Nutzung als Archiv in einen glanzvollen Repräsentationsraum verwandelt werden. Wir hoffen, dass Ihnen das Dokument einen Überblick über die repräsentativen Veranstaltungs-Räumlichkeiten und die große Kunst der Erbauer derselben gibt. Exemplare können jederzeit bei unserer Dienstelle angefordert werden. HR Mag. Michael Tiefengruber Protokoll, Veranstaltungen und Auszeichnungen Amt der Steiermärkischen Landesregierung Herausgeber: Amt der Steiermärkischen Landesregierung Referat für Protokoll, Veranstaltungen und Auszeichnungen 8010 Graz-Burg, Tel. Nr.: (0316) 877 – 2507 Alles Wissenswerte über Ehrenzeichen, Landeswappen, Titel, Rangfolgen etc. ist der Homepage unseres Referats zu entnehmen: www.protokoll.steiermark.at Druck: Abteilung 2 INHALTSVERZEICHNIS 1. Die Alte Universität...........................................................