Querschnitt 200 5
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Kidnapping Is Booming Business
Colophon Published by IKV Pax Christi, July 2008 Also printed in Dutch and Spanish Address P.O. Box 19318 3501 DH UTRECHT The Netherlands www.ikvpaxchristi.nl [email protected] Circulation 300 copies Text IKV Pax Christi Marianne Moor Simone Remijnse With the cooperation of: Fundación País Libre, Ms. Olga Lucía Gómez Fundación País Libre, Ms. Claudia M. Llano Rodrigo Rojas Orozco Mauricio Silva Peer van Doormalen Paul Wolters Bart Weerdenburg Sarah Lachman Annemieke van Breukelen Carolien Groeneveld ISBN 978-90-70443-41-2 Design & Print Van der Weij BV Netherlands Contents Introduction 3 1 Growth on all fronts: kidnapping in a global context 5 1.1.. A study of kidnapping worldwidel 5 1.2. Kidnapping in the 21st century; risers and fallers 5 1.3. A tried and tested weapon in the struggle 7 1.4. A profitable sideline that delivers fast 7 1.5. The middle classes protest 8 1.6. The heavy hand used selectively 8 2. Kidnapping in the regions 11 2.1. Africa 11 2.1.1. Nigeria 12 2.2. Asia 12 2.3. The Middle East 15 2.3.1. Iraq 15 2.4. Latin America 16 2.4.1. A wave of kidnapping in the major cities 17 2.4.2. Central America: maras and criminal gangs 18 2.4.3. The Colombianization of Mexico and Trinidad &Tobago 18 2.4.4. Kidnapping and the Colombian conflict 20 3. The regionalization of a Colombian practice: 25 kidnapping in Colombia, Ecuador and Venezuela 3.1. The kidnapping problem: 1995 – 2001 25 3.2. -

Look Beyond One's Own Nose
Media profile: Quotation ranking Look beyond one’s own nose Results of the 2005 Media Tenor only hand out information to news agencies and colleagues when it is relevant”, says the deputy quotation ranking chief editor Ursula Weidenfeld in a Media Tenor interview. Yet it will be a challenge to live up to www.agma-mmc.de he four print media outlets with the broadest such standards and still play a role within the jour- www.ma-reichweiten.de T circulation scored highest in the 2005 Media nalists’ community. It is true that the quick scoop Tenor quotation ranking: Der Spiegel, Bild, Bild always generates quotes, even when it is based am Sonntag and Focus were in a class of their on poor fact-checking and later turns out to be an own when it came to their signifi cance as a source outright falsehood or at least doubtful. But in the of information for journalists of other media. They worst case scenario, it also damages the image, as were quoted 5,895 times in 39 media outlets ana- the New York Times has had to learn repeatedly lyzed by Media Tenor, which corresponds to a in the past. 13.2% share of all the 44,655 quotations analyzed (graph 1). Once again, Der Spiegel was by far The trend: Internationalization the most important agenda setter with 5% of all The New York Times was quoted more frequent- quotations in the German media. ly in 2005 than in the previous year, however, it wasn’t enough for the fi rst position among the in- The recipe: relevance instead of reach ternational media outlets that were most frequently The ranking also shows that the attention of fel- quoted by German print, television and radio jour- low-journalists for a certain topic does not only nalists (graph 3). -
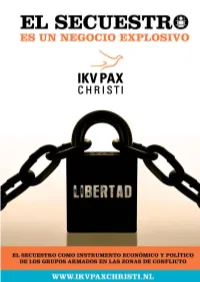
Esp Brochure:Opmaak 1
Contenido Introducción 3 1. Aumento en todos los frentes: 5 La problemática del secuestro en un contexto mundial 1.1. Una investigación sobre los secuestros a nivel mundial 5 1.2. Secuestros en el siglo 21: aumentos y descensos 5 1.3. Un arma probada en la lucha 7 1.4. Una fuente de ingresos (adicionales) muy productiva y rápida 7 1.5. La clase media protesta 8 1.6. La mano dura aplicada selectivamente 9 2. El secuestro en las distintas regiones del mundo 11 2.1. África 11 2.1.1. Nigeria 12 2.2. Asia 13 2.3. Medio Oriente 15 3.1. Irak 16 2.4. Latinoamérica 17 2.4.1. Una ola de secuestros en las grandes ciudades 17 2.4.2. Centroamérica: maras y bandas criminales 18 2.4.3. La colombianización de México y Trinidad yTobago 19 2.4.4. Los secuestros y el conflicto colombiano 21 3. La regionalización de una práctica colombiana: 26 Secuestros en Colombia, Ecuador y Venezuela 3.1. La problemática del secuestro: 1995 – 2001 26 3.2. La problemática del secuestro 2001 - 2008 27 3.2.1. Colombia 27 3.2.2. Ecuador 29 3.2.3. Venezuela 30 3.3. Regiones y grupos vulnerables 31 3.3.1. Colombia 31 3.3.2. Ecuador 32 3.3.3. Venezuela 33 3.4. El secuestro como instrumento de guerra 33 3.4.1. Colombia 34 3.4.2. Ecuador 40 3.4.3. Venezuela 41 3.5. Política de los gobiernos 44 3.5.1. Colombia 44 3.5.2. -

Lovitt Granted Clemency by Va. Governor
THE The Independent Newspaper Serving Notre Dame and Saint Mary's VOLUME 40: ISSUE 62 WEDNESDAY, NOVEMBER30, 2005 NDSMCOBSERVER.COM Lovitt granted clemency by Va. governor bought him time on death row Lovitt was slated to be the Approximately 40 Notre Whitewatl!r indnpnndm1t COUIJ Notre Dame students - until the day before his 1 OOOth person executed in the Dame students have met Lovitt sel Ken Starr. worked on death row scheduled execution, when United States since the - who was convicted in 1999 FiniPn returned to D.C. this Virginia Gov. Mark Warner, Supreme Court reinstated the of murdering a man with a pair summer as an intern for case, met convict troubled by death penalty in 1976, a dis of scissors - while taking Kirkland & Ellis, where he the destruc tinction that drew national Professor Tom Kellenberg's spent 10 weeks working on By MADDIE HANNA tion of DNA media coverage in recent capital punishment litigation Lovitt's clemency petition. lie evidence, weeks. course in the Washington had been at Kirkland & Ellis A.o;sociatr News Editor granted "In this case, the actiDns of Program. Two of those stu for slightly more than a month Lovitt an agent of the dents, seniors Christin O'Brien when the Supreme Court Convictnd murderer Hobin clemency. Commonwealth, in a manner and Hyan Finlen, have been granted Lovitt a stay on July Lovitt wate- Warner contrary to the express direc following Lovitt's case closely 11, his original execution date. lwd wavns of See Also issued a tion of the law, comes at the since meeting him in fall 2004. -

Kidnapper Faces 40 Years in Jail
E KEND EDITIO EE ON W a Santa Monica Daily Press January 28-29, 2006 A newspaper with issues Volume 5, Issue 66 DAILY LOTTERY SUPER LOTTO 7 14 20 21 47 Kidnapper faces 40 years in jail Meganumber: 24 Jackpot: $9 Million BY RYAN HYATT Alfonzo Fitzgerald Taylor was Taylor walked away from the of the two alleged kidnappings of FANTASY 5 Daily Press Staff Writer found guilty of all seven felony Clara Shortridge Foltz Criminal a Sunset Park woman that 2 3 6 17 19 charges related to the two inci- Justice Center in downtown Los occurred in the fall of 2004. DAILY 3 LAX COURTHOUSE — A jury dents that occurred on Oct. 18 and Angeles the day before a separate Taylor, in his 40s, was captured Daytime: 7 7 7 handed down a guilty verdict on Nov. 4, 2004. He faces a minimum jury trial was set to begin last May in Georgia and returned to custody Evening: 6 1 0 Friday for the man suspected of of 40 years in prison, according to on charges of receiving stolen in Los Angeles County within DAILY DERBY kidnapping a Santa Monica elderly Kevin Halligan, the district attor- property and unlawful driving of a 1st: 05 California Classic woman on two separate occasions. ney who prosecuted the case. vehicle, an incident independent See KIDNAPPER, page 12 2nd: 08 Gorgeous George 3rd: 12 Lucky Charms RACE TIME: 1.44.85 Although every effort is made to ensure the accuracy of the winning number information, mistakes can occur. In the event of any discrepancies, California Day laborers State laws and California Lottery regulations will prevail. -

Hezbollah's Threat in Germany
Hezbollah’s Threat in Germany: AN UPDATED OVERVIEW OF ITS PRESENCE AND THE GERMAN RESPONSE Jasmine Williams (Research Assistant, ICT) Spring 2014 ABSTRACT Former CIA director, George Tenet testified that the capability and presence of Hezbollah is equal, if not more capable than that of al-Qaeda.1 Tenet made this statement in 2003, over a decade ago, and Hezbollah has only further expanded its operations as it continues to evolve and function as a hybrid organization with political, social, and terrorist components, as well as expanding its network outside of its home base of Lebanon. As many focus on the growing presence of Hezbollah operations in Latin America, the Middle East, and Africa, Hezbollah’s presence in Europe is quite fascinating, Germany in particular. Within German borders, the group has built a strong presence, as there is known to be over 1000 operatives within its borders to date.1 It is important to note what factors have caused such localized German mobilization. This paper will provide an updated overview of Hezbollah operations in the Federal Republic of Germany and its government reaction and weaknesses. The views expressed in this publication are solely those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the International Institute for Counter-Terrorism (ICT) 2 Table of Contents INTRODUCTION...................................................................................................................................... 3 HEZBOLLAH STRUCTURE AND OPERATIONS IN GERMANY .................................................. -

Eng Brochure:Opmaak 1
Colophon Published by IKV Pax Christi, July 2008 Also printed in Dutch and Spanish Address P.O. Box 19318 3501 DH UTRECHT The Netherlands www.ikvpaxchristi.nl [email protected] Circulation 300 copies Text IKV Pax Christi Marianne Moor Simone Remijnse With the cooperation of: Fundación País Libre, Ms. Olga Lucía Gómez Fundación País Libre, Ms. Claudia M. Llano Rodrigo Rojas Orozco Mauricio Silva Peer van Doormalen Paul Wolters Bart Weerdenburg Sarah Lachman Annemieke van Breukelen Carolien Groeneveld ISBN 978-90-70443-41-2 Design & Print Van der Weij BV Netherlands Contents Introduction 3 1 Growth on all fronts: kidnapping in a global context 5 1.1.. A study of kidnapping worldwidel 5 1.2. Kidnapping in the 21st century; risers and fallers 5 1.3. A tried and tested weapon in the struggle 7 1.4. A profitable sideline that delivers fast 7 1.5. The middle classes protest 8 1.6. The heavy hand used selectively 8 2. Kidnapping in the regions 11 2.1. Africa 11 2.1.1. Nigeria 12 2.2. Asia 12 2.3. The Middle East 14 2.3.1. Iraq 15 2.4. Latin America 16 2.4.1. A wave of kidnapping in the major cities 17 2.4.2. Central America: maras and criminal gangs 18 2.4.3. The Colombianization of Mexico and Trinidad &Tobago 18 2.4.4. Kidnapping and the Colombian conflict 20 3. The regionalization of a Colombian practice: 25 kidnapping in Colombia, Ecuador and Venezuela 3.1. The kidnapping problem: 1995 – 2001 25 3.2. -

From Bamiyan to Baghdad: Warfare and the Preservation of Cultural Heritage at the Beginning of the 21St Century. Gerstenblith, Patty
From Bamiyan to Baghdad: warfare and the preservation of cultural heritage at the beginning of the 21st century. Gerstenblith, Patty. "From Bamiyan to Baghdad: warfare and the preservation of cultural heritage at the beginning of the 21st century. " Georgetown Journal of International Law. 37.2 (Wntr 2006): 245(107). LegalTrac. Gale. University of Minnesota. 5 June 2008 <http://find.galegroup.com.floyd.lib.umn.edu/itx/infomark.do?&contentSet=IAC- Documents&type=retrieve&tabID=T002&prodId=LT&docId=A146957399&source=gal e&srcprod=LT&userGroupName=umn_wilson&version=1.0>. Full Text:COPYRIGHT 2006 Georgetown University Law Center I. THE HISTORY OF THE LAW OF WARFARE REGARDING CULTURAL HERITAGE SITES AND OBJECTS A. Early History B. The 1954 Hague Convention and Its Protocols 1. The Main Convention 2. The First Protocol 3. The Second Protocol C. Subsequent International Instruments and Developments II. THE EFFECT OF WAR ON THE CULTURAL HERITAGE OF IRAQ A. Significance of Ancient Mesopotamian Civilization B. The First Gulf War and Its Aftermath C. The Second Gulf War and Its Aftermath 1. The Iraq Museum and Other Cultural Repositories 2. Archaeological Sites 3. Military Construction at Babylon 4. Military Activity near Other Cultural Sites III. THE IMPACT OF THE SECOND GULF WAR IN LIGHT OF THE HAGUE CONVENTION AND OTHER INTERNATIONAL LAW A. Immovable Cultural Sites and Monuments 1. Restraints on Targeting of Cultural Sites, Buildings, and Monuments 2. Restraints on Looting and Vandalism 3. Restraints on Interference with Cultural Sites 4. Obligation to Maintain Security at Cultural Sites B. Movable Cultural Objects 1. General Legal Mechanisms 2. -

I European Parliament
30.12.2006 EN Official Journal of the European Union C 328 /1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB I (Information) EUROPEAN PARLIAMENT WRITTEN QUESTIONS WITH ANSWER P-4012/05 (EN) by Sajjad Karim (ALDE) to the Commission (25 October 2005) Subject: Protection of children in the aftermath of the South Asian Earthquake Answer from the Commission (25 November 2005) E-4639/05 (PL) by Konrad Szymański (UEN) to the Commission (12 December 2005) Subject: Action by the German customs service and public prosecutor against the firm Inter-Trock-Bau from Opolszczyzna Answer from the Commission (2 February 2006) P-0002/06 (EN) by Oldřich Vlasák (PPE‑DE) to the Commission (6 January 2006) Subject: Lisbon national reform programmes and involvement of regions and cities Answer from the Commission (1 March 2006) E-0003/06 (EL) by Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) to the Commission (12 January 2006) Subject: Abduction and interrogation of Pakistanis residing in Greece Answer from the Commission (20 February 2006) E-0004/06 (EN) by Robert Kilroy-Silk (NI) to the Council (12 January 2006) Subject: Human rights in Russia Answer from the Council (15 May 2006) E-0005/06 (EN) by Robert Kilroy-Silk (NI) to the Council (12 January 2006) Subject: Human rights in Russia Answer from the Council (15 May 2006) E-0006/06 (EN) by Robert Kilroy-Silk (NI) to the Council (12 January 2006) Subject: Abolition of the burqa Answer from the Council (15 May 2006) C 328 /2 Official Journal of the European Union EN 30.12.2006 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB E-0007/06 (EN) by -

Canting the Cradle: the Destruction of an Ancient
CANTING THE CRADLE: THE DESTRUCTION OF AN ANCIENT MESOPOTAMIAN CIVILIZATION by JANE ELIZABETH MARSTON submitted in accordance with the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in the subject ANCIENT NEAR EASTERN STUDIES at the UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA SUPERVISOR: PROFESSOR P.S. VERMAAK CO-SUPERVISOR: N.J. VAN BLERK FEBRUARY 2013 DECLARATION Student Number: 5330491 I, Jane Elizabeth Marston, declare that CANTING THE CRADLE: THE DESTRUCTION OF AN ANCIENT MESOPOTAMIAN CIVILIZATION is my own work and that all the sources that I have used or quoted have been indicated and acknowledged by means of complete references. 25 February 2013 i ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank the following people: Professor P.S. Vermaak for his invaluable advice and guidance with the writing of this dissertation Nico van Blerk for his assistance and suggestions My mother for proof reading my work Lynne Anderson for proof reading and for her uncomplaining and repeated assistance when the computer defeated me My parents for their unflagging support and encouragement in every aspect of my life ii SUMMARY Iraq is a country of great cultural significance as it is where civilization first began. As a result of its lengthy occupation, it is virtually one large archaeological site. In spite of numerous warnings to the governments of both the United States and the United Kingdom, no efforts were made to protect the Iraqi National Museum in Baghdad when the American-led coalition unlawfully invaded Iraq. Indeed, orders were given not to interfere with the looting. During the occupation that followed, the United States failed to take steps to protect Iraqi cultural property. -

O B S E R V E R the Independent Newspaper Serving Notre Dame and Saint Marys
THE O b s e r v e r The Independent Newspaper Serving Notre Dame and Saint Marys VOLUME 40 : ISSUE 62 WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2005 NDSMCOBSERVER.COM Lovitt granted clemency by Va. governor Notre Dame students bought him time on death row Lovitt was slated to be the Approximately 40 Notre Whitewater independent coun — until the day before his 1000th person executed in the Dame students have met Lovitt sel Ken Starr. worked on death row scheduled execution, when United States since the — who was convicted in 1999 Finlen returned to D C. this Virginia Gov. Mark W arner, Supreme Court reinstated the of murdering a man with a pair summer as an intern for case, met convict troubled by death penalty in 1976, a dis of scissors — while taking Kirkland & Ellis, where he the destruc tinction that drew national Professor Tom Kellenberg’s spent 10 weeks working on tion of DNA media coverage in recent capital punishment litigation By MADDIE HANNA Lovitt’s clemency petition. He e v i d e n c e , weeks. course in the Washington had been at Kirkland & Ellis Associate News Editor granted “In this case, the actions of Program. Two of those stu for slightly more than a month Lovitt an agent of the dents, seniors Christin O’Brien when the Supreme Court Convicted murderer Robin clemency. Commonwealth, in a manner and Ryan Finlen, have been granted Lovitt a stay on July Lovitt watc Warner contrary to the express direc following Lovitt’s case closely 11, his original execution date. hed waves of S e e A ls o issued a tion of the law, comes at the since meeting him in fall 2004. -
Osservatorio Mediterraneo E Medioriente
XIV legislatura OSSERVATORIO MEDITERRANEO E MEDIORIENTE A cura del Centro Studi Internazionali (Ce.S.I.) n. 14 ottobre-novembre-dicembre 2005 Servizio Studi Servizio affari internazionali Direttore Direttore Daniele Ravenna tel. 06 6706_2451 Maria Valeria Agostini tel. 06 6706_2405 Segreteria _2451 Segreteria _2989 _2629 _3666 Fax 06 6706_3588 Fax 06 6706_4336 Ufficio ricerche nel settore della politica Ufficio dei Rapporti con gli Organismi estera e di difesa Internazionali (Assemblee Nato e Ueo) Consigliere parlamentare Consigliere parlamentare capo ufficio capo ufficio Luca Borsi _3538 Alessandra Lai _2969 PRESENTAZIONE Il presente dossier fa parte di una serie di rapporti periodici e di note di approfondimento, frutto di collaborazioni attivate - in un'ottica pluralistica - con istituti di ricerca specializzati in campo internazionale. Gli Osservatori si propongono di integrare la documentazione prodotta dal Servizio Studi e dal Servizio Affari internazionali, fornendo ai Senatori membri delle Commissioni Affari esteri e Difesa ed ai componenti le Delegazioni parlamentari italiane presso le Assemblee degli Organismi internazionali una visione costantemente aggiornata degli avvenimenti e del dibattito in relazione a due temi di grande attualità e delicatezza: rispettivamente i rapporti transatlantici e la situazione nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente allargato. L'Osservatorio Mediterraneo e Medio Oriente, oggetto del presente dossier, ha periodicità trimestrale ed è curato dal Centro Studi Internazionali (Cesi) per il Senato. Esso si articola in una prima parte, che fornisce il "Quadro d'assieme" dei principali eventi verificatisi nel corso del trimestre nell'intera area, cui fanno seguito note sintetiche relative ad ogni singolo paese, in cui compaiono, accanto agli avvenimenti di importanza internazionale, anche numerosi accadimenti di minor rilievo, capaci di incidere sui processi politici in atto.