Umweltbericht Flächennutzungsplan
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

TOURISMUSKONZEPT 2022-2032 Gemeinde Rohrberg (Altmark)
TOURISMUSKONZEPT 2022-2032 Gemeinde Rohrberg (Altmark) Juli 2021 Agentur am kleinen Weingarten Dahrendorf Dahrendorf 22 | 29413 Dähre OT Dahrendorf (Altmark) Tel.: 0176 73 81 66 30 [email protected] www.agentur-dahrendorf.de TOURISMUSKONZEPT | Gemeinde Rohrberg (Altmark) | Juni 2021 | Planungsbüro: Agentur am kleinen Weingarten Dahrendorf 2 Inhaltsverzeichnis THEMEN Seite Einleitung 4 Analyse & Basisinformationen 7 Ziele der Tourismusentwicklung 10 Maßnahmen zur Tourismusförderung 13 Fördermittel & Förderoptionen 26 Links zu möglichen Koop.-Partnern 30 TOURISMUSKONZEPT | Gemeinde Rohrberg (Altmark) | Juni 2021 | Planungsbüro: Agentur am kleinen Weingarten Dahrendorf 3 Einleitung Die Gemeinde Rohrberg möchte sich in der Wirtschaftssparte Tourismus weiterentwickeln. Aus diesem Grund hat sie die Erstellung eines Tourismuskonzeptes 2022-2032 in Auftrag gegeben. Das Konzept wurde in den Monaten April – Juli 2021 erstellt. Es analysiert den IST-Zustand, zeigt das touristische Entwicklungspotential der Gemeinde auf und gibt Handlungsempfehlungen, um das Segment Tourismus als essenziellen Wirtschaftsfaktor in der Gemeinde zu etablieren. Das Tourismuskonzept hat einen ausgeprägt praktischen Bezug, der Empfehlungen ausspricht und damit den Weg zu mehr Tourismusentwicklung aufzeigt. Auch die Themen Fördermittelakquise und zukünftige regionale und überregionale Kooperationspartnerschaften wurden berücksichtigt. Lage im Raum Die Gemeinde Rohrberg befindet sich in der westlichen Altmark, im Norden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt. Sie ist Teil der Verbandsgemeinde Beetzendorf- Diesdorf, die wiederrum Teil der kommunalen Struktur des Altmarkkreises Salzwedel ist. Das Gemeindegebiet umfasst seit der 2009er-Kreisgebietsreform 6 Ortsteile: Rohrberg, Ahlum, Groß Bierstedt, Klein Bierstedt, Stöckheim und Nieps. Mit rund 39 qkm Fläche ist die Gemeinde Rohrberg die kleinste kommunale Einheit im Gebilde der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. 1.057 Einwohner:innen (Stand 30.06.2021) leben in den sechs Ortsteilen – Zentrum ist der Ort Rohrberg, direkt an der B248 gelegen. -

Satzung Rettungsdienstbereichsplan Altmarkkreis Salzwedel 2,01 MB
Altmarkkreis Salzwedel Der Landrat Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan des Landkreises Altmarkkreis Salzwedel Seite 2 Inhaltsverzeichnis Seite 2 Präambel Seite 3 I. Geltungsbereich, Inhalt, Trägerschaft und Grundsätze der Versorgungsplanung Seite 3 - 5 § 1 Geltungsbereich / Inhalt Seite 3 § 2 Träger des Rettungsdienstes / Grundsätze der Versorgungsplanung Seite 4 - 5 II. Versorgungsziele und Einsatzgrundsätze Seite 5 - 8 § 3 Notfallrettung Seite 5 § 4 Qualifizierte Patientenbeförderung Seite 5 - 6 § 5 Personelle Besetzung und Ausstattung der Rettungsmittel Seite 6 - 7 § 6 Rettungswachenstandorte und Versorgungsbereiche Seite 7 § 7 Bedarfsgerechte Rettungsmittelausstattung / Vorhaltezeit Seite 8 III. Sonstiges Seite 9 - 14 § 8 Bereichsübergreifender Rettungsdienst Seite 9 § 9 Integrierte Einsatzleitstelle Altmark (ILS Altmark) Seite 10 § 10 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst Seite 10 § 11 Ereignisse mit einer großen Anzahl verletzter oder erkrankter Personen (MANV) Seite 10 - 12 § 12 Mitwirkung im Katastrophenschutz Seite 12 § 13 Maßnahmen der Qualitätssicherung Seite 12 - 13 § 14 Bereichsbeirat Seite 13 § 15 Konzessionierung Seite 14 § 16 Inkrafttreten Seite 14 Anlagen: Anlage 1: Notarztversorgungsbereiche Altmarkkreis Salzwedel (Liste) Anlage 2: Kartographische Darstellung Notarztversorgungsbereiche Anlage 3: Rettungswachenversorgungsbereiche Altmarkkreis Salzwedel (Liste) Anlage 4: Kartographische Darstellung der Rettungswachenversorgungsbereiche Abkürzungsverzeichnis -
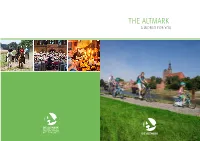
The Altmark. a World for You
THE ALTMARK A WORLD FOR YOU The Altmark – a world for you. Dear readers, Overview Active Map of the Altmark Washed with all waters | 20 Inside cover The Blue Belt in the Altmark Editorial | 01 Freedom now starts where it used to stop | 22 The Altmark – a world for you. The Green Belt – from deadly no man's land to paradise And if it were true …? | 02 Legends and truth in the Altmark tourist region The wonderful difficulty of having to decide | 24 Cycling in the Altmark Little Venice and the medieval beer rebels | 04 Towns and places in the Altmark On the film set of reality | 26 Magical hiking and riding in the Altmark Towns and places in the Altmark | 06 The Hanseatic League & contemporary witnesses of medieval prosperity DELIGHT The difference between liquid and solid gold | 28 Culture Beautiful views in Tangerhütte park Culinary specialities from the Altmark Where life blossoms eternally | 08 When the imperial couple enters Tangermünde … | 30 We would like to take you on a trip to the Altmark in the This brochure reveals to you all the variety the Altmark has Rich landscaped gardens and wide parks Folk festivals and Altmark gastronomy north of Saxony-Anhalt. On a journey into a world that to offer: so if you are looking for new inspiration for a city Scattered beauties | 10 is about the red bricks on the Romanesque Road, about trip, if you like hiking or cycling, if you enjoy concerts in Castles and manor houses in the Altmark magnificent Hanseatic towns and uniquely preserved nat- Romanesque churches, or if you are interested in history ural landscapes: in the glow of the sun, the blue of Arend- and want to walk in the footsteps of "Iron Chancellor" "See red" on the Romanesque Road | 12 The Altmark see Lake is dazzling and can be found in the Drömling Otto von Bismarck … then you will find exactly what you Churches, monasteries and the magic of bricks The Altmark's economy | 32 Biosphere Reserve in the diverse play of nature's colours. -

Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony
he collection of essays presented in “Devotional Cross-Roads: Practicing Love of God in Medieval Gaul, Jerusalem, and Saxony” investigates test case witnesses of TChristian devotion and patronage from Late Antiquity to the Late Middle Ages, set in and between the Eastern and Western Mediterranean, as well as Gaul and the regions north of the Alps. Devotional practice and love of God refer to people – mostly from the lay and religious elite –, ideas, copies of texts, images, and material objects, such as relics and reliquaries. The wide geographic borders and time span are used here to illustrate a broad picture composed around questions of worship, identity, reli- gious affiliation and gender. Among the diversity of cases, the studies presented in this volume exemplify recurring themes, which occupied the Christian believer, such as the veneration of the Cross, translation of architecture, pilgrimage and patronage, emergence of iconography and devotional patterns. These essays are representing the research results of the project “Practicing Love of God: Comparing Women’s and Men’s Practice in Medieval Saxony” guided by the art historian Galit Noga-Banai, The Hebrew University of Jerusalem, and the histori- an Hedwig Röckelein, Georg-August-University Göttingen. This project was running from 2013 to 2018 within the Niedersachsen-Israeli Program and financed by the State of Lower Saxony. Devotional Cross-Roads Practicing Love of God in Medieval Jerusalem, Gaul and Saxony Edited by Hedwig Röckelein, Galit Noga-Banai, and Lotem Pinchover Röckelein/Noga-Banai/Pinchover Devotional Cross-Roads ISBN 978-3-86395-372-0 Universitätsverlag Göttingen Universitätsverlag Göttingen Hedwig Röckelein, Galit Noga-Banai, and Lotem Pinchover (Eds.) Devotional Cross-Roads This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. -

Apenburg-Winterfeld, Flecken, 150815051026
Bevölkerung und Haushalte Gemeinde Apenburg-Winterfeld, Flecken am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Apenburg-Winterfeld, Flecken (Landkreis Altmarkkreis Salzwedel) Regionalschlüssel: 150815051026 Seite 2 von 28 Zensus 9. Mai 2011 Apenburg-Winterfeld, Flecken (Landkreis Altmarkkreis Salzwedel) Regionalschlüssel: 150815051026 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 5 Tabellen 1.1 Bevölkerung nach Geschlecht und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ........................................................................................................................... 6 1.2 Bevölkerung nach Staatsangehörigkeitsgruppen und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ........................................................................................... 8 1.3 Bevölkerung nach Alter und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion ........................................................................................................................... 10 2.1 Haushalte nach Typ, Größe sowie Seniorenstatus des privaten Haushalts ............................ -

The Evolution of Christianity and German Slaveholding in Eweland, 1847-1914 by John Gregory
“Children of the Chain and Rod”: The Evolution of Christianity and German Slaveholding in Eweland, 1847-1914 by John Gregory Garratt B.A. in History, May 2009, Elon University A Dissertation submitted to The Faculty of The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy January 31, 2017 Andrew Zimmerman Professor of History and International Affairs The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University certifies that John Gregory Garratt has passed the Final Examination for the degree of Doctor of Philosophy as of December 9, 2016. This is the final and approved form of the dissertation. “Children of the Chain and Rod”: The Evolution of Christianity and German Slaveholding in Eweland, 1847-1914 John Gregory Garratt Dissertation Research Committee: Andrew Zimmerman, Professor of History and International Affairs, Dissertation Director Dane Kennedy, Elmer Louis Kayser Professor of History and International Affairs, Committee Member Nemata Blyden, Associate Professor of History and International Affairs, Committee Member ii © Copyright 2017 by John Garratt All rights reserved iii Acknowledgments The completion of this dissertation is a testament to my dissertation director, Andrew Zimmerman. His affability made the academic journey from B.A. to Ph.D more enjoyable than it should have been. Moreover, his encouragement and advice proved instrumental during the writing process. I would also like to thank my dissertation committee. Dane Kennedy offered much needed writing advice in addition to marshalling his considerable expertise in British history. Nemata Blyden supported my tentative endeavors in African history and proffered early criticism to frame the dissertation. -

Verwaltungsgemeinschaft Beetzendorf – Diesdorf
VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT BEETZENDORF – DIESDORF DIE VERWALTUNGSAMTSLEITERIN (Altmark) VGem Beetzendorf – Diesdorf · Marschweg 3 · 38489 Beetzendorf Telefon: 03 90 00 / 97 – 0 Telefax: 03 90 00 / 2 88 E-Mail: [email protected] Internet: www.beetzendorf-diesdorf.de Bürgerbüro Diesdorf: Telefon: 03902 - 9380-60 Telefax: 03902 – 9380-80 Namens und im Auftrag der Mitgliedsgemeinden: Apenburg · Beetzendorf · Bornsen · Dähre · Diesdorf · Ellenberg · Gieseritz Hanum · Jübar · Langenapel · Lüdelsen · Mehmke · Nettgau Neuekrug · Rohrberg · Winterfeld Ordnungsamt: 039000/97-127 E-mail: [email protected] Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Bearbeitet von Datum Herrn Kamieth 18.06.2009 Vereinfachte Ausschreibung/Öffentliche Bekanntmachung namens und im Auftrag der Gemeinde Rohrberg gemäß § 6 Abs. 2 der „Grundsätze für die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in Sachsen-Anhalt“ (Gem. RdErl. vom 5.5.2009, MBl. LSA, S. 337) ABSCHNITT I: KOMMUNALE GEBIETSKÖRPERSCHAFT I.1) Name, Adressen und Kontaktstellen: Gemeinde Rohrberg, Schulstraße 1, 38489 Rohrberg Weitere Auskünfte erteilen: Verwaltungsgemeinschaft Beetzendorf-Diesdorf Herr H. Kamieth, Breitbandbeauftragter Telefon: 039000/97-138 Fax: 039000/288 E-Mail: [email protected] I.2) Verfahrensgrund / Gegenstand des öffentlichen Interesses: Versorgung mit Breitband-Internetzugängen im öffentlichen Raum -2- Bankverbindungen: Sparkasse Altmark West (BLZ 810 555 55) Konto - Nr. 302 200 268 7 ABSCHNITT II: GEGENSTAND DER DIENSTLEISTUNG II.1) Bezeichnung -

Ausbildungsbetriebe in Der Agrarwirtschaft Im Altmarkkreis Salzwedel
Ausbildungsbetriebe in der Agrarwirtschaft im Altmarkkreis Salzwedel Auskünfte und Ausbildungsberatung im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Altmark, Akazienweg 25 39576 Stendal Ansprechpartner: Frau Seehaus 03931 / 633 611 oder Herr Damker 03931 / 633 610 Kennzeichnung der Betriebszweige: Pflanzenproduktion: Tierproduktion: 1 = Getreidebau 1 = Milchviehhaltung 2 = Zuckerrübenbau 2 = Rinderaufzucht o. Rindermast 3 = Kartoffelbau 3 = Sauenhaltung u. Ferkelerzeugung 4 = Körnermaisbau 4 = Schweineaufzucht o. Schweinemast 5 = Ölfrüchtebau 5 = Legehennenhaltung 6 = Hülsenfrüchtebau 6 = Geflügelaufzucht o. Geflügelmast 7 = Ackerfutterbau 7 = Schafhaltung 8 = Grünland o. Ackergras 8 = Pferdehaltung 9 = Waldbau Betriebszweige Betrieb Besonderheiten Unterkunft Ansprechpartner/ Ausbilder, Tel. E-Mail Adresse Plätze Plätze anerkannt Landwirt Agrarerzeugergemeinschaft Abbendorf e. G. 2 PP 1,2,5,8 nein Hohenböddenstedter Str. 13 TP 1,2 29413 Diesdorf OT Abbendorf Herr Jacobs 03902/242 [email protected] Milchhof GmbH und Co.KG 1 PP 1,4,5,7,8 Altensalzwedel 64 TP 1,2 nein 38486 Apenburg - Winterfeld Herr Rohloff/ Frau Busse 039035/239 [email protected] Jürges GbR Dorfstraße 2 1 PP 1,2,5,8 nein 38486 Klein Apenburg TP 1,2 Herr Jürges 0175/4622282 039001/63091 [email protected] Rindergut Apenburg Paul- Werner von der Schulenburg 1 PP 1,3,4,6,7,8 ja Hinterstr. 6 TP 2 38486 Apenburg-Winterfeld Naturland- Betrieb Herr v. d. Schulenburg/ Herr Warlich Ausbildungskooperation 039001/ 63009 [email protected] Betriebszweige Betrieb Besonderheiten Unterkunft Ansprechpartner/ Ausbilder, Tel. E-Mail Adresse Plätze Plätze anerkannt Landwirtschaftlicher Betrieb PP 1, 4, 5, 7, 8 ja Jens Doose TP 1, 2 Recklinger Str. 18 38486 Apenburg - Winterfeld Herr Doose 039009/50427 [email protected] Landwirtschaftsgesellschaft Arendsee GmbH 2 PP 1,5,8 nein Hasenwinkel 1 TP 1,2 39619 Arendsee Herr Lehmann 039384/2310 o. -

Und Bodenständig Salzwedel Altmark District Reaching for the Stars and Still Down-To-Earth
und bodenständig Reaching for the stars and still down-to-earth Salzwedel Altmark district auf ein Wort In a word Sehr geehrte Damen und Herren, Dear Sir or Madam, Altmarkkreis Salzwedel Landrat Hans-Jürgen Ostermann zu meinen größten, interessantesten und vielfältigsten Aufga- One of the greatest, most interesting and most multifaceted Karl-Marx-Straße 32 ben gehört es, den vorhandenen politischen und rechtlichen of my duties is to make the most of the existing political and 2940 Salzwedel Rahmen auszunutzen, um den Altmarkkreis Salzwedel im legal situation to advance the Salzwedel Altmark district as a Tel.: 0 39 0/8 40-0 Ganzen voranzubringen. Die Basis hierfür ist eine aufstrebende whole. The basis for this is a thrusting economy. Fax: 0 39 0/2 50 79 Wirtschaft. E-Mail: On the one hand we help the companies already here with [email protected] Einerseits unterstützen wir die vorhandenen Unternehmen their investment projects; on the other hand we also want to Internet: bei ihren Investitionsvorhaben, andererseits wollen wir auch arouse the interest of new companies in our region. Besides the www.altmarkkreis-salzwedel.de neue Unternehmen für unsere Region interessieren. Neben oft-quoted “hard and soft” location factors, “success stories” den immer wieder zitierten „harten und weichen“ Standort- of firms that have recently settled here with an excellent start Außenstelle Gardelegen faktoren sprechen „Erfolgsgeschichten“ von hervorragend speak for themselves. Philipp-Müller-Straße 8 gelaufenen Ansiedlungen in der nahen Vergangenheit -

15 01032020 MA Prioritätenlist
LAG Mittlere Altmark PL 2016-2019 Stand: 01.03.2020 Antragsteller Vorhabensort Vorhaben in Prüfung VZM ZB erteilt Abgeschlossen lfd. Nr. lfd. 2016 ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes) Etablierung und Profilierung des Kunsthauses Salzwedel als 1 Kunststiftung Salzwedel Salzwedel Standort für Kunst, Kultur und kulturelle Bildung durch Ausstellungen, Veranstaltungen & Kooperationen Erstellung eines Konzepts zur nachhal-tigen Energieversorgung von Förderverein "Historische Region 2 Lindstedt Lindstedts Neuer Mitte auf Basis von regenerativen Energien und Lindstedt" e.V. unter besondere Berücksichtigung des Denkmalschutzes Grünes Haus - Beratungsstelle des gARTenakademie Sachsen- 3 gARTenakademie Sachsen-Anhalt e.V. Zichtau Anhalt e.V. 4 Chrisitian Borm Meßdorf Villa Nadermann "Turm-Haus" im KiEZ Arendsee, Umbau ehemaliges 5 Kinder- und Jugenderholungszentrum Arendsee Sanitärgebäude Flecken Apenburg-Winterfeld über 6 Winterfeld "Gesundheitszentrum Apenburg-Winterfeld" VerbGem Beetzendorf-Diesdorf Auf Solbrichs Spuren - Einbindung in "Altmärkische Wandernester" 7 gARTenakademie Sachsen-Anhalt e.V. Zichtau Wander-wege reaktivieren und bekannt machen Hohenberg- Ausbau Reiterhof Pensionsbereich 2.BA, Umbau Zimmer, Küche, 8 Pension und Reiterhof Uwe Trumpf Krusemark Gemeinschaftsraum Umbau und Sanierung Kavaliershaus Krumke, Westflügel 3. BA, 9 Förderverein Schloss Krumke e.V. Krumke Ausbau im Erdgeschoss Touristisches Kommunikations- und Marketingkonzept Teilprojekt: 10 Kultour-Betrieb Salzwedel Salzwedel -

RWA 2004 Sachsen-Anhalt
Land Sachsen-Anhalt Regionale Wertansätze 2004 gemäß § 5 Abs. 1 der Flächenerwerbsverordnung zum begünstigten Flächenerwerb nach dem Ausgleichsleistungsgesetz Ackerland Grünland Kreis Gemeinde Gemarkung zugehörige zugehörige EUR/ha EUR/ha Ackerzahl Grünlandzahl ALTMARKKREIS SALZWEDEL APENBURG-WINTERFELD, FLECKEN ALTENSALZWEDEL 3.150 45 2.700 45 APENBURG-WINTERFELD, FLECKEN APENBURG 3.150 45 2.700 45 APENBURG-WINTERFELD, FLECKEN BAARS 3.150 45 2.700 45 APENBURG-WINTERFELD, FLECKEN RECKLINGEN 3.150 45 2.700 45 APENBURG-WINTERFELD, FLECKEN SAALFELD 3.150 45 2.700 45 APENBURG-WINTERFELD, FLECKEN WINTERFELD 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT ARENDSEE 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT BINDE 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT FLEETMARK 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT GENZIEN 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT HÖWISCH 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT KAULITZ 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT KERKAU 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT KLÄDEN 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT KLEINAU 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT LÜGE 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT LEPPIN 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT LOHNE 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT MECHAU 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT MOLITZ 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT NEULINGEN 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT RADEMIN 3.150 45 2.700 45 ARENDSEE (ALTMARK), STADT RITZLEBEN 3.150 40 2.700 35 ARENDSEE (ALTMARK), STADT SAALFELD 3.150 45 2.700 45 -
Freilichtmuseum Diesdorf
Freilichtmuseum Diesdorf Jahresprogramm 2020 Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre NEU 1 FREILICHTMUSEUM DIESDORF In einer der reizvollsten Land- schaften der Altmark, dem Hans-Jochen-Winkel, liegt ei- nes der ältesten Museums- dörfer Deutschlands. Das 1911 begründete Freilichtmuseum Diesdorf lädt zu einem Ausflug in das Leben früherer Genera- tionen ein. Mit über 20 Wohn- und Wirtschaftsgebäuden auf einer Fläche von ca. sechs Hek- tar dokumentiert es die Kultur und Lebensweise der Menschen in der Altmark zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert. Bauernhäuser, Speicher und Torhäuser, Schmiede und Bock- windmühle, Taubenturm, Backhaus und Dorfschule wurden zu unterschiedlichen Hofformen angeordnet und vermitteln gemeinsam mit den nach historischen Vorbildern angeleg- ten Gärten und Feldflächen den Eindruck eines typisch alt- märkischen Dorfes. Seit 2015 bewirtschaften wir die Gärten, in denen regionale und alte Kulturpflanzen wie der Altmär- ker Braunkohl oder duftende Bauernrosen wachsen, nach den ökologischen Grundsätzen von „Natur im Garten“. In den Häusern werden charakte- ristische Arbeits- und Wohnsitu- ationen der Bauern, Tagelöhner und Landhandwerker dargestellt. Einzigartig ist die Ausstellung zur Geschichte des Böttcher- und Kü- ferhandwerks, die seit 2015 in der Hopfendarre aus Wollenhagen ge- zeigt wird. In der Saison 2020 erhält das Freilichtmuseum Diesdorf ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: Die Fachwerkkapelle aus Klein Chüden wird in das Museumsdorf umgesetzt und rundet es mit der typischen „Kirche im Dorf“ ab. 2 Gleich daneben wird ein „Pfarrgarten“ als botanischer Schau- und Lehrgarten angelegt, in dem auch exotische Früchte wachsen sollen. Unsere engagierten Mitarbeiter begleiten Sie gerne durch unser Museumsdorf und geben Ihnen spannende Einblicke in die Bau- und Sozialgeschichte der Altmark. Natürlich kön- nen Sie auch eigenständig auf Entdeckungsreise in die Ver- gangenheit gehen.