Ausgabe 161 Anfang Januar 2019
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Why No Wonder Woman?
Why No Wonder Woman? A REPORT ON THE HISTORY OF WONDER WOMAN AND A CALL TO ACTION!! Created for Wonder Woman Fans Everywhere Introduction by Jacki Zehner with Report Written by Laura Moore April 15th, 2013 Wonder Woman - p. 2 April 15th, 2013 AN INTRODUCTION AND FRAMING “The destiny of the world is determined less by battles that are lost and won than by the stories it loves and believes in” – Harold Goddard. I believe in the story of Wonder Woman. I always have. Not the literal baby being made from clay story, but the metaphorical one. I believe in a story where a woman is the hero and not the victim. I believe in a story where a woman is strong and not weak. Where a woman can fall in love with a man, but she doesnʼt need a man. Where a woman can stand on her own two feet. And above all else, I believe in a story where a woman has superpowers that she uses to help others, and yes, I believe that a woman can help save the world. “Wonder Woman was created as a distinctly feminist role model whose mission was to bring the Amazon ideals of love, peace, and sexual equality to ʻa world torn by the hatred of men.ʼ”1 While the story of Wonder Woman began back in 1941, I did not discover her until much later, and my introduction didnʼt come at the hands of comic books. Instead, when I was a little girl I used to watch the television show starring Lynda Carter, and the animated television series, Super Friends. -

Ausgabe 142 Mitte August 2014
Ausgabe 142 Mitte August 2014 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: http://rattus-libri.taysal.net/ www.beam-ebooks.de/kostenlos.php http://blog.g-arentzen.de/ www.foltom.de www.geisterspiegel.de/ www.literra.info www.phantastik-news.de http://phantastischewelt.wordpress.com/ Ältere Ausgaben unter: www.light-edition.net www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/ Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.buchrezicenter.de; www.sfbasar.de; www.filmbesprechungen.de; www.phantastiknews.de; http://phantastischewelt.wordpress.com; www.literra.info; www.rezensenten.de; www.terracom- online.net. Das Logo hat Lothar Bauer für RATTUS LIBRI entworfen: www.saargau-blog.de; www.saargau-arts.de; http://sfcd.eu/blog/; www.pinterest.com/lotharbauer/; www.facebook.com/lothar.bauer01. Das Layout haben Armin Möhle und Irene Salzmann entworfen: www.armin-moehle.de. Das Layout des Schwerpunktthemas stammt von Elmar Huber: http://phantastischewelt.wordpress.com/ Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei: www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Wir bedanken uns vielmals bei allen Autoren und Verlagen, die uns Rezensionsexemplare und Bildmaterial für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. -

KUPERARD Random House Adult Blue, Spring
KUPERARD Random House Adult Blue, Spring 2015 Omni Kuperard Myanmar Culture Smart! : The Essential Summary: Myanmar, as Burma is now known, is strategically Guide to Customs & Culture situated between the world’s two most populous nations— Ki Ki May China and India—and its distinctive ancient culture shares 9781857336979 some traditions with both countries. Hidden away from the Pub Date: 4/14/15, On Sale Date: 4/14 eyes of the world for half a century by its military rulers’ $9.95/$12.95 Can. policy of selfisolation, “the Burmese Way to Socialism,” with 168 pages a new democratic parliament and civilian government Trade Paperback Myanmar is undergoing important changes as it approaches its Travel / Asia / Far East next elections in 2015. Its most ... Ctn Qty: 24 0.810 lb Wt Contributor Bio: 367g Wt KYI KYI MAY was born and brought up Myanmar, where she attended Rangoon Arts and Science University and gained a M.Sc. in Zoology. She became a print journalist before joining the BBC Burmese Service in London as a producer and gained a BA (Hons) degree in Politics, Philosophy and History at Birkbeck College, University of London. As a BBC producer, a field reporter, and later as head of the Burmese Service, she has written and broadcast many current affairs and feature programs... Random House Adult Blue, Spring 2015 Omni Kuperard Argentina Culture Smart! : The Essential Summary: The secondlargest country in South America, Guide to Customs & Culture Argentina has been through great changes in recent years. Robert Hamwee Its journey from dictatorship to democracy has left many 9781857337051 scars, but these are largely eclipsed by the pride and Pub Date: 6/16/15, On Sale Date: 6/16 resilience of the Argentinian people, who have developed a $9.95/$12.95 Can. -

Previews Publications Previews #307
PREVIEWS #305 (VOL. XXIV #2, FEB14) PREVIEWS PUBLICATIONS PREVIEWS #307 APRIL 2014 THIS MONTH’S COVER ART: New projects from DC and Dark Horse! THIS MONTH’S THEME: Movie Blockbusters! Since 1988, PREVIEWS has been your ultimate source for all of the comics and merchandise to be available from your local comic book shop… revealed up to two months in advance! Hundreds of comics and graphic novels from the best comic publishers; the coolest pop-culture merchandise on Earth; plus PREVIEWS exclusive items available nowhere else! Now more than ever, PREVIEWS is here to show the tales, toys and treasures in your future! This April issue features items scheduled to ship in June 2014 and beyond. Catalog, 8x11, 500+pg, PC $4.50 PREVIEWS #307 CUSTOMER ORDER FORM — APRIL 2014 PREVIEWS makes it easy for you to order every item in the catalog with this separate order form booklet! This April issue features items scheduled to ship in June 2014 and beyond. Comic-sized, 62pg, PC PI MARVEL PREVIEWS VOLUME 2 #21 Each issue of Marvel Previews is a comic book-sized, 120-page, full-color guide and preview to all of Marvel’s upcoming releases — it’s your #1 source for advanced information on Marvel Comics! This April issue features items scheduled to ship in June 2014 and beyond. FREE w/Purchase of PREVIEWS Comic-sized, 120pg, FC $1.25 DIAMOND BOOKSHELF #16 The Diamond BookShelf website is the comprehensive resource for promoting comic books and graphic novels to educators and librarians. The BookShelf magazine is a colorful, comic-sized publication designed to complement the website with timely feature articles, recent reviews, news items, core lists and previews. -

Novelas Gráficas Enero 2021
NOVELAS GRÁFICAS ENERO 2021 LA HISTORIA DEFINITIVA DEL HOMBRE MURCIÉLAGO Y EL PRÍNCIPE PAYASO DEL CRIMEN: TRES JOKERS Celebramos el 80 aniversario de Green Lantern. A LA VENTA EN ENERO DE 2021 GREEN LANTERN ESPECIAL 80 ANIVERSARIO, BATMAN: LA MALDICIÓN DEL CABALLERO BLANCO (EDICIÓN DELUXE BLANCO Y NEGRO), BATMAN: JUEGOS DE GUERRA, BATMAN VO. 8: NOVIA O LADRONA (BATMAN SAGA - CAMINO AL ALTAR PARTE 2) , BATMAN VOL. 1: EL TRIBUNAL DE LOS BÚHOS (BATMAN SAGA - NUEVO UNIVERSO PARTE 1) , BATMAN: TRES JOKERS NÚM. 1 DE 3, EL RELOJ DEL JUICIO FINAL, DCSOS, CONSTANTINE: THE HELLBLAZER, EL CUARTO MUNDO: NUEVOS DIOSES, WONDER WOMAN: TIERRA MUERTA VOL. 2 DE 2, WONDER WOMAN: SANGRE - LA SAGA COMPLETA, WONDER WOMAN VOL. 5: HIJOS DE LOS DIOSES (WONDER WOMAN SAGA - HIJOS DE LOS DIOSES PARTE 1) , BIBLITECA SANDMAN VOL. 3: PAÍS DE SUEÑOS... Green Lantern Especial 80 aniversario Desde 1940 hasta 2020, ningún mal podrá escapar de su vigía. Fue hace 80 años, en la Edad de Oro, cuando se relató la historia del ingeniero Alan Scott y su encuentro con una linterna de naturaleza mística. Fue hace más de 60 cuando el piloto de pruebas Hal Jordan debutó como Green Lantern en un contexto muy distinto, el de la Edad de Plata, con la ciencia ficción y el Cuerpo de Green Lanterns como trasfondo. Y desde entonces no se les han dejado de sumar personajes que han portado la antorcha de GL hasta el presente: Guy Gardner, John Stewart, Kyle Rayner, Jessica Cruz, Simon Baz... En este volumen conmemorativo, muchos de los principales guionistas y dibujantes del cómic superheroico actual rinden homenaje a esas brillantes ocho décadas de historia. -
DVD-Video-Archiv Liste
Filmtitel Kategorie Darsteller DVD-Nummer 11:14 NID Robert De Niro , Edward Burns , 15 Minutes - Der Tod kommt live Kelsey Grammer , Avery Brooks , 45 Melina Kanakaredes , Karel Roden , Paul Walker , Tyrese , Eva Mendes , 2 Fast 2 Furious AVI Cole Hauser , Ludacris , Thom Barry , 120 James Remar , Devon Aoki , Amaury Tony Leung Chiu Wai , Li Gong , 2046 AVI Takuya Kimura , Faye Wong , Ziyi A 1 / 35 Zhang , Carina Lau , Chen Chang , Alex Palmer , Bindu De Stoppani , 28 Days Later Jukka Hiltunen , David Schneider , 97 Cillian Murphy , Toby Sedgwick , Rachael Leigh Cook , Jeremy Davies , 29 Palms Keith David , Chris O'Donnell , Michael 82 Lerner , Michael Rapaport , Russell Cameron Diaz , Drew Barrymore , Lucy 3 Engel für Charlie - Volle Power AVI Liu , Bernie Mac , Crispin Glover , Blau 1 / 1 Justin Theroux , Robert Patrick , Demi Michael Madsen , Ron Livingston , Ray 44 Minutes - Die Hölle von Baker , Douglas Spain , Andrew 108 Nord-Hollywood Bryniarski , Oleg Taktarov , Clare Otto Waalkes , Mirco Nontschew , 7 Zwerge - Männer allein im Wald Boris Aljinovic , Markus Majowski , 107 Heinz Hoenig , Helge Schneider , Ralf Russell Crowe , Ed Harris , Jennifer A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn Connelly , Christopher Plummer , Paul 129 - Oscar Edition Bettany , Adam Goldberg , Josh Lucas Haley Joel Osment , Jude Law , A.I. - Künstliche Intelligenz Frances O'Connor , Sam Robards , Jake 125 Thomas , William Hurt , Ken Leung , Christopher Lambert , Lou Diamond Absolon Phillips , Kelly Brook , Ron Perlman , 134 Roberta Angelica , Neville Edwards -

Ausgabe 158 Ende November 2017
Ausgabe 158 Ende November 2017 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: http://rattus-libri.taysal.net/ www.buchrezicenter.de www.geisterspiegel.de/ www.literra.info www.phantastik-news.de http://phantastischewelt.wordpress.com/ Ältere Ausgaben unter: www.beam-ebooks.de/kostenlos.php http://blog.g-arentzen.de/ www.foltom.de www.light-edition.net www.uibk.ac.at/germanistik/dilimag/ Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.literra.info; www.phantastiknews.de; http://phantastischewelt.wordpress.com. Ältere Einzelrezensionen unter: www.buchrezicenter.de; www.sfbasar.de; www.filmbesprechungen.de; www.terracom-online.net. Das Logo hat Lothar Bauer für RATTUS LIBRI entworfen: www.saargau-blog.de; www.saargau-arts.de; http://sfcd.eu/blog/; www.pinterest.com/lotharbauer/; www.facebook.com/lothar.bauer01. Das Layout des Magazins hat Irene Salzmann entworfen. Das Layout des Schwerpunktthemas hat Elmar Huber entworfen. Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei: www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Wir bedanken uns vielmals bei allen Autoren und Verlagen, die uns Rezensionsexemplare und Bildmaterial für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. Nun aber viel Vergnügen mit der Lektüre der 158. -

ARCHIE COMICS Random House Adult Blue Omni, Fall 2013 Archie
ARCHIE COMICS Random House Adult Blue Omni, Fall 2013 Archie Comics The Best of Archie Comics 3 Summary: It's Archie's third volume in our all-time Archie Superstars bestselling The Best of Archie Comics graphic novel series, 9781936975617 featuring even more great stories from Archie's eight decades Pub Date: 9/3/13, On Sale Date: 9/3 of excellence! This fun full-color collection of more of Archie's Ages 10 And Up, Grades 5 And Up all-time favorite stories, lovingly hand-selected and $9.99/$10.99 Can. introduced by Archie creators, editors, and historians from 416 pages / FULL-COLOR ILLUSTRATIONS 200,000 pages of material, is a must-have for any Archie fan THROUGHOUT and fans of comics in general, as well as a great introduction Paperback / softback / Digest format paperback to the comics medium! Juvenile Fiction / Comics & Graphic Novels ... Series: The Best Of Archie ComicsTerritory: World Ctn Qty: 1 Author Bio: THE ARCHIE SUPERSTARS are the impressive 5.250 in W | 7.500 in H line-up of talented writers and artists who have brought 133mm W | 191mm H Archie, his friends and his world to life for more than 70 years, from legends such as Dan DeCarlo, Frank Doyle, Harry Lucey, and Bob Montana to recent greats like Dan Parent and Fernando Ruiz, and many more! Random House Adult Blue Omni, Fall 2013 Archie Comics Sabrina the Teenage Witch: The Magic Within 3 Summary: Return to the magic with Sabrina the Teenage Tania del Rio Witch: The Magic Within 3! 9781936975600 Pub Date: 9/10/13, On Sale Date: 9/10 Sabrina and friends become caught up in the secrets of the Ages 10 And Up, Grades 5 And Up Magic Realm, while friendships and relationships are put to the $10.99/$11.99 Can. -
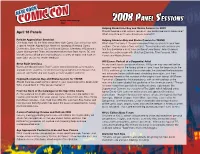
2008 Panel Sessions
2008 Panel Sessions Helping Bookstores Buy and Shelve Comics for KIDS April 18 Panels Should there be a kids comics section in your bookstore/comic bookstore? What should be in it? How should you market it? Retailer Appreciation Breakfast Helping Libraries Buy and Shelve Comics for TEENS On Friday, April 18, the third annual New York Comic Con will kick off with What about the teens? Do you have everything you should in your teen a special Retailer Appreciation Breakfast hosted by Diamond Comic section? Do you have a Teen section? These insiders will convince you Distributors, Dark Horse, DC and Marvel Comics. Members of Diamond’s that this should be a must-have section of your library. John Shableski Upper Management Team and representatives from Dark Horse, DC and moderates a discussion with Christian Zabriskie, Tyler Rosseau, Mike Marvel Comics will be on hand to discuss a variety of topics and have an Pawuk and Robin Brenner. open Q&A session for retailer feedback. Will Eisner: Portrait of a Sequential Artist Steve Rude Art Class As any comic book connoisseur knows, Will Eisner may very well be the Watch and observe Steve Rude’ acrylic demo/workshop as he teaches greatest innovator in the history of the art form. From the beginning in the a group of ten students. He will be teaching fundamental techniques that 1930s and through six revolutionary decades, he stretched the boundaries you can take home and use, taught at each student’s skill level and advocated more sophisticated storytelling techniques, and then reinvented himself as the architect of the graphic novel format. -
JULIO 2017 Comunicado De Novedades De Julio 2017 (Primera Salida)
NOVEDADESJULIO 2017 Comunicado de novedades de julio 2017 (primera salida) A las puertas del verano, tras meses de intensa actividad, llega el momento de pausar por un instante el ritmo. Antes de dar a conocer el grueso de las novedades de julio 2017, presentamos una tanda de lanzamientos mucho más especial que de costumbre, con excepcionales títulos que llegarán a vuestras librerías favoritas a partir del próximo 20 de junio. Para empezar, en la línea de autor nos enorgullece anunciar la incorporación de Fax desde Sarajevo, del maestro Joe Kubert. Se trata de una multipremiada y emotiva novela gráfica basada en la vida de uno de los mejores amigos del aclamado autor, Ervin Rustemagic, atrapado junto a su familia durante el denominado "asedio de Sarajevo", ocurrido entre 1992 y 1996 en el marco de la guerra de Bosnia. Fax desde Sarajevo se une así a otras obras editadas por ECC Ediciones, centradas en conflictos bélicos que han marcado la historia reciente de la humanidad, como Nankín: La ciudad en llamas, de Ethan Young; Trágica derrota, de Nozoe Nobuhisa; o Yonqui de la guerra, la autobiografía satírica de Joe Sacco. ¡Pero las sorpresas no terminan aquí! Seguro que si preguntamos a diferentes lectores por su etapa favorita del Hombre Murciélago, entre las respuestas encontraremos un buen número de historias que han marcado la carrera del protector de Gotham. A lo largo de nuestra trayectoria editorial hemos recuperado muchas de ellas, pero siempre hay etapas que, por su contexto, por los profesionales implicados, por la trascendencia del contenido, o por todos estos factores unidos, destacan por encima de otras. -

JOHN CONSTANTINE DESEMBARCA EN DC BLACK LABEL DE LA MANO DE TOM TAYLOR Y DARICK ROBERTSON Recuperamos Green Lantern/Green Arrow De O’Neil Y Grell
NOVELAS GRÁFICAS MARZO 2021 JOHN CONSTANTINE DESEMBARCA EN DC BLACK LABEL DE LA MANO DE TOM TAYLOR Y DARICK ROBERTSON Recuperamos Green Lantern/Green Arrow de O’Neil y Grell A LA VENTA EN MARZO DE 2021 BATMAN VOL. 11: LA MIRADA DEL OBSERVADOR (BATMAN SAGA - BATMAN RENACIDO PARTE 7), BATMAN: CALLES DE GOTHAM VOL. 1: EL CORTE FINAL (BATMAN SAGA - LA CASA DEL SILENCIO PARTE 1), SUPERHIJOS VOL. 4: SOBREPROTEGIDOS (RENACIMIENTO PARTE 4), FLASH VOL. 6: GUERRA FLASH (FLASH SAGA - LA BÚSQUEDA DE LA FUERZA PARTE 1), JOKER: LA SONRISA DEL DEMONIO, GREEN LANTERN / GREEN ARROW: HÉROES ERRANTES EN EL ESPACIO, CRISIS INFINITA (3ª EDICIÓN), BATMAN: TRES JOKERS VOL. 3 DE 3, BATMAN CABALLERO BLANCO PRESENTA: HARLEY QUINN NÚM. 2 DE 6, JOKER/HARLEY: CORDURA CRIMINAL VOL. 2 DE 3, HELLBLAZER: ASCENSO Y CAÍDA VOL. 1 DE 3, BIBLIOTECA SANDMAN VOL. 4: ESTACIÓN DE NIEBLAS, UNIVERSO SANDMAN: EL SUEÑO VOL. 3 - UN MOVIMIENTO MÁGICO, FÁBULAS VOL. 10 DE 15 EDICIÓN DE LUJO, LOS MUNDOS DE ALDEBARÁN - CICLO 1: ALDERBÁN (EDICIÓN DELUXE) ... Batman: Calles de Gotham vol. 1: El corte final (Batman Saga - La casa del silencio Parte 1) Paul Dini no solo firmó una inigualable etapa enDetective Comics, que ECC ha incluido en los tomos de Batman Saga titulados Archivos secretos y Corazón de Silencio, a los que hay que sumar los episodios de cruces vistos en La resurrección de Ra’s al Ghul y Extremaunción. También guionizó casi toda la serie que ahora empieza a recopilarse en el presente formato. Aquí vuelve a demostrar, entre otras cosas mediante personajes con su sello inequívoco —como Abuso o el Broker—, que es uno de los más imaginativos escribas que ha tenido Batman en su historia. -

Rattus Libri
Ausgabe 30 Mitte November 2007 Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kolleginnen und Kollegen, in unserer etwa zwölf Mal im Jahr erscheinenden Publikation möchten wir Sie über interessante Romane, Sachbücher, Magazine, Comics, Hörbücher und Filme aller Genres informieren. Gastbeiträge sind herzlich willkommen. RATTUS LIBRI ist als Download auf folgenden Seiten zu finden: www.rattus-libri.buchrezicenter.de http://blog.g-arentzen.de/ www.geisterspiegel.de/ http://haraldhillebrand.blog.de www.HARY-PRODUCTION.de www.light-edition.net www.literra.info www.phantastik-news.de www.terranischer-club-eden.com/ RATTUS LIBRI ist außerdem auf CD oder DVD erhältlich innerhalb des Magazins BILDER, das kostenlos bestellt werden kann bei [email protected]. Einzelne Rezensionen erscheinen bei: www.buchrezicenter.de, www.sfbasar.de, www.filmbesprechungen.de, www.phantastik-news.de, www.literra.info, Terracom: www.terracom-online.net, Kultur-Herold/Crago-Verlag: www.kultur- herold.de, www.edition-heikamp.de, Andromeda Nachrichten/SFCD: www.sfcd-online.de. Für das PDF-Dokument ist der Acrobat Reader 6.0 erforderlich. Diesen erhält man kostenlos bei www.adobe.de. Die Rechte an den Texten verbleiben bei den Verfassern. Der Nachdruck ist mit einer Quellenangabe, einer Benachrichtigung und gegen ein Belegexemplar erlaubt. Das Logo hat Freawyn für RATTUS LIBRI entworfen: http://elfwood.lysator.liu.se/loth/u/t/uta/uta.html Wir bedanken uns vielmals bei allen Verlagen und Autoren, die uns Rezensionsexemplare für diese Ausgabe zur Verfügung stellten, und den fleißigen Kollegen, die RATTUS LIBRI und die Rezensionen in ihren Publikationen einbinden oder einen Link setzen. Nun aber viel Spaß mit der Lektüre der 30.