PDF-Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Natur & Kultur
Natur & Kultur als Partner der wirtschaftlichen Entwicklung Vorwort 2 Liebe Leserinnen und Leser, die Region Odermündung hat einige versteckte und noch unerkannte „Schätze“ vorzuweisen. Allen voran eine einzigartige Natur- und attraktive Kulturlandschaft mit einem hohen Freizeit- und Erholungswert. Aber auch eine bewegte Geschichte, landwirtschaftliche und handwerkliche Traditionen sowie eine Vielfalt an Bräuchen, deren Spuren überall zu sehen sind, wenn man nur genau hinschaut. Akteure aus den beiden auf der deutschen Seite der Odermündung liegenden Landkreisen Ostvorpommern und Uecker-Randow waren davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, diese Stärken als Entwicklungsmotor für die Region zu nutzen. Sie haben deshalb erstmals gemeinsam und kreisübergreifend eine Strategie zur Entwicklung des ländlichen Raums erarbeitet und unter dem Thema „Natur und Kultur als Partner der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region Odermündung“ im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative LEADER+ umgesetzt. Wichtigstes Ziel dabei war, den „Schatz“ unserer Region - die einzigartige Naturlandschaft - zu erhalten und zu verbessern, sie aber gleichzeitig in Wert zu setzen und so die Attraktivität unserer Kulturlandschaft weiter zu erhöhen, für die Einwohner ein liebens- und lebenswertes Umfeld und für die Touristen lohnenswerte Ausflugsziele zu schaffen. Dazu haben 34 durchgeführte Projekte, über die Sie etwas in dieser Broschüre erfahren können, ihren Beitrag geleistet. Unser Dank gilt an dieser Stelle allen, die uns bei der Umsetzung der LEADER+ Initiative geholfen haben. Insbesondere bedanken wir uns beim Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern und den Landkreisen Ostvorpommern und Uecker-Randow für die finanzielle und beratende Unterstützung. Wir hoffen, dass die begonnenen Initiativen zur Entwicklung des ländlichen Raums auch in der sich anschließenden Förderperiode fortgeführt werden und geben als lokale Akteure weiterhin unser Bestes. -

Ladung Zur Bekanntgabe Und Erläuterung Des Bodenordnungsplanes, Sowie Zum Anhörungstermin Im Bodenordnungsverfahren Rothenklempenow
gj" LANDGESELLSCHAFT Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH tat Mecklenburg-Vorpommem mbH Lindenallee 2a 19067 Leezen -beauftragte Stelle nach § 53 Abs. 4 LwAnpG- Bodenordnungsverfahren Rothenktempenow Landkreis Vorpommem-Greifswald Gemeinden: Blankensee, Hintersee, Koblentz, Rothenklempenow, Viereck und Zerrenthin Aktenzeichen: F4811021 (bitte bei Schriftverkehr angeben) Ausfertiqunq Öffentliche Bekanntmachung Ladung zur Bekanntgabe und Erläuterung des Bodenordnungsplanes, sowie zum Anhörungstermin im Bodenordnungsverfahren Rothenklempenow In dem Bodenordnungsverfahren Rothenklempenow wurden gemäß § 59 Abs. 3 Landwirt- schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) in Verbindung mit § 59 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG)vom 16. März 1976 (BGBI. I S. 546) die Termine zur Auslegung, Bekanntgabe und Erläuterung des Bodenordnungsplanes sowie zum Anhörungstermin festgesetzt. Zu diesen Terminen werden die Beteiligten gemäß § 10 FlurbG u.a. die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zum Verfahrensgebiet gehörenden Grundstücke, die Inhaber von Rechten an diesen, die zum Besitz oder zur Nutzung berechtigen, die Empfänger von neuen Grundstücken sowie die Eigentümer der an der Grenze des Verfahrensgebietes anliegenden Flurstücke, soweit sie bei der Festlegung der Verfahrensgrenze bezüglich Grenzfeststellung und Abmarkung nach Katasterrecht zu beteiligen sind und eine Beteiligung bisher unter- blieben ist, geladen. Auslegung, Bekanntaabe und Erläuterung des Bodenordnunasplanes: Aus dem Bodenordnungsplan werden den Beteiligten die sie betreffenden Auszüge -

12 - 1 - Amtsblatt Löcknitz-Penkun
Nr. 06/2012 - 1 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN Jahrgang 7 19. Juni 2012 Nr. 06 AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN - 2 - Nr. 06/2012 Nr. 06/2012 - 3 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN IN EIGENER SACHE – WICHTIGER HINWEIS Inhaltsverzeichnis Wir möchten ab sofort darum bitten, alle Texte zur Veröffentlichung Amtliches: im Amtsblatt digital einzureichen, also in einem gängigen Textver- - Hauptsatzung des Amtes Löcknitz-Penkun 4 arbeitungsprogramm getippt und abgespeichert auf einer Disket- - Bekanntmachung nach § 3a Satz 2,2. Halbsatz des te, CD oder als E-Mail senden. Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung – Außerdem sollte ein Ausdruck Ihres Beitrages und das Bildmate- (Bodenordnungsverfahren Ramin) 6 rial vorgelegt werden. Fotos können evt. (wenn sie nicht als Datei - Öffentliche Bekanntmachung des Fundbüro 6 vorliegen) nach wie vor im Original eingereicht werden. Ansonsten - Öffentliche Bekanntmachung über die Einziehung einer kann Ihr Beitrag ggf. nicht berücksichtigt werden! öffentlichen Verkehrsfläche im Bereich des Amtes Löcknitz-Penkun, Gewerbegebiet „Klar-See“ 6 Sollten Sie nicht in der Lage sein, digitale Daten abzuliefern, kön- nen Sie in Ausnahmefällen mit dem Amt Löcknitz-Penkun unter - 1. Ausfertigung – Öffentliche Bekanntmachung Tel. 039754/50128 eine Sondervereinbarung treffen. Schlussfeststellung (Bodenordnungsverfahren Bismark) 8 - Bekanntmachung – Umlegung nach dem Baugesetzbuch Vielen Dank für Ihr Verständnis! (BauGB) Verfahren Baulandumlegung „Schwarzer Damm“ 8 - Bekanntmachung – Umlegung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) Verfahren Baulandumlegung „Schwarzer Damm“ 9 - Entsorgungstermine Juli/August/September 9 - Geburtstagsgratulationen Juli 11 Die nächste Ausgabe - Geburtstagsgratulationen August 12 Sonstiges: AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN - Preußens Schotten (Teil 2) 13 erscheint am Dienstag, dem 14.08.2012. - Veranstaltungskalender des Amtsbereiches 15 - 725 Jahre Bergholz – Festprogramm 16 Redaktionsschluss ist am 31.07.2012. - 2013 wird das Löcknitzer Mandolinenorchester 50 Jahre alt 16 Anzeigenschluss ist am 02.08.2012. -

Microfilm Index to the Mecklenburg-Schwerin Volkszählung (Census) 1819
Microfilm Index to the Mecklenburg-Schwerin Volkszählung (Census) 1819 A number in parenthesis after the film number indicates the item number Town Type District Pt Parish Film Page Adamsdorf (Kuhstall) RA Stavenhagen 1 Peckatel 68,902 1-2 Adamshoffnung RA Lübz 2 Kloster Malchow 68,888 7-8 Ahrensberg RA Wredenhagen Ahrensberg 68,908 1-8 Ahrensfelde RA Wredenhagen Krümmel 68,908 114 Alt Gaarz RA Lübz 1 Kirch Lütgendorf 68,888 36–46 Alt Kätwin RA Güstrow 2 Cammin 68,916 129–133 Alt Rehse RA Stavenhagen 2 Alt Rehse 68,903 33-41 Alt Sammit [Alt Samnit] RA Lübz 1 Krakow 68,888 152–160 Alt Schwerin RA Plau Alt Schwerin 68,894 23-28 Altbauhof DA Stavenhagen Stavenhagen 68,902 7-12 Altenhagen KA Dobbertin Lohmen 68,919 101-105 Amalienhof RA Güstrow 3 Warnkenhagen 68,916 2-3 Amalienhof RA Neustadt 1 Rechlin 68,893 44 Amt und Bauhof [Goldberg] DA Goldberg Goldberg 68,883 2-8 Amtsbrinck, Amt [Stavenhagen] DA Stavenhagen Stavenhagen 68,902 1-6 Ankershagen RA Neustadt 1 Ankershagen 68,893 1-27 Appelhagen RA Güstrow 3 Thürkow 68,916 4-7 Augusthof [Augustenhof] RA Wredenhagen Kambs 68,908 209 Augzin DA Goldberg Techentin 68,883 10-15 Ave RA Neustadt 1 Gr. Lukow 68,893 30-38 Badendiek [Neu Badendiek] DA Güstrow Badendiek 68,886 38-58 Bansow RA Güstrow 3 Lübsee 68,916 8-11 Bartelshagen RA Güstrow 1 Warnkenhagen 68,916 7-9 Barz RA Stavenhagen 3 Kirch Grubenhagen 68,903 1 Basedow RA Stavenhagen 1 Basedow 68,902 7-23 Basedower Teerofen RA Stavenhagen 1 Basedow 68,902 49-51 Basepohl RA Ivenack Ivenack 68,916(4) 20-28 Bauhof mit Schäferei [Güstrow] DA Güstrow Güstrow, Dom 68,886 145-153 Baumgarten RA Neustadt 2 Vielist 68,893 2-5 Beckenkrug RA Stavenhagen 2 Varchentin 68,903 431 Belitz RA Güstrow 1 Belitz 68,916 11–18 Bellin m. -

1/110 Allemagne (Indicatif De Pays +49) Communication Du 5.V
Allemagne (indicatif de pays +49) Communication du 5.V.2020: La Bundesnetzagentur (BNetzA), l'Agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer, Mayence, annonce le plan national de numérotage pour l'Allemagne: Présentation du plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +49 (Allemagne): a) Aperçu général: Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 3 chiffres Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 13 chiffres (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 chiffres Services de radiomessagerie (NDC 168, 169): 14 chiffres) b) Plan de numérotage national détaillé: (1) (2) (3) (4) NDC (indicatif Longueur du numéro N(S)N national de destination) ou Utilisation du numéro E.164 Informations supplémentaires premiers chiffres du Longueur Longueur N(S)N (numéro maximale minimale national significatif) 115 3 3 Numéro du service public de l'Administration allemande 1160 6 6 Services à valeur sociale (numéro européen harmonisé) 1161 6 6 Services à valeur sociale (numéro européen harmonisé) 137 10 10 Services de trafic de masse 15020 11 11 Services mobiles (M2M Interactive digital media GmbH uniquement) 15050 11 11 Services mobiles NAKA AG 15080 11 11 Services mobiles Easy World Call GmbH 1511 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1517 -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -
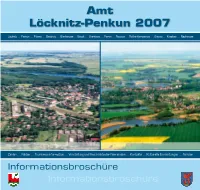
Amt Löcknitz-Penkun 2007
Amt Löcknitz-Penkun 2007 Löcknitz … Penkun … Plöwen … Bergholz … Blankensee … Boock … Grambow … Ramin … Rossow … Rothenklempenow … Glasow … Krackow … Nadrensee Zahlen … Fakten … Tourismusinformation … Vorstellung und Geschichte der Gemeinden … Kontakte … Kulturelle Einrichtungen … Schulen Informationsbroschüre Informationsbroschüre Karin Domschke oHG Öffnungszeiten: Mo.-Sa. 7.00-20.00 Uhr � Präsente für jede Gelegenheit � Wurst-, Käse-, Obstplatten � Freihauslieferung � Ware auf Kommission für Familienfeiern � Blumenshop Jeden Tag ein � Postagentur bisschen besser. Regionen, die auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet grenz- Besuchen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie. überschreitend zusammenarbeiten, spielen für die europäische Chausseestraße 90a � 17321 Löcknitz Entwicklung eine wichtige Rolle. Sie unterstützen die Verständi- Telefon 03 97 54 / 2 00 64 � Fax 03 97 54 / 2 01 30 gung und Annäherung der beteiligten Bevölkerung, Institutionen und Unternehmen. Vor diesem Hintergrund wurde im Jahr 1992 www.rewe.de der Verein Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. gegründet. Elektromaschinen e. G. Die Kommunalgemeinschaft ist Gründungsmitglied der EUROREGION Löcknitz POMERANIA (Gründungsvertrag Dezember 1995), in der heute Polen, Schweden (seit Februar 1998) und Deutsche gleichberech- tigt zusammenarbeiten. Derzeitige Mitglieder des Vereins sind die Landkreise Rügen, Nordvorpommern, Demmin, Ostvorpommern, Mecklenburg- Strelitz, Uecker-Randow, Uckermark und Barnim, die kreisfreien Leistungen rund um die elektrische Maschine Städte -

Stellungnahme RREP Vorpommern 2019
Regionaler Planungsverband Vorpommern Landesgeschäftsstelle Geschäftsstelle Am Gorzberg, Haus 8 Leonie Nikrandt 17489 Greifswald Naturschutzreferentin Tel. 01520 4174644 [email protected] Stellungnahme des NABU Mecklenburg-Vorpommern zum Entwurf 2018 Greifswald, 23. Januar 2019 zum vierten Beteiligungsverfahren der zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern mit dazugehörigem Umweltbericht Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Stellungnahme konzentriert sich vor allem auf die fehlerhafte Abwägung verschiedener Aspekte des Artenschutzes im bisherigen Verfahren und im vorliegenden Entwurf. Dem Artenschutz sind die meisten, wenn auch nicht alle naturschutzfachlichen Probleme zuzuordnen, die durch die Errichtung und den Betrieb von Windkraftanlagen (WKA) entstehen können. 1 Stellungnahme des NABU Mecklenburg-Vorpommern zum Entwurf der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern (Vierte Auslegung) – 23. Januar 2019 Der NABU Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat bereits mehrfach zum Entwurf der Zweiten Änderung des RREP Vorpommern Stellung genommen. Zuletzt geschah dies mit unserer Stellungnahme vom 17. Juli 2017 im Rahmen der dritten Auslegung der Unterlagen. Die wesentlichen Dinge scheinen uns gesagt. Die vorliegende Stellungnahme ist eine ergänzte und angepasste Fassung unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2017. Änderungen des Textes waren erforderlich in Reaktion auf Änderungen der Flächenkulisse der Windeignungsgebiete neue Erkenntnisse zu möglichen Artenschutzkonflikten einige Ausführungen in der Abwägung -

Vorpommern-Greifswald Können Sie Hier Herunterladen
MIT DEM RAD AUF ENTDECKUNGSTOUR durch die Gutshauslandschaft Vorpommerns Teil II – Vorpommern-Greifswald INHALTSVERZEICHNIS Einführung S. 4 Gutshausrouten Route 1A – Entlang der Dänischen Wiek S. 7 Route 1B – Greifswalder Landschaft S. 8 Route 2 – Beidseits der Tollense S. 15 Route 3 – Nördlich der Peene S. 25 Route 4 – Lassaner Winkel S. 33 Route 5 – Zwischen Achterwasser und Haff S. 41 Route 6 – Landgrabental S. 47 Route 7 – Ueckermünder Heide S. 55 Route 8 – Rund um die Brohmer Berge S. 61 Route 9 – Beidseits der Randow S. 69 Route 10 – Östlich des Randowbruchs S. 75 Literatur S. 82 Informationen S. 83 MIT DEM RAD AUF ENTDECKUNGSTOUR durch die Gutshauslandschaft Vorpommerns Teil II – Vorpommern-Greifswald Einführung Nachdem wir im Jahr 2013 die Radwanderbroschüre zu Guts- und Parkanlagen im Landkreis-Vorpommern-Rügen erstellt haben und diese sich großer Beliebtheit erfreut hat, folgt nun die Fortsetzung mit dem zweiten Teil für den Landkreis Vorpommern- Greifswald. In dieser Broschüre werden elf verschiedene Routen vorgestellt, die dazu einladen, die Guts- und Herrenhäuser und die dazugehörigen Anlagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit dem Fahrrad zu erkunden. Neben diesen Anlagen sind auch weitere Sehenswürdigkeiten wie bezaubernde Alleen, kleine Dorfkirchen, histo- rische Ortskerne und vor allem die abwechslungsreiche Landschaft mit ihrem unver- wechselbaren vorpommerschen Gepräge zu entdecken. Radeln in Vorpommern ist dank der überwiegend flachen Topographie auch für Unge- übte zu empfehlen. Die leicht hügelige Landschaft macht das Radfahren einfach und die wenigen Steigungen sind gut zu meistern. Zu den einzelnen Routen wurden zwar Empfehlungen zum Richtungsverlauf gegeben, es ist jedoch an windigen Tagen ratsam, die Streckenrichtung vor Ort so zu legen, dass Sie Gegenwind und somit unnötige Anstrengungen vermeiden. -

Ortschaften Mit Gasnetz Im Land Mecklenburg-Vorpommern
Ortschaften mit Gasnetz im Land Mecklenburg-Vorpommern Gemeinde- Landkreis PLZ Gemeinde Ortsteil schlüssel Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Alt Panekow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Altkalen Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Granzow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Kleverhof Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Neu Panekow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Alt Vorwerk Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Boddin Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Groß Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Klein Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Neu Vorwerk Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Dahmen Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Großen Luckow Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Ziddorf Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Dölitz Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Gnoien Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Groß Roge Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Klein Roge Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Groß Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Neu Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Nienhagen Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Uhlenhof Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Groß Wüstenfelde Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Schwetzin Landkreis Rostock 13072045 17166 Hohen Demzin OT Hohen Demzin Landkreis Rostock 13072049 17168 Jördenstorf OT Jördenstorf Landkreis Rostock 13072068 17179 Lühburg -

Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern 11.02.2020 Gebietsstand : 31.12.2018
Kassenärztliche Vereinigung Seite : 1 Mecklenburg-Vorpommern Gemeindeverzeichnis Mecklenburg-Vorpommern 11.02.2020 Gebietsstand : 31.12.2018 Amtlicher PLZ Gemeinde- Gemeinde Mittelbereich Kreis / Kreisregion Raumordnungsregion schlüssel 17033 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17034 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17036 13 071 107 Neubrandenburg, Stadt Neubrandenburg Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 009 Beseritz Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 010 Blankenhof Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 019 Brunn Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 104 Neddemin Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 108 Neuenkirchen Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 111 Neverin Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 140 Sponholz Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 141 Staven Neubrandenburg-Umland Neubrandenburg / Mecklenburg-Strelitz Mecklenburgische Seenplatte 17039 13 071 145 Trollenhagen Neubrandenburg-Umland -

Nr. 05/2014 - 1 - Amtsblatt Löcknitz-Penkun
Nr. 05/2014 - 1 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN Jahrgang 9 20. Mai 2014 Nr. 05 AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN - 2 - Nr. 05/2014 Nr. 05/2014 - 3 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN - 4 - Nr. 05/2014 Inhaltsverzeichnis Amtliches Sonstiges - Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 - 21. Schützen- und Gemeindefest, Programm 3 des Amtes Löcknitz-Penkun 5 - Gratulationen im Juni 2014 15 - Haushaltssatzung des Amtes Löcknitz-Penkun für das - Gratulationen im Juli 2014 16 Haushaltsjahr 2014 5 - 10. Amtsfeuerwehrtag des Amtes Löcknitz-Penkun 17 - Bekanntmachung der Stadt Penkun – - Einladung zum 2. Kreisfeuerwehrtag des Landes Bebauungsplan Nr. 2 „Wollin-Wohngebäude am Vorpommern-Greifswald 17 Dorfsee“ der Stadt Penkun 6 - 700 Jahre Rossow, Ein kurzer Blick in die Ortsgeschichte 19 - Hauptsatzung der Gemeinde Glasow 7 - Die Landung der „Kings German Legion“ in Pommern, - Hauptsatzung der Gemeinde Krackow 8 Sommer 1807 20 - Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses – - Dampflokgiganten im Ruhestand, Ergänzungssatzung Sportplatz der Stadt Penkun 10 An der südafrikanischen „Garden Route“ liegt das - Bekanntmachung über öffentliche Zustellung der Outeniqua Transport Museum, Teil 1 22 Benachrichtigung über die Feststellung und Abmarkung - Aktuelle Veranstaltungen im Amtsbereich 23 von Flurstücksgrenzen 11 - 750-Jahrfeier Radekow, Ablaufplan 23 - Bekanntmachung – Planfeststellung für den Neubau - Einladung zu 750 Jahre Radekow 23 der Radverkehrsanlage B 104 Rossow-Löcknitz, - Einladung zum Chortreffen 24 Abschnitt 970 km 0,165 bis Abschnitt 970 km 4,325 11 - Einladung zur 725-Jahrfeier 24 - Bekanntmachung – Planfeststellung für die Rad- - Der Heimat- und Burgverein lädt ein 24 verkehrsanlage B 104 Zerrenthin-Rossow, - Geführte Wanderung „Trockene Vielfalt“ 25 Abschnitt 965 km 0,023 bis Abschnitt 965 km 2,865 12 - Geführte Wanderung „Vögel, Orchideen u.