Auerswald…Ira Richling, Klaus Groh
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

CLECOM-Liste Österreich (Austria)
CLECOM-Liste Österreich (Austria), mit Änderungen CLECOM-Liste Österreich (Austria) Phylum Mollusca C UVIER 1795 Classis Gastropoda C UVIER 1795 Subclassis Orthogastropoda P ONDER & L INDBERG 1995 Superordo Neritaemorphi K OKEN 1896 Ordo Neritopsina C OX & K NIGHT 1960 Superfamilia Neritoidea L AMARCK 1809 Familia Neritidae L AMARCK 1809 Subfamilia Neritinae L AMARCK 1809 Genus Theodoxus M ONTFORT 1810 Subgenus Theodoxus M ONTFORT 1810 Theodoxus ( Theodoxus ) fluviatilis fluviatilis (L INNAEUS 1758) Theodoxus ( Theodoxus ) transversalis (C. P FEIFFER 1828) Theodoxus ( Theodoxus ) danubialis danubialis (C. P FEIFFER 1828) Theodoxus ( Theodoxus ) danubialis stragulatus (C. P FEIFFER 1828) Theodoxus ( Theodoxus ) prevostianus (C. P FEIFFER 1828) Superordo Caenogastropoda C OX 1960 Ordo Architaenioglossa H ALLER 1890 Superfamilia Cyclophoroidea J. E. G RAY 1847 Familia Cochlostomatidae K OBELT 1902 Genus Cochlostoma J AN 1830 Subgenus Cochlostoma J AN 1830 Cochlostoma ( Cochlostoma ) septemspirale septemspirale (R AZOUMOWSKY 1789) Cochlostoma ( Cochlostoma ) septemspirale heydenianum (C LESSIN 1879) Cochlostoma ( Cochlostoma ) henricae henricae (S TROBEL 1851) - 1 / 36 - CLECOM-Liste Österreich (Austria), mit Änderungen Cochlostoma ( Cochlostoma ) henricae huettneri (A. J. W AGNER 1897) Subgenus Turritus W ESTERLUND 1883 Cochlostoma ( Turritus ) tergestinum (W ESTERLUND 1878) Cochlostoma ( Turritus ) waldemari (A. J. W AGNER 1897) Cochlostoma ( Turritus ) nanum (W ESTERLUND 1879) Cochlostoma ( Turritus ) anomphale B OECKEL 1939 Cochlostoma ( Turritus ) gracile stussineri (A. J. W AGNER 1897) Familia Aciculidae J. E. G RAY 1850 Genus Acicula W. H ARTMANN 1821 Acicula lineata lineata (DRAPARNAUD 1801) Acicula lineolata banki B OETERS , E. G ITTENBERGER & S UBAI 1993 Genus Platyla M OQUIN -TANDON 1856 Platyla polita polita (W. H ARTMANN 1840) Platyla gracilis (C LESSIN 1877) Genus Renea G. -

The Long-Term Transformations of Gastropod Communities in Damreservoirs
Malacologica Bohemoslovaca (2005), 4: 41–47 ISSN 1336-6939 The long-term transformations of Gastropod communities in dam- reservoirs of Upper Silesia (Southern Poland) MAŁGORZATA STRZELEC, ANETA SPYRA, MARIOLA KRODKIEWSKA & WŁODZIMIERZ SERAFIŃSKI Department of Hydrobiology, University of Silesia, Bankowa 9, P- 40-007 Katowice, Poland, e-mail [email protected] STRZELEC M., SPYRA A., KRODKIEWSKA M. & SERAFIŃSKI W., 2005: The long-term transformations of Gastropod communities in dam-reservoirs of Upper Silesia (Southern Poland). – Malacologica Bo- hemoslovaca, 4: 41–47. Online serial at <http://mollusca.sav.sk> 19-Dec-2005. Studies on snail communities in nine dam reservoirs in Upper Silesia were carried out in two periods: 1980–90 and 1995–2004. The observed changes referred to domination patterns. There was found that after introduction of two alien gastropods Physella acuta and Potamopyrgus antipodarum they became the dominants in four reservoirs by the simultaneous percentage decrease of earlier native dominants. The species density decreased in second study period in five reservoirs, mainly in effect of alien spe- cies invasion, but in some cases in consequence of various human interventions. Taking into account the whole collection the commonest species in the first study period were Radix peregra and Planorbis planorbis, while Radix peregra, Potamopyrgus antipodarum, and Physella acuta in the second. Inex- plicable is however the mass occurrence of Valvata piscinalis in Żywiecki dam reservoir, because in whole Soutern Poland it is one of rarest snail species both in rivers and stagnant water bodies. Introduction periodical or irregular fluctuation in water level affect negatively the formation of littoral zone, what is then The dam reservoirs originate by the damming of riv- the cause of poor vegetation development in it. -
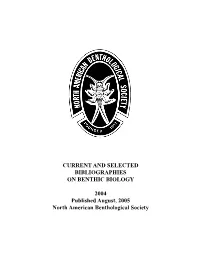
Nabs 2004 Final
CURRENT AND SELECTED BIBLIOGRAPHIES ON BENTHIC BIOLOGY 2004 Published August, 2005 North American Benthological Society 2 FOREWORD “Current and Selected Bibliographies on Benthic Biology” is published annu- ally for the members of the North American Benthological Society, and summarizes titles of articles published during the previous year. Pertinent titles prior to that year are also included if they have not been cited in previous reviews. I wish to thank each of the members of the NABS Literature Review Committee for providing bibliographic information for the 2004 NABS BIBLIOGRAPHY. I would also like to thank Elizabeth Wohlgemuth, INHS Librarian, and library assis- tants Anna FitzSimmons, Jessica Beverly, and Elizabeth Day, for their assistance in putting the 2004 bibliography together. Membership in the North American Benthological Society may be obtained by contacting Ms. Lucinda B. Johnson, Natural Resources Research Institute, Uni- versity of Minnesota, 5013 Miller Trunk Highway, Duluth, MN 55811. Phone: 218/720-4251. email:[email protected]. Dr. Donald W. Webb, Editor NABS Bibliography Illinois Natural History Survey Center for Biodiversity 607 East Peabody Drive Champaign, IL 61820 217/333-6846 e-mail: [email protected] 3 CONTENTS PERIPHYTON: Christine L. Weilhoefer, Environmental Science and Resources, Portland State University, Portland, O97207.................................5 ANNELIDA (Oligochaeta, etc.): Mark J. Wetzel, Center for Biodiversity, Illinois Natural History Survey, 607 East Peabody Drive, Champaign, IL 61820.................................................................................................................6 ANNELIDA (Hirudinea): Donald J. Klemm, Ecosystems Research Branch (MS-642), Ecological Exposure Research Division, National Exposure Re- search Laboratory, Office of Research & Development, U.S. Environmental Protection Agency, 26 W. Martin Luther King Dr., Cincinnati, OH 45268- 0001 and William E. -

(Mollusca) of the Slovak Republic
Vol. 15(2): 49–58 CHECKLIST OF THE MOLLUSCS (MOLLUSCA) OF THE SLOVAK REPUBLIC TOMÁŠ ÈEJKA*, LIBOR DVOØÁK, MICHAL HORSÁK, JOZEF ŠTEFFEK *Correspondence: Institute of Zoology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, SK-84506 Bratislava, Slovak Republic (e-mail: [email protected]) ABSTRACT: The checklist of 245 mollusc species known so far from the Slovak Republic is presented, plus 11 species limited to greenhouses or thermal waters. Critical comments on species erroneously mentioned in re- cent publications from Slovakia are included. KEY WORDS: Mollusca, checklist, Slovak Republic INTRODUCTION Research of Slovak molluscs started at the begin- cal evaluation of the previously published checklists ning of the 20th century (CSIKI 1918). In the first half (BANK et al. 2001, ŠTEFFEK &GREGO 2002). We deci- of the 20th century J. F. BABOR and later also his col- ded to use the monograph Molluscs of Slovakia (LI- league J. PETRBOK worked on the Slovak malaco- SICKÝ 1991) as the most suitable baseline because it fauna. Unfortunately their publications were not sys- contains the most recent reliable list of Slovak tematic and especially not critical enough, resulting molluscs. Therefore the original literature sources in erroneous records of some mollusc species in Slo- are given for all the species first recorded in the Slo- vakia (LISICKÝ 1991). The situation changed after vak Republic after 1982. World War II. The work of the new generation of The checklist of Slovak molluscs published by ŠTEF- malacologists resulted in a reliable knowledge about FEK &GREGO (2002) has several shortcomings. The the fauna. The entire research was dominated by the authors uncritically adopted many taxa from the work of V. -

Format Mitteilungen
9 Mitt. dtsch. malakozool. Ges. 86 9 – 12 Frankfurt a. M., Dezember 2011 Under Threat: The Stability of Authorships of Taxonomic Names in Malacology RUUD A. BANK Abstract: Nomenclature must be constructed in accordance with agreed rules. The International Commission on Zoological Nomenclature was founded in Leiden in September 1895. It not only produced a Code of nomencla- ture, that was refined over the years, but also provided arbitration and advice service, all with the aim of ensur- ing that every animal has one unique and universally accepted name. Name changes reduce the efficiency of biological nomenclature as a reference system. The Code was established to precisely specify the circumstances under which a name must be changed, and in what way. Name changes are only permitted if it is necessitated by a correction of nomenclatural error, by a change in classification, or by a correction of a past misidentification. Also authorships are regulated by the Code, mainly by Article 50. In a recent paper by WELTER-SCHULTES this Article is interpreted in a way that is different from previous interpretations by the zoological (malacological) community, leading to major changes in authorships. It is here argued that his alternative interpretations (1) are not in line with the spirit of the Code, and (2) will not serve the stability of nomenclature. It is important that interpretation and application of the existing rules be objective, consistent, and clear. Keywords: authorships, malacology, nomenclature, Code, ICZN, Article 50, Pisidium Zusammenfassung: In der Nomenklatur müssen übereinstimmende Regeln gelten. Die Internationale Kommis- sion für Zoologische Nomenklatur (ICZN) wurde im September 1895 in Leiden gegründet. -

ON the ECOLOGY and SPECIES DIVERSITY of the FRESHWATER GASTROPODS of SPRINGS in ANDIJAN REGION, UZBEKISTAN Abduvaiet P. Pazilov*
Pazilov and Umarov Bull. Iraq nat. Hist. Mus. (2021) 16 (3): 325-340. https://doi.org/10.26842/binhm.7.2021.16.3.0325 ON THE ECOLOGY AND SPECIES DIVERSITY OF THE FRESHWATER GASTROPODS OF SPRINGS IN ANDIJAN REGION, UZBEKISTAN Abduvaiet P. Pazilov* and Farrukh U. Umarov** * Department of Biology, Gulistan State University, Gulistan, Uzbekistan. **Department of Ecology and Botany, Andijan State University, Andijan Uzbekistan. **Corresponding author: [email protected] Received Date: 17 April 2021, Accepted Date: 20 May 2021, Published Date: 20 Jun 2021 ABSTRACT This study examines the species composition, biodiversity, zoogeography, and ecology of freshwater gastropods of 12 springs in Andijan region of Uzbekistan. The study used generally accepted malacological, faunistic, ecological, analytical, and statistical methods. As a result of research in the springs, 14 species of freshwater gastropods belonging to 2 subclasses, 5 families, and 10 genera were recorded. 7 of them are endemic to Central Asia. When indicators of biodiversity of mollusks were analyzed according to the Shannon index, it was found that the highest value was recorded in the springs besides the hills. According to the biotope of distribution and bioecological features, they were divided into cryophilic, phytophilic, pelophilic, and eurybiontic ecological groups. The mollusks, which are common in the springs, were divided into 3 groups according to their faunal similarity. The contribution of the Central Asian and European-Siberian species to the formation of the malacofauna in the springs of the Andijan region was significant. Keywords: Andijan, Biodiversity, Ecology, Freshwater Gastropods, Spring. INTRODUCTION Springs are one of the water basins in need of protection, because they were separated from the water basins, and allowed for the emergence of rare and endemic species; one of the most common organisms among them is Mollusca group (Izzatullayev et al., 2013). -

European Red List of Non-Marine Molluscs Annabelle Cuttelod, Mary Seddon and Eike Neubert
European Red List of Non-marine Molluscs Annabelle Cuttelod, Mary Seddon and Eike Neubert European Red List of Non-marine Molluscs Annabelle Cuttelod, Mary Seddon and Eike Neubert IUCN Global Species Programme IUCN Regional Office for Europe IUCN Species Survival Commission Published by the European Commission. This publication has been prepared by IUCN (International Union for Conservation of Nature) and the Natural History of Bern, Switzerland. The designation of geographical entities in this book, and the presentation of the material, do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IUCN, the Natural History Museum of Bern or the European Union concerning the legal status of any country, territory, or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The views expressed in this publication do not necessarily reflect those of IUCN, the Natural History Museum of Bern or the European Commission. Citation: Cuttelod, A., Seddon, M. and Neubert, E. 2011. European Red List of Non-marine Molluscs. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Design & Layout by: Tasamim Design - www.tasamim.net Printed by: The Colchester Print Group, United Kingdom Picture credits on cover page: The rare “Hélice catalorzu” Tacheocampylaea acropachia acropachia is endemic to the southern half of Corsica and is considered as Endangered. Its populations are very scattered and poor in individuals. This picture was taken in the Forêt de Muracciole in Central Corsica, an occurrence which was known since the end of the 19th century, but was completely destroyed by a heavy man-made forest fire in 2000. -

The 21St Polish Malacological Seminar
Vol. 13(3): 115–144 THE 21ST POLISH MALACOLOGICAL SEMINAR SEMINAR REPORT The 2005 Polish Malacological Seminar was held the meeting. As a result the participants were much on the 6th and 7th of April, in Ciechocinek, a little fewer than originally expected – the intial list in- spa just south-east of the city of Toruñ. The spa is fa- cluded about 80 people, and only about 40 actually ar- mous for its beneficial effects on some patients, but - rived. The banquet was cancelled and the Seminar being located on a very flat plain and surrounded by lasted only two days instead of the usual three. An- completely unmalacological habitats – it is not very other reason for sadness was the departure of our col- beautiful. It is also difficult to get to, at least from league from S³upsk – ZBYSZEK PIESIK – who died of some places in Poland and at least for those who are bone cancer a few months before the Seminar. not posh enough to have a car. The Wroc³aw contin- This year all the participants, except one, were Pol- gent had to change trains twice, and the last leg of the ish; though some of our Ukrainian and Russian col- journey lasted only 5 minutes (though the first lasted leagues initially intended to come, they never ap- about 5 hours). The Warsaw contingent, travelling on peared and only submitted their abstracts. The Sem- a bus, got there a few hours late because of some acci- inar volume contains 70 abstracts of oral presenta- dent on one of the bridges across the Vistula River tions and posters (though actual presentations were (the ONLY bridge in P³ock). -

Фауна Брюхоногих Моллюсков Семейства Planorbidae (Mollusca, Gastropoda) Реки Бий-Хем (Бассейн Верхнего Енисея)
ФАУНА БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ СЕМЕЙСТВА PLANORBIDAE (MOLLUSCA, GASTROPODA) РЕКИ БИЙ-ХЕМ (БАССЕЙН ВЕРХНЕГО ЕНИСЕЯ) М.О. Шарый-оол Биолого-почвенный институт ДВО РАН, пр. 100–летия Владивостока, 159, Влади- восток, 690022 Россия. E-mail: [email protected] Фауна брюхоногих моллюсков семейства Planorbidae реки Бий-Хем (Большой Енисей) бассейна верхнего Енисея состоит из 20 видов 2 родов. Составлен аннотированный список пресноводных брюхоногих моллюсков семейства Planorbidae Государственного природного заповедника «Азас» и прилегающей территории Тоджинской котловины Республики Тыва. Список основан на оригинальных данных. Для каждого вида в списке приведены сведения по распространению и экологии, и для некоторых видов – номен- клатурные замечания. Основу фауны планорбид составляют виды с палеарктическим типом распространения (45 %), на долю сибирских видов приходится 30 %. FRESHWATER MOLLUSCAN FAUNA (MOLLUSCA, GASTROPODA, PLANORBIDAE) OF BII-KHEM RIVER (UPPER ENISEY BASIN) M.О. Sharyi-ool Institute of Biology and Soil Sciences, Russian Academy of Sciences, Far East Branch, 100 let Vladivostoku Avenue 159, Vladivostok, 690022 Russia. E-mail: [email protected] Gastropod molluscan fauna (Planorbidae) of Bii-Khem River (upper Enisey basin) includes 20 species of 2 genera. An annotated checklist of the freshwater molluscan fauna of Planorbidae of Azas State Natural Reserve and adjacent territories of Todzha Hollow, Tuva Republic is presented. This checklist is based primarily on original data. The data on distribution and ecology and some nomenclatural notes are given. Most recorded species (45 %) are Palaearctic and 30 % of all species have Siberian distribution. Введение Несмотря на длительную историю изучения пресноводной малакофауны Восточной Сибири и бассейна Енисея (Middendorff, 1851; Maack, 1854; Westerlund, 1876a, 1876b, 1885) самый верхний участок на территории Тувы недостаточно исследован. -

Glöer, P., Zettler, M.L. 2005
Malak. Abh. 23: 3–26 3 Kommentierte Artenliste der Süßwassermollusken Deutschlands PETER GLÖER 1 & MICHAEL L. ZETTLER 2 1 Schulstrasse 3, D-25491 Hetlingen, Germany; [email protected] 2 Institut für Ostseeforschung Warnemünde, Seestr. 15, D-18119 Rostock, Germany; [email protected] Abstract. An annotated check-list of the freshwater molluscs of Germany. – By considering the international code of zoological nomenclature, a critical annotated check-list for the freshwater molluscs of Germany is introduced, considering the currently used check-lists of GLÖER & MEIER- BROOK (1998), FALKNER et al. (2001), GLÖER (2002) und GLÖER & MEIER-BROOK (2003). As a basis of this list we used the CLECOM list (FALKNER & al. 2001), and the 1st update of the CLECOM list (BANK et al. 2001). In total 66 taxa are discussed or annotated. Meanwhile 15 taxa where deleted, because we do not think that these are distinct species or subspecies. This concerns particularly the subspecies of the Unionidae, which are not to be determinated seriously without the knowledge of the sampling site. In 5 taxa we changed the names given in the CLECOM list by established names, these are: Bithynia transsilvanica = B. troschelii, Anisus septemgyratus = A. leucostoma, A. calculiformis = A. septemgyratus, Ferrissia clessiniana = F. wautieri, Mytilopsis leucophaeata = Congeria leucophaeata. Finally we gave two subspecies the rank of species: Pisidum ponderosum and Pisidium crassum. Kurzfassung. Unter Beachtung der internationalen Regeln für die zoologische Nomenklatur, wird auf der Basis der derzeit verwendeten systematischen Listen von GLÖER & MEIER-BROOK (1998), FALKNER et al. (2001), GLÖER (2002) und GLÖER & MEIER-BROOK (2003) eine kritische, kommentierte Artenliste für die Süßwassermollusken in Deutschland vorgestellt. -

Drie Soorten Planorbidae Nieuw Voor De Belgische Fauna (Mollusca, Gastropoda)
VERHANDELINGEN VAN HET SYMPOSIUM "INVERTEBRATEN VAN BELGIE", 1989, p. 113-118 COMPTES RENDUS DU SYMPOSIUM "INVERTEBRES DE BELGIQUE", 1989, p. 113-118 Drie soorten Planorbidae nieuw voor de Belgische fauna (Mollusca, Gastropoda) door Rose SABLON & J.L. VAN GOETHEM Abstract de gemeenschappelijke kenmerken, alsook de verschil- len, duidelijk tot uiting te laten komen. As a result of rechecking all the identifications of freshwater snails in the Binnen het kader van deze publikatie willen we ons Belgian mollusc collection of the R.B.I.N.S., three new species for the beperken tot de schelpkenmerken. Het ligt voor de Belgian fauna, belonging to the family Planorbidae, were found: Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758), Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) and hand dat men, in geval van twijfel, dient over te gaan tot Gyraulus acronicus (de FERUSSAC, 1807). een anatomisch onderzoek van het genitaalapparaat, Each of these species is compared with a related species. A brief teneinde tot een juiste diagnose te kunnen komen. In dit description of their common and of their differentiating characteristics artikel wordt daarom ook verwezen naar literatuur is given. Key-words: Mollusca, Belgian fauna, Anisus, Gyraulus, taxonomy. waarin de anatomische verschillen tussen de verwante soorten beschreven zijn. Resume La revision des gasteropodes d'eau douce de la collection beige de Taxonomie 1'I.R.Sc.N.B. a permis de trouver trois especes nouvelles pour la faune beige, appartenant a la familie des Planorbidae: Anisus spirorbis (LINNAEUS, 1758), Anisus vorticulus (TROSCHEL, 1834) et Gyraulus 1. Anisus leucostomus versus Anisus spirorbis acronicus (de FERUSSAC, 1807). Chaque espece est comparee a une espece voisine par une description succincte de leurs caracteres communs et differentiels. -

Lietuvos Moliuskų Sąrašas/Check List of Mollusca Living in Lithuania
LIETUVOJE GYVENANČIŲ MOLIUSKŲ TAKSONOMINIS SĄRAŠAS Parengė Albertas Gurskas Duomenys atnaujinti 2019-09-05 Check list of mollusca in Lithuania Compiled by Albertas Gurskas Updated 2019-09-05 TIPAS. MOLIUSKAI – MOLLUSCA Cuvier, 1795 KLASĖ. SRAIGĖS (pilvakojai) – GASTROPODA Cuvier, 1795 Poklasis. Orthogastropoda Ponder & Lindberg, 1995 Antbūris. Neritaemorphi Koken, 1896 BŪRYS. NERITOPSINA Cox & Knight, 1960 Antšeimis. Neritoidea Lamarck, 1809 Šeima. Neritiniai – Neritidae Lamarck, 1809 Pošeimis. Neritinae Lamarck, 1809 Gentis. Theodoxus Montfort, 1810 Pogentė. Theodoxus Montfort, 1810 Upinė rainytė – Theodoxus (Theodoxus) fluviatilis (Linnaeus, 1758) Antbūris. Caenogastropoda Cox, 1960 BŪRYS. ARCHITAENIOGLOSSA Haller, 1890 Antšeimis. Cyclophoroidea Gray, 1847 Šeima. Aciculidae Gray, 1850 Gentis Platyla Moquin-Tandon, 1856 Lygioji spaiglytė – Platyla polita (Hartmann, 1840) Antšeimis. Ampullarioidea Gray, 1824 Šeima. Nendreniniai – Viviparidae Gray, 1847 Pošeimis. Viviparinae Gray, 1847 Gentis. Viviparus Montfort, 1810 Ežerinė nendrenė – Viviparus contectus (Millet, 1813) Upinė nendrenė – Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) BŪRYS. NEOTAENIOGLOSSA Haller, 1892 Antšeimis. Rissooidea Gray, 1847 Šeima. Bitinijiniai – Bithyniidae Troschel, 1857 Gentis. Bithynia Leach, 1818 Pogentis. Bithynia Leach, 1818 Paprastoji bitinija – Bithynia (Bithynia) tentaculata (Linnaeus, 1758) Pogentis. Codiella Locard, 1894 Mažoji bitinija – Bithynia (Codiella) leachii (Sheppard, 1823) Balinė bitinija – Bithynia (Codiella) troschelii (Paasch, 1842) Šeima. Vandeniniai