Manuskript Manuskript Ist Urheberrechtlich Ist Urheberrechtlich Geschützt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Marta Feuchtwanger Papers 0206
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/kt10003750 No online items Finding Aid for Marta Feuchtwanger papers 0206 Finding aid prepared by Michaela Ullmann USC Libraries Special Collections Doheny Memorial Library 206 3550 Trousdale Parkway Los Angeles, California 90089-0189 [email protected] URL: http://libraries.usc.edu/locations/special-collections Finding Aid for Marta 02061223 1 Feuchtwanger papers 0206 Language of Material: English Contributing Institution: USC Libraries Special Collections Title: Marta Feuchtwanger papers creator: Franklin, Carl M. (Carl Mason) creator: Waldo, Hilde creator: Feuchtwanger, Marta Identifier/Call Number: 0206 Identifier/Call Number: 1223 Physical Description: 98.57 Linear Feet173 boxes Date (inclusive): 1940-1987 Abstract: This archive contains the correspondence of Marta Feuchtwanger, wife of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger, who survived her husband by almost thirty years. Marta Feuchtwanger remained an important figure in the exile community and devoted the remainder of her life to promoting the work of her husband. The collection contains Marta Feuchtwanger's personal correspondence, texts and manuscripts by her and others, royalty statements received for the works of her husband, correspondence with publishers, and newspaper clippings mentioning Lion and Marta Feuchtwanger and other exiles. The collection also includes correspondence regarding the establishment and administration of the Feuchtwanger Memorial Library and Villa Aurora. Storage Unit: 91g Storage Unit: 91h Scope and Content This archive contains the correspondence of Marta Feuchtwanger, wife of German-Jewish writer Lion Feuchtwanger, who survived her husband by almost thirty years. Marta Feuchtwanger remained an important figure in the exile community and devoted the remainder of her life after his death to promoting the work of her husband. -

Jews in Nazi Berlin
1938 Chapter One 1938: The Year of Fate hermann simon Kurt Jakob Ball-Kaduri, who in 1944–47 had already started to collect reports from the persecuted German Jews in Palestine and who deposited his own mem- oirs at the Yad Vashem Archive in Jerusalem, wrote the following about the year 1938: “From the start of 1938, one had the feeling that disaster was on the horizon, that we no longer had time for lengthy planning and preparation for emigration.”1 If, before 1938, many Berlin Jews thought they could work around the un- comfortable circumstances, that feeling vanished at the start of 1938. Finally, it became clear to all that they would have to leave the place they called home. Yet in many cases, those affected saw little chance of emigrating. Emigration required entrance visas to another country, and these were by no means easy to obtain. The visas required fi nancial guarantees from relatives or friends living in the countries concerned, and not every Jew in Germany had such connections. Nazi laws, moreover, made it extremely diffi cult to transfer money and other assets abroad. Many Jews simply did not have the necessary amount of property and were unable to raise the travel expenses—even in the rare cases in which one could pay in German currency. Early March 1938 saw the enactment of the Nazi “Law on the Legal Status of Jewish Religious Associations,” which stripped Germany’s Jewish Communities of their status as religious organizations. Berlin’s Community now became an asso- ciation and was registered as such. -

Filmklassiker Bel Ami (1939)
Filmklassiker Bel Ami (1939)...........................................................................................................................2 Der blaue Engel (1930)...............................................................................................................2 Ein blonder Traum (1932)...........................................................................................................3 Bomben auf Monte Carlo (1931).................................................................................................4 Die Brücke (1960) ......................................................................................................................4 Des Teufels General (1955) ........................................................................................................5 Das doppelte Lottchen (1950) .....................................................................................................6 3 Männer im Schnee (1956) ........................................................................................................6 Die Drei von der Tankstelle (1956) .............................................................................................7 Emil und die Detektive (1931) ....................................................................................................8 Die Feuerzangenbowle (1944).....................................................................................................8 Frauenarzt Dr. Prätorius (1950)...................................................................................................9 -

The Genre of Cabaret
University of Central Florida STARS Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 2006 Black Cats, Berlin, Broadway And Beyond: The Genre Of Cabaret Deborah Tedrick University of Central Florida Part of the Theatre and Performance Studies Commons Find similar works at: https://stars.library.ucf.edu/etd University of Central Florida Libraries http://library.ucf.edu This Masters Thesis (Open Access) is brought to you for free and open access by STARS. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019 by an authorized administrator of STARS. For more information, please contact [email protected]. STARS Citation Tedrick, Deborah, "Black Cats, Berlin, Broadway And Beyond: The Genre Of Cabaret" (2006). Electronic Theses and Dissertations, 2004-2019. 972. https://stars.library.ucf.edu/etd/972 BLACK CATS, BERLIN, BROADWAY AND BEYOND: THE GENRE OF CABARET by DEBORAH LYNNE TEDRICK Bachelor of Music, California State University at Los Angeles, 1989 A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts in the Department of Theatre in the College of Arts and Humanities at the University of Central Florida Orlando, Florida Fall Term 2006 © 2006 Deborah Lynne Tedrick ii ABSTRACT Music and Theatre have always captivated me. As a child, my parents would take me to live performances and cinematic shows and I would sit rapt, watching the theatrical events and emotional moments unfold before my eyes. Movie musicals and live shows that combined music and theatre were my favorite, especially theatrical banter and improvisation or sketch comedy. Some of my favorite youthful memories were my annual family summer trips to Las Vegas to visit my grandparents for six weeks. -
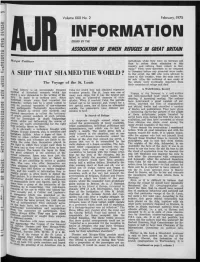
INFORMATION ISSUED by the Assoaaiwm of Mnsh REIVES HI CREAT BRITAIH
Volume XXX No. 2 February, 1975 INFORMATION ISSUED BY THE AssoaAiwM Of mnsH REIVES HI CREAT BRITAIH Margot PottlUser individuals while they were on German soil than to refuse them admission to this country and enforce their return to Ger many." They were therefore to be retumed to Germany before any promises were made. A SHIP THAT SHAMED THE WORLD ? In the event, the 288 who were allowed to come to this country, were the only ones to be safe. After the outbreak of war many of the others were eventually deported from The Voyage of the St. Louis their countries of refuge and died. Oral history is an increasingly frequent Cuba for which they had obtained expensive A Well-Written Record method of historical research which has entrance permits. The St. Louis was one of Voyage of the Damned is a well-written added a new dimension to the writing of his- many such ships, but it was the largest and and well-researched book which makes fas J<?ry. In itself it is nothing new. Since met with an unheard-of measure of vicis cinating, if harassing reading. The authors historical events were first recorded for situdes. When it reached Cuba, the permits have interviewed a great number of sur Posterity, writers had to a great extent to turned out to be spurious and, except for a vivors, searched the files of organisations ^ely on personal memories of eye-witnesses few special cases, one of them an attempted and official bodies and consulted a number and participants. Technically tape-recorders suicide, the passengers were refused per of diaries and publications. -

INFORMATION ISSUED by the Assooaim of Mwm Kbvees U Asat UUTJUH
Volume XXXVII No. 2 February 1982 INFORMATION ISSUED BY THE ASSOOAim OF MWm KBVeES U aSAT UUTJUH Martin Stern Well-fed and amply entertained in the beginning, the heterogeneous community, with its flirtations and conflicts and snobberies, is shown as it deteriorates under the pressure of dwindling food and amenities, the author sketching in their growing anxiety and COPING WITH THE PAST disorientation with one subtle brush-stroke after another. The impact is all the greater for the under statement : it is 1939, and we know what will happen to Two Outstanding Writers them as they still cling to the illusions and the shibboleths of their former ordinary lives. They are almost relieved when the train arrives to take them away—an engine pulling four filthy goods wagons. Dr. Theodor Adorno's statement that ''after Auschwitz pleasant sights and sounds and scents as the Jewish Pappenheim concludes brightly that "if the wagons are no one can ever again write a poem" is often quoted. holiday-makers and their entertainers turn up one so dirty it must mean that we have not far to go." In a One understands what he meant—that a certain kind of after the other. final, powerful image, "they were all sucked in as easily romantic effusion will always seem superfluous and With light, deft touches of the imagination, he paints as grains of wheat poured into a furmel". superficial after what happened there. But Adorno's in one detail after another: the place itself and the A word about the translation. The translator is an statement is false, since it is the duty of all serious art moods of the weather, the impresario Dr. -

Comedic Theatre As a Mechanism of Survival During the Holocaust
Virginia Commonwealth University VCU Scholars Compass Theses and Dissertations Graduate School 2013 Laughing Together: Comedic Theatre as a Mechanism of Survival during the Holocaust Robin Knepp Virginia Commonwealth University Follow this and additional works at: https://scholarscompass.vcu.edu/etd Part of the Theatre and Performance Studies Commons © The Author Downloaded from https://scholarscompass.vcu.edu/etd/3040 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at VCU Scholars Compass. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of VCU Scholars Compass. For more information, please contact [email protected]. © Robin J. Knepp 2013 All Rights Reserved Laughing Together: Comedic Theatre as a Mechanism of Survival during the Holocaust A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Fine Arts in Theatre Pedagogy at Virginia Commonwealth University. by Robin Jedlicka Knepp BA, Berry College, 2006 AD, The American Academy of Dramatic Arts, 2003 Director: Dr. Noreen Barnes Director of Graduate Studies, Department of Theatre Virginia Commonwealth University Richmond, Virginia April, 2013 Acknowledgement I would like to thank Dr. Noreen Barnes for her support and direction throughout this project. I also wish to thank David Schneider for his willingness to contribute candid commentary to my research. My sincere gratitude to the members of Troupp pas D’Argent, and particularly to the co-authors of Holoclownsto, Marcela and Natalíe Rodrigues, for their insight and astounding talents. In addition, I want to thank Dr. John Countryman and Dr. Aaron Anderson for their feedback and support during this process. -

The Joke Is on Hitler: a Study of Humour Under Nazi Rule
The Joke is on Hitler: A Study of Humour under Nazi Rule By Chantelle deMontmorency Supervised by Dr. Kristin Semmens A Graduating Essay Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements in the Honours Programme For the Degree of Bachelor of Arts In the Department of History The University of Victoria 6 April, 2020 Table of Contents List of Figures................................................................................................................................ii Introduction...................................................................................................................................1 Chapter 1: National Socialist Sanctioned Humour..................................................................10 Chapter 2: “Aryan” German Political Humour in the Third Reich......................................27 Chapter 3: Jewish Humour Under Hitler.................................................................................37 Conclusion....................................................................................................................................46 Bibliography.................................................................................................................................48 List of Figures Figure 1: “Brood of Serpents” Caricature of “The Jew” from Der Stürmer, September 1934. 5 Figure 2: Robert Högfeldt’s “In Eintracht (In Harmony)” (1938). 7 Figure 3: Depiction of “The Jew” from Der Kesse Orje (1931). 12 Figure 4: “Then and Now.” Caricature from Die Brennessel (1934). 14 -

Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich
University of Tennessee, Knoxville TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange Doctoral Dissertations Graduate School 5-2018 Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich John William Rall University of Tennessee Follow this and additional works at: https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss Recommended Citation Rall, John William, "Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich. " PhD diss., University of Tennessee, 2018. https://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/4942 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. It has been accepted for inclusion in Doctoral Dissertations by an authorized administrator of TRACE: Tennessee Research and Creative Exchange. For more information, please contact [email protected]. To the Graduate Council: I am submitting herewith a dissertation written by John William Rall entitled "Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich." I have examined the final electronic copy of this dissertation for form and content and recommend that it be accepted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, with a major in History. Monica A. Black, Major Professor We have read this dissertation and recommend its acceptance: Vejas G. Liulevicius, Daniel H. Magilow, Denise Phillips Accepted for the Council: Dixie L. Thompson Vice Provost and Dean of the Graduate School (Original signatures are on file with official studentecor r ds.) Nazi Charity: Giving, Belonging, and Morality in the Third Reich A Dissertation Presented for the Doctor of Philosophy Degree The University of Tennessee, Knoxville John William Rall May 2018 ii Copyright © 2018 by John William Rall. -
Themenfeld: Kabarett-Kultur/ Karikatur
Stand: 29.03.2012 Prof. Dr. Dietmar Klenke Satirische Quellen und theatralische Präsentationsformen im Geschichtsunterricht Literaturempfehlungen (laufende Ergänzung und Aktualisierung) 1. Allgemeines und Spezialliteratur Batz, Michael/Schroth, Horst, Theater zwischen Tür und Angel: Handbuch für freies Theater, Reinbek 1983. Behrendt, Fritz, Teilweise Heiter. Zeichnungen und Karikaturen, Wien 1995. Bemmann, Helga, Otto Reutter. Biographie, Berlin 1996. Bemmann, Helga, Joachim Ringelnatz. Leben und Werk des Dichters, Malers und Artisten, Berlin u. a. 1996. [11 CQWR2742] Bemmann, Helga, Kurt Tucholsky. Ein Lebensbild, Berlin 1992. [11 CQWT2580] Bemmann, Helga, Berliner Musenkinder-Memoiren. Eine heitere Chronik von 1900 — 1930, Berlin 1987. [11 KMU1179(2)] Bemmann, Helga, Humor auf Taille. Erich Kästner. Leben u. Werk, Berlin 1983. [11 CQWK2593] Bemmann, Helga (Hg.), Leute, höret die Geschichte. Bänkeldichtung aus 2 Jahrhunderten, Berlin 1980. [11 CJWB1135(2)] Bentley, Eric / Robinson, Earl (Hg.), Songs of Bertolt Brecht and Hanns Eisler, New York 1967. Berlin Cabaret, Bei uns um die Gedächtniskirche rum... Friedrich Hollaender und das Kabarett der zwanziger Jahre, Berlin: Stiftung Archiv der Akademie der Künste, CD, "edel" Gesellschaft für Produktmarketing mbH 1996. Best, Otto, Volk ohne Witz. Über ein deutsches Defizit, Frankfurt a. M. 1993 Buchele. Marga, Der politische Witz als getarnte Meinungsäußerung gegen den totalitären Staat, München 1955. Budzinski, Klaus (Hg.), Linke Lieder: Protest Songs, München 1966. [11 CJWL 3234] Budzinski, Klaus, Pfeffer ins Getriebe. Ein Streifzug durch hundert Jahre Kabarett, München 1984. [11 KMU 1080] 1 Budzinski, Klaus, Das Kabarett. 100 Jahre literarische Zeitkritik - gesprochen - gesungen - gespielt. Von der Jahrhundertwende bis heute, Düsseldorf 1985. [10 KMU 1111] Budzinski, Klaus, Wer lacht denn da? Kabarett von 1945 bis heute, Braunschweig 1989. -

The Ha-Ha Holocaust: Exploring Levity Amidst the Ruins and Beyond in Testimony, Literature and Film
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 9-22-2014 12:00 AM The Ha-Ha Holocaust: Exploring Levity Amidst the Ruins and Beyond in Testimony, Literature and Film Aviva Atlani The University of Western Ontario Supervisor Alain Goldschlager, Ph.D The University of Western Ontario Graduate Program in Comparative Literature A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Philosophy © Aviva Atlani 2014 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Comparative Literature Commons, European History Commons, Film and Media Studies Commons, French and Francophone Literature Commons, Jewish Studies Commons, Modern Literature Commons, Race and Ethnicity Commons, and the Social Psychology Commons Recommended Citation Atlani, Aviva, "The Ha-Ha Holocaust: Exploring Levity Amidst the Ruins and Beyond in Testimony, Literature and Film" (2014). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 2509. https://ir.lib.uwo.ca/etd/2509 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. THE HA-HA HOLOCAUST: EXPLORING LEVITY AMIDST THE RUINS AND BEYOND IN TESTIMONY, LITERATURE AND FILM (Thesis format: Monograph) by Aviva Atlani Graduate Program in Comparative Literature A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario London, Ontario, Canada © Aviva Atlani 2014 ABSTRACT Jewish humour sheds a crude light on the social, political, and historical realities of the Holocaust. -

Shattuc, Jane. Television, Tabloids, and Tears (1995).Pdf
Television, Tabloids, and Tears This page intentionally left blank Television, Tabloids, and Tears Fassbinder and Popular Culture Jane Shattuc University of Minnesota Press Minneapolis London Copyright 1995 by the Regents of the University of Minnesota Chapter 3 first appeared as "R. W. Fassbinder as Popular Auteur: The Making of an Authorial Legend," Journal of Film and Video 45 (Spring 1993), reprinted by permission; chapter 4 first appeared as "Contra Brecht: R. W. Fassbinder and Pop Culture in the Sixties," Cinema Journal (Fall 1993), reprinted by permission. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Published by the University of Minnesota Press 111 Third Avenue South, Suite 290, Minneapolis, MN 55401-2520 Printed in the United States of America on acid-free paper Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Shattuc, Jane. Television, tabloids, and tears : Fassbinder and popular culture / Jane Shattuc. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8166-2454-2 (alk. paper). — ISBN 0-8166-2455-0 (pbk. : alk. paper) 1. Fassbinder, Rainer Werner, 1946- —Criticism and interpretation. 2. Berlin Alexanderplatz (Television program) I. Title. PN1998.3.F37S52 1994 791.43'0233'092 —dc20 94-30357 The University of Minnesota is an equal-opportunity educator and employer. Contents Acknowledgments vii 1 / The