Jurnal Ilmiah Bahasa, Sastra, Dan Budaya Jerman
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse
Betz, Hans-Georg. "Mosques, Minarets, Burqas and Other Essential Threats: The Populist Right’s Campaign against Islam in Western Europe." Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse. Ed. Ruth Wodak, Majid KhosraviNik and Brigitte Mral. London: Bloomsbury Academic, 2013. 71–88. Bloomsbury Collections. Web. 24 Sep. 2021. <http:// dx.doi.org/10.5040/9781472544940.ch-005>. Downloaded from Bloomsbury Collections, www.bloomsburycollections.com, 24 September 2021, 18:01 UTC. Copyright © Ruth Wodak, Majid KhosraviNik and Brigitte Mral and the contributors 2013. You may share this work for non-commercial purposes only, provided you give attribution to the copyright holder and the publisher, and provide a link to the Creative Commons licence. 5 Mosques, Minarets, Burqas and Other Essential Threats: The Populist Right’s Campaign against Islam in Western Europe Hans-Georg Betz Barcelona 2011: Three girls in miniskirts are jumping over a rope somewhere in a car park in the city. Barcelona 2025: The same three girls, same location, only the miniskirts have been replaced by burqas. This was the content of a video spot produced by Platforma per Catalunya (PxC) for the Catalan local elections in 2011.1 Responsible for the video was Josep Anglada, the leader of PxC. Founded in 2002 by Anglada, PxC is modelled on successful Western European right-wing populist parties, without however initially attracting much more than marginal support at the polls. This might have had something to do with the fact that, in the past, Anglada had been closely associated with Spain’s post-Francoist far right (such as Blas Piñar’s Fuerza Nueva and its successors) which, given the Franco regime’s history of iron-fisted repression of Catalan identity, was hardly an asset in Catalonia. -

European Race Audit
EUROPEAN RACE AUDIT BRIEFING PAPER NO.1 - FEBRUARY 2010 The Swiss referendum on minarets: background and aftermath ‘As bell towers are part of churches, minarets are part of mosques. All of these are humanity’s common heritage.’ COJEP International The Swiss referendum on minarets: background ed. The initiative’s support came from supporters of and aftermath right-wing parties, residents of rural areas, towns in the On 29 November 2009, Switzerland became the first German-speaking party of the country, as well as less country in Europe to vote to curb the religious practices qualified people. According to gfs.berne director Claude of Muslims when a referendum, banning the construc- Longchamp, this was ‘a pattern known from other cam- tion of minarets on mosques, was backed by a strong paigns which target the fears and concerns of the popu- majority. As a result, Article 72 of the Swiss Federal lation’. But it surprised him later to find that such a famil- Constitution regulating relations between the state and iar pattern changed. He noted that a divisive initiative religion was amended to include the statement: ‘the had gained ground among citizens without a clear party construction of minarets will be forbidden’. The result, affiliation, with the electorate succumbing to the argu- which shocked the political establishment, which had ment that minarets were a symbol of Islam’s alleged confidently predicted its defeat, has resulted in much power. soul-searching about the Swiss system of direct democ- Another factor that may have increased support for racy, with the federal government placed under increas- the yes vote in the final throes of the campaign may ing pressure to annul people’s initiatives that obviously have been the late intervention of the prominent radical contradict fundamental principles of international law feminist, psychologist and author of best-selling self- or the Swiss Constitution. -

Switzerland Has Narrowly Voted in Favor of Banning Face Coverings in Public, Including the Burka Or Niqab Worn by Muslim Women
Table of Contents • Referendum: Voters support ban on face coverings in public • Swiss Muslims denounce ‘burqa ban’ proposal as referendum nears Referendum: Voters support ban on face coverings in public HRWF Comment: Fundamental human rights should never be subjected to referenda. Maybe next time they will vote to ban various other freedom. BBC (07.03.2021) - https://bbc.in/2Og35PG - Switzerland has narrowly voted in favor of banning face coverings in public, including the burka or niqab worn by Muslim women. Official results showed the measure had passed by 51.2% to 48.8% in Sunday's referendum. The proposal was put forward by the right-wing Swiss People's Party (SVP) which campaigned with slogans such as "Stop extremism". A leading Swiss Islamic group said it was "a dark day" for Muslims. "Today's decision opens old wounds, further expands the principle of legal inequality, and sends a clear signal of exclusion to the Muslim minority," the Central Council of Muslims said in a statement, adding that it would challenge the decision in court. The Swiss government had argued against the ban saying it was not up to the state to dictate what women wear. According to research by the University of Lucerne, almost no-one in Switzerland wears a burka and only around 30 women wear the niqab. About 5% of Switzerland's population of 8.6 million people are Muslim, most originating from Turkey, Bosnia and Kosovo. Swiss people are given a direct say in their own affairs under the country's system of direct democracy. They are regularly invited to vote on various issues in national or regional referendums. -

Transnational and Cosmopolitan Forms of Islam in the West Karen Leonard
Harvard Middle Eastern and Islamic Review 8 (2009), 176–199 Transnational and Cosmopolitan Forms of Islam in the West Karen Leonard Transnational forms of religions—in this case, Islam—are not new. As Richard Eaton and many others have written, Islam and Muslims have long constituted a “world system.”1 Muslims were, in interactions and aspirations, moving across linguistic and political borders long before there were modern nation-states.2 Even though current deªnitions of transnationalism rest on the existence of nation-states, modern nations actually work against transnationalism by producing tensions that chal- lenge and weaken efforts to establish and maintain transnational con- nections. In this article, I argue that transnational forms of Islam are inevita- bly engaged in losing struggles, particularly in North America and Eu- rope.3 Although only a few years ago, such writings were rare, some scholars of Islam in Europe are beginning to write about European Is- lam or Euro-Islam, about Swedish or Norwegian Islam, and about Euro- Muslims, Swedish Muslims, and so on.4 In North America, Muslims and scholars who previously resisted the phrase American Islam are now accepting it and imbuing it with meanings beyond a simple politi- cal claim on the United States or Canada. American forms of Islam can be discerned as the forms of Islam in the West become strongly cosmo- politan rather than transnational. In examining transnational and cosmopolitan Islamic movements in the West, much depends on the deªnitions employed. I am using spe- ciªc deªnitions of transnationalism and cosmopolitanism rather than the broad deªnitions that were presented in works published in the 1990s on primarily economic migrants (people moving from their homelands to other societies and linking two or more societies).5 Steven Vertovec employs a similarly broad deªnition in an essay on diaspora, transnationalism. -

PERSPECTIVES on TERRORISM Volume 9, Issue 5
ISSN 2334-3745 Volume IX, Issue 5 October 2015 PERSPECTIVES ON TERRORISM Volume 9, Issue 5 Table of Contents Welcome from the Editor 1 I. Articles Radicalisation to Terrorism in Kenya and Uganda: a Political Socialisation Perspective 2 by Anneli Botha Countering the (Re-) Production of Militancy in Indonesia: between Coercion and Persuasion 15 by Paul J. Carnegie Globalisation and Terrorism in the Middle East 27 by Brenda J. Lutz and James M. Lutz II. Research Notes Lost Souls Searching for Answers? Belgian and Dutch Converts Joining the Islamic State 47 by Marion van San Designing and Applying an ‘Extremist Media Index’ 57 by Donald Holbrook III. Policy Brief The Afghan Insurgency and the Uncertainty of Peace Negotiations 69 by Kambaiz Rafi IV. Resources Bibliography: Muslims and the West 73 Compiled and selected by Judith Tinnes V. Book Reviews Anne Speckhard. Bride of ISIS: One Young Woman’s Path into Homegrown Terrorism. 109 Reviewed by Anita Perešin Counterterrorism Bookshelf: 16 Books on Terrorism & Counter-Terrorism-Related Subjects 111 Reviewed by Joshua Sinai ISSN 2334-3745 i October 2015 PERSPECTIVES ON TERRORISM Volume 9, Issue 5 V. Notes from the Editor Announcement: Dr. Anneli Botha: Winner of the Best Ph.D. Thesis 2014 Award 118 About Perspectives on Terrorism 120 ISSN 2334-3745 ii October 2015 PERSPECTIVES ON TERRORISM Volume 9, Issue 5 Welcome from the Editor Dear Reader, We are pleased to announce the publication of the October 2015 issue (PT IX 5) of Perspectives on Terrorism at: < www.terrorismanalysts.com >. Now approaching its 10th year of publication, our journal has 5,600 e-mail subscribers and many more website visitors (287,483 in 2014), making it probably the most widely read journal in the field of terrorism- and counter-terrorism studies. -

Master Reference
Master Public Discourse on Muslims and Foreigners FEDDERSEN, Alexandra Abstract This thesis analyzes the public discourse on foreigners and Muslims in Switzerland between 2000 and 2009. In Switzerland, as elsewhere in Europe, the debate on immigration, cultural identity and citizenship seems to focus more and more on the Muslim minority. While the Muslim population belonged to the generic group of foreigners in the public debate until recently, it seems that Muslims have become the main problem for integration in Switzerland. In the past decade, two direct democratic campaigns targeted Muslims, raising the question about the compatibility of Swiss and Muslim cultures. What makes Muslims a special group? How does the public discourse on Muslims differ from the portrayal of foreigners in general? Are Muslims perceived as the main threat to Swiss culture and gender equality? To answer these questions empirically, a quantitative content analysis of four major Swiss newspapers was conducted covering three direct democratic campaigns in the last decade. The aim of the analysis was to inductively grasp the discourse of institutional actors on Muslims and on foreigners in general and to discover the main [...] Reference FEDDERSEN, Alexandra. Public Discourse on Muslims and Foreigners. Master : Univ. Genève, 2013 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:35314 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 Green Lab N° 3 • 2013 Public Discourse on Muslims and Foreigners Alexandra Feddersen Geneva Laboratory of Political Science Afin de mieux se présenter, le Département de science politique de l'Université de Genève a lancé en 2009 deux nouvelles publications. -

From Object to Subject – Imams in Switzerland
Noemi Trucco [email protected] From Object to Subject – Imams in Switzerland Project Outline This PhD thesis in sociology is embedded in an interdisciplinary project called «From Object to Sub- ject: Social Science and Theological-Social Ethical Perspectives on Issues concerning Islam and Con- flict». It aims to shed light on Islam-related conflicts in political and media-based public debates, fo- cusing on debates on and with imams in Switzerland and their self-perception. In the same project, two PhD candidates concentrate on theological interpretations of conflicts by examining contemporary authors in Christian and Muslim traditions. Findings of the three PhD projects will be triangulated and brought together in a fourth project. Thus, three PhD candidates and several professors (in Interreli- gious Ethics, Sociology, Islamic Theology and Communication Science with a focus on Political Com- munication) take part in the project. Starting point for this PhD thesis is therefore an existing project description that was outlined for the purpose of funding the overall project. From a sociological point of view, however, it poses some difficulties that need to be addressed. As a result, the project is still missing clear research questions and a conclusive theoretical framework. Research Idea The project description envisages a three-stage research for this PhD. It intends to approach the ques- tion of the perception of imams in public debates in Switzerland and their self-perception on three levels: First by analyzing the political and, to some extent, the related media-based public discourse on imams. Hereby imams will probably first and foremost appear as objects in the discourse, i.e. -

Westernization and Muslims in Western Europe Sean Manahan Coastal Carolina University
Coastal Carolina University CCU Digital Commons Honors College and Center for Interdisciplinary Honors Theses Studies Fall 12-15-2011 Westernization and Muslims in Western Europe Sean Manahan Coastal Carolina University Follow this and additional works at: https://digitalcommons.coastal.edu/honors-theses Part of the Political Science Commons Recommended Citation Manahan, Sean, "Westernization and Muslims in Western Europe" (2011). Honors Theses. 106. https://digitalcommons.coastal.edu/honors-theses/106 This Thesis is brought to you for free and open access by the Honors College and Center for Interdisciplinary Studies at CCU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Honors Theses by an authorized administrator of CCU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. Introduction The presence of radical Islam in Western Europe is substantial and poses a major threat to those states as well as to the United States. But why has Western Europe been such a fruitful environment for the recruitment and conversion of many young men to radical interpretations of Islam and openness to terrorist actions toward the West? In the 1970’s Europe began to be used as a safe haven for radicals fleeing their homelands from places such as Egypt and Syria. However, their intent was to keep a low profile while raising money for efforts in their homeland. In the 1990’s Europe began to see an influx of radicals with a more global initiative. Specifc individuals include Abu Mus’ab al-Suri of Syria and Abu Qatada of Syria, both of whom were directly connected with Osama bin Laden as well as al-Qaeda. -

Download This PDF File
Social Inclusion Open Access Journal | ISSN: 2183-2803 Volume 4, Issue 2 (2016) Thematic Issue Religious Diversity and Social Inclusion Editor Gary Bouma Social Inclusion, 2016, Volume 4, Issue 2 Thematic Issue: Religious Diversity and Social Inclusion Published by Cogitatio Press Rua Fialho de Almeida 14, 2º Esq., 1070-129 Lisbon Portugal Academic Editor Gary Bouma, Monash University, Australia Managing Editor Amandine Gatelier, Cogitatio Press, Portugal Available online at: www.cogitatiopress.com/socialinclusion This issue is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). Articles may be reproduced provided that credit is given to the original and Social Inclusion is acknowledged as the original venue of publication. Table of Contents Editorial Religious Diversity and the Challenge of Social Inclusion Gary Bouma 1-2 Article Living Together v. Living Well Together: A Normative Examination of the SAS Case Lori G. Beaman 3-13 Article Inclusive Study of Religions and World Views in Schools: Signposts from the Council of Europe Robert Jackson 14-25 Article The Fog of Extremism: Governance, Identity, and Minstrels of Exclusion Amyn B. Sajoo 26-39 Article “Too Smart to be Religious?” Discreet Seeking Amidst Religious Stigma at an Elite College Kateri Boucher and Jaime Kucinskas 40-51 Article Secular New Zealand and Religious Diversity: From Cultural Evolution to Societal Affirmation Douglas Pratt 52-64 Article Secularities, Diversities and Pluralities: Understanding the Challenges of Religious Diversity in -
LIECHTENSTEIN Thomas Schmidinger1 1 Muslim
LIECHTENSTEIN Thomas Schmidinger1 1 Muslim Populations Islam in the Principality of Liechtenstein is a very recent phenomenon. Muslims immigrated in the last 20 years predominately from Turkey, Bosnia, Serbia and Kosovo. While in 1990 only 2.4% of the popu- lation were Muslims, in 2000 it doubled to 4.8% or 1,593 persons.2 The results of the next census in December 2010 will not be available until 2011 but it is estimated that the Muslim population continued to grow. The large majority of Muslims in Liechtenstein are Sunnis. There is no reference to Shi’i Muslims in Liechtenstein. There are some Alevis, but their numbers are uncertain. 2 Islam and the State The present legal situation concerning the relation of state and religion in Liechtenstein is still based on the laws set up by Prince Johann II in the 19th century, when Liechtenstein was nearly entirely Roman Catholic. Until now the Principality and the Catholic Church are closely related. Article 37 of the constitution still defines the Roman Catholic Church as the official religion Landeskirche(“ ”) of the Prin- cipality, but also guarantees freedom of religion to other religious denominations. Since the 1990s, debates about the separation between church and state have been going on, and the Principality is trying to establish a new secular legal order with a new relationship between the state and the religious communities. While the Catholic and the Protestant churches are financially supported by the state, Islam is not regularly financed. The government has announced that it would be willing to support an Islamic religious community if the two Muslim 1 Thomas Schmidinger is a lecturer at the Institute of Political Science at the Uni- versity of Vienna and a Research Fellow at the University of Minnesota (US). -

Muslim and Buddhist Youths in Switzerland: Individualising Religion and Striving for Recognition?
Social Inclusion (ISSN: 2183–2803) 2020, Volume 8, Issue 3, Pages 273–285 DOI: 10.17645/si.v8i3.3071 Article Muslim and Buddhist Youths in Switzerland: Individualising Religion and Striving for Recognition? Martin Baumann * and Rebekka Christine Khaliefi Department for the Study of Religions, University of Lucerne, 6002 Lucerne, Switzerland; E-Mails: [email protected] (M. B.), [email protected] (R. C. K.) * Corresponding author Submitted: 29 March 2020 | Accepted: 30 April 2020 | Published: 20 August 2020 Abstract Since the second half of the 20th century, immigrants and refugees from numerous countries have arrived in Switzerland. With their long-term settlement, the immigrant minorities have established cultural and religious associations to maintain their cultural and religious traditions and to teach their children the faith and religious practices from the country of origin. In contrast to the first immigrant generation, the second generation has had concurrent social influences from the Swiss ordinary school system and the cultural-religious traditions of their parents. This article asks to what extent the young generations have continued the religious traditions brought by their parents and what changes have occurred in adapt- ing religious practices, ideas and collective forms to the new socio-cultural environment. In addition, we study whether and how the second generations have striven to move away from the often-marginalised social position of their parents and engage with social recognition in Swiss society. To provide answers to these pertinent questions, the article will draw on the examples of first and second-generation Muslims and Buddhists in Switzerland and refer to the theoretical model designed by the American scholars Fred Kniss and Paul Numrich. -
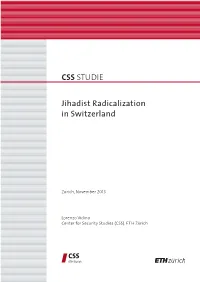
Jihadist Radicalization in Switzerland
CSS Studie Jihadist Radicalization in Switzerland Zurich, November 2013 Lorenzo Vidino Center for Security Studies (CSS), etH Zürich CSS Studie Jihadist Radicalization in Switzerland Lorenzo Vidino © 2013 Lorenzo Vidino and the Center for Security Studies (CSS), etH Zurich Center for Security Studies (CSS) etH Zurich Haldeneggsteig 4, iFW CH – 8092 Zürich Switzerland tel.: +41-44-632 40 25 Fax: +41-44-632 19 41 [email protected] www.css.ethz.ch Author: Lorenzo Vidino Language editing: Sascha Langenbach Layout and front cover: Miriam dahinden Availability: this report can be accessed online at www.css.ethz.ch disclaimer: Any opinions expressed in this article present the views of the author alone and not necessarily those of the Center for Security Studies (CSS). CSS Studie Jihadist Radicalization in Switzerland Table of contents Executive summary 4 1 Introduction 5 1.1 Scope of the study 6 1.2 Terminology 6 1.3 Methodology 8 2 Historical evolution of Islamism and jihadism in Switzerland 9 2.1 The pioneers: the Brothers find refuge in Switzerland 10 2.2 First jihadist presences 12 2.3 The current phase 16 2.4 Swiss traveling for jihad 17 3 Radicalization and linkage 20 3.1 Potential radicalizing agents 21 3.2 The internet 22 3.3 The role of mosques 25 3.4 Gateway organizations 26 3.5 The controversial role of the iZRS 27 3.6 Links abroad 30 3.7 Hypotheses on linkage dynamics 34 4 Assessing the phenomenon 36 4.1 Explaining Switzerland’s low levels of radicalization 37 4.2 Potential counter-trends 38 4.3 Conclusion 42 CSS Studie Jihadist Radicalization in Switzerland Executive summary europe and train or fight with them.