Ein Thurgauer Als Baumeister Des Bundesstaates Von 1848
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bern Aktuell
AZB / P.P. 3001 Bern AZB / P.P. B Jetzt Abo 2017 einzahlen. ERNRechnung in Heftmitte B AKTUELLBERN AKTIV Jahrgang 28 Ausgabe 209 Die Schweizerische Vereinigung Januar/Februar 2017 schreibt, was andere über Bern und die Schweiz nicht berichten (dürfen). nachbart wohnende Kunstmaler Adolf Dietrich Würdigung grosser Persönlichkeiten mehrfach gemalt. Nach der Lateinschule in Diessenhofen durfte der aufgeweckte Konrad Kern das Gymnasi- Johann Konrad Kern Redaktor unserer Bundesverfassung den ganz grossen Staatsmännern des frühen Bundesstaates, deren kluger Ein- und Weitsicht wir unseren heutigen Wohlstand, unsere Lebens- qualität und unsere Unabhängigkeit verdanken. Von Ausflug der Zofingia Christoph Blocher, alt Bundesrat 8704 Herrliberg (ZH) um in Zürich besuchen. In der Verbindung der Thurgauer – der «Thurgovia» – gab er schon bald als Präsident den Ton an. 1825 wurde er Die treibende Kraft für die Bundesverfassung in die «Zofingia» aufgenommen, wo er sich für Berlingen am Untersee waren die Liberalen. Es waren echte Liberale, Freiheit und Vaterland begeisterte und manche freiheitlich denkende Liberale. Dies hat nichts zu tun mit dem heutigen abgedroschenen Begriff Jurist und Kantonspolitiker «liberal». Heute sind ja alle liberal – auch wenn Im schönen Berlingen, auf einer Landzunge im sie die Freiheits- und Volksrechte verachten oder Untersee gelegen, das man heute von prächtigen die Unabhängigkeit und die Neutralität preisge- Bildern des anderen bekannten Berlingers – ben. Nein, die damalige liberale Grossfamilie, Adolf Dietrich – besser kennt, hat Johann Kon- aus der die heutige SVP und FDP hervorgegan- rad Kern 1808 als zweites von sieben Kindern gen sind, bestand aus echten Liberalen. Sie tra- das Licht der Welt erblickt. Seine Vorfahren ten ein für die Volks- und Freiheitsrechte, für die waren Bauern und dienten der kleinen Gemeinde Unabhängigkeit und die Neutralität des Landes, in verschiedenen Ämtern. -

Alfred Escher - Wikipedia
4/12/2021 Alfred Escher - Wikipedia [ Alfred Escher. (Accessed Apr. 12, 2021). Biography. Wikipedia. Source: Alfred Escher https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Escher ] Johann Heinrich Alfred Escher vom Glas, known as Alfred Escher (20 February 1819 – 6 December 1882) was a Swiss politician, business leader and railways pioneer. Thanks to his numerous political posts and his significant role in the foundation and management of the Swiss Northeastern Railway, the Swiss Federal Institute of Technology, Credit Suisse, Swiss Life and the Gotthard Railway, Escher had an unmatched influence on Switzerland's political and economic development in the 19th century. Contents Life Origins and family Childhood, youth, student years Political rise Opposition and criticism Illness, death and memorial Portrait of Alfred Escher, c. 1875 Co-founder of modern Switzerland First railway projects Federal Polytechnic Institute Credit Suisse Gotthard railway Public offices and positions Legacy and research Escher's correspondence References Bibliography External links Life Origins and family Alfred Escher was born in Zürich, into the Escher vom Glas family, an old and influential dynasty that had produced many prominent politicians. A scandal surrounding Alfred Escher's immediate forebears had, however, damaged his family line's reputation. His great- grandfather Hans Caspar Escher-Werdmüller (1731–1781) had fathered a child out of wedlock with a maidservant in 1765 and emigrated. His grandfather Hans Caspar Escher-Keller (1755– 1831) almost brought the whole of Zürich to financial ruin when he went bankrupt.[1] Finally Alfred Escher's father Heinrich Escher (1776–1853) made a new fortune through speculative land deals and trading in partnership with Baron Jean-Conrad Hottinguer from their North American offices. -
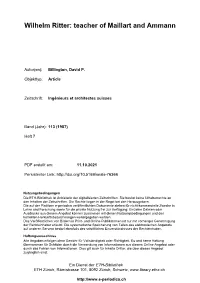
Wilhelm Ritter: Teacher of Maillart and Ammann
Wilhelm Ritter: teacher of Maillart and Ammann Autor(en): Billington, David P. Objekttyp: Article Zeitschrift: Ingénieurs et architectes suisses Band (Jahr): 113 (1987) Heft 7 PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-76366 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch CHRISTIAN MENN Ingénieurs el architectes suisses n" 7 26 mars 1987 Tableau 1. — Amplitudes maximales des variations de températures uniformes les ponts selon différentes sources. pour Bibliographie à Taa [°C] [1] J accoud, J.-P. Gradients de tempéra¬ dans les et Ponts en bétons Ponts mixtes Ponts en acier ture ponts. -
Swiss Specialties. Switzerland's Role in the Genesis of the Telegraph
207 Swiss Specialties. Switzerland’s Role in the Genesis of the Telegraph Union, 1855-1875 Gabriele BALBI, Simone FARI, Giuseppe RICHERI, Spartaco CALVO Electric telegraphy was first tried in the 1830s and national networks were installed in the 1840s, a decade in which almost all European states introduced a telegraph service, mostly in the form of a public monopoly.1 Already in the late 1840s and early 1850s the telegraph proved to be relevant for national and international communica- tion because it could intensify political, economic and social relations with other nations. Communicating at an international level, however, also involved creating a series of political, economic and technical regulations, principles and models essen- tial for standardizing technologies, introducing homogeneous norms and establishing tariff agreements.2 For this reason, after a series of bilateral and multilateral treatises, the Telegraph Union, nowadays better known as the International Telecommunica- tion Union (ITU), was founded in 1865. It was the first supranational organization to unite different countries, with the aim of regulating a public service.3 Originally all the countries in which the telegraph service was managed under a state monopoly took part,4 thus excluding nations of primary importance such as Great Britain and the United States.5 The main aim of the Union was to guarantee international tele- graph communications, something which could be done only through technical stan- dardization, regulatory uniformity and mutual agreement on international tariffs. It was therefore essential for the States, through periodic conferences, to decide which machinery and which telegraphic materials to use on the international lines, which standards to adopt to manage the internal and supranational telegraph service and, finally, what tax to apply to each single telegram sent from one state to another. -

Stefanie Ursula Eminger Phd Thesis
CARL FRIEDRICH GEISER AND FERDINAND RUDIO: THE MEN BEHIND THE FIRST INTERNATIONAL CONGRESS OF MATHEMATICIANS Stefanie Ursula Eminger A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of St Andrews 2015 Full metadata for this item is available in Research@StAndrews:FullText at: http://research-repository.st-andrews.ac.uk/ Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10023/6536 This item is protected by original copyright Carl Friedrich Geiser and Ferdinand Rudio: The Men Behind the First International Congress of Mathematicians Stefanie Ursula Eminger This thesis is submitted in partial fulfilment for the degree of PhD at the University of St Andrews 2014 Table of Contents Abstract 7 Acknowledgements 9 1. Introduction 11 2. Carl Friedrich Geiser (1843 – 1934) 15 2.1 Life 15 2.2 Connection with Steiner 33 2.3 Impact at the Polytechnic and on Education 39 3. Ferdinand Karl Rudio (1856 – 1929) 49 3.1 Life 49 3.2 Contribution to Euler’s Opera Omnia 53 4. The First International Congress of Mathematicians, Zurich 1897 57 4.1 Background and Organisation 57 4.1.1 Historical Developments 57 4.1.2 Organising the Congress 62 4.1.3 The Congress Itself 67 4.1.4 Geiser’s Contribution 76 4.1.5 Rudio’s Contribution 77 4.2 The Swiss Organising Committee 79 4.2.1 Ernst Julius Amberg (1871 – 1952) 79 4.2.2 Christian Beyel (1854 – 1941) 82 4.2.3 Hermann Bleuler (1837 – 1912) 83 4.2.4 Heinrich Burkhardt (1861 – 1914) 86 4.2.5 Fritz Bützberger (1862 – 1922) 89 4.2.5.1 Bützberger’s Work on Steiner 92 4.2.6 Gustave Dumas -

Alfred Huggenberger (1867–1960)
Schriftliche Fassung der Rede an der Herbstveranstaltung vom 19. September 2015 in Weinfelden SPERRFRIST: 19.09.2015, 17 Uhr Würdigung dreier Persönlichkeiten aus dem Thurgau und ihre Bedeutung für die heutige Schweiz Johann Konrad Kern (1808–1888) Alfred Huggenberger (1867–1960) Adolf Dietrich (1877–1957) Vortrag, gehalten anlässlich der Herbstveranstaltung am 19. September 2015 in Weinfelden von Christoph Blocher, a. Nationalrat und a. Bundesrat Es gilt das schriftliche und das mündliche Wort. Der Redner behält sich vor, auch stark vom Manuskript abzuweichen. www.blocher.ch - www.svp.ch - www.svp-weinfelden.ch 1 / 44 Schriftliche Fassung der Rede an der Herbstveranstaltung vom 19. September 2015 in Weinfelden Inhaltsverzeichnis I. Einleitung 3 II. Johann Konrad Kern – Redaktor unserer Bundes- verfassung 8 1. Jurist und Kantonspolitiker 9 2. Napoleon-Handel und Sonderbund 13 3. Baumeister der Bundesverfassung 16 4. Neuenburger Handel, Gesandter in Paris 18 III. Alfred Huggenberger – Dichter unserer Heimat 20 1. Von Bewangen nach Gerlikon 21 2. Poet der „kleinen Leute“ 22 3. Reisender Vorleser 25 4. Politisches 26 5. Wo Schatten ist … 27 6. … ist auch Sonnenglanz 29 IV. Adolf Dietrich – Maler unserer Heimat 31 1. Vater und Sohn 32 2. Förderer Herbert Tannenbaum 34 3. Der Porträtist 35 4. Der Tiermaler 36 5. Der Landschafter 39 6. Winterbilder 42 2 / 44 Schriftliche Fassung der Rede an der Herbstveranstaltung vom 19. September 2015 in Weinfelden Sehr geehrte Frau Nationalrätin Herren National- und Ständeräte Liebe Weinfelderinnen und Weinfelder Liebe Thurgauerinnen und Thurgauer Getreue, liebe Mitlandleute aus der übrigen Schweiz Liebe Frauen und Männer! I. Einleitung Bild 1: Weinfelder Herbstanlass, 19.9.2015 Heute – am Vorabend des eidgenössischen Dank-, Buss- und Bettages – sind wir mitten im Thurgau zusammen gekommen, um drei Thurgauer Persönlichkeiten und ihre Bedeutung für die Schweizerische Eidgenossenschaft zu würdigen. -

Eine Ehrengabe an Johann Konrad Kern, Paris 1857 : Der Glasmaler Johann Caspar Gsell Als Entwerfer Von Silberarbeiten
Eine Ehrengabe an Johann Konrad Kern, Paris 1857 : der Glasmaler Johann Caspar Gsell als Entwerfer von Silberarbeiten Autor(en): Rapp, Anna Objekttyp: Article Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte = Revue suisse d'art et d'archéologie = Rivista svizzera d'arte e d'archeologia = Journal of Swiss archeology and art history Band (Jahr): 38 (1981) Heft 4 PDF erstellt am: 11.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-167661 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Eine Ehrengabe an Johann Konrad Kern, Paris 1857 Der Glasmaler Johann Caspar Gsell als Entwerfer von Silberarbeiten von Anna Rapp Im Sommer 1980 wurde dem Schweizerischen er Wesentliches zum Aufbau des schweizerischen Rechtsstaates Landesmuseum ein silberner Pokal mit Präsentierteller aus dem und zur Entwicklung von dessen Außenpolitik bei.