Cerura Vinula)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Contribution to the Knowledge of the Fauna of Bombyces, Sphinges And
driemaandelijks tijdschrift van de VLAAMSE VERENIGING VOOR ENTOMOLOGIE Afgiftekantoor 2170 Merksem 1 ISSN 0771-5277 Periode: oktober – november – december 2002 Erkenningsnr. P209674 Redactie: Dr. J–P. Borie (Compiègne, France), Dr. L. De Bruyn (Antwerpen), T. C. Garrevoet (Antwerpen), B. Goater (Chandlers Ford, England), Dr. K. Maes (Gent), Dr. K. Martens (Brussel), H. van Oorschot (Amsterdam), D. van der Poorten (Antwerpen), W. O. De Prins (Antwerpen). Redactie-adres: W. O. De Prins, Nieuwe Donk 50, B-2100 Antwerpen (Belgium). e-mail: [email protected]. Jaargang 30, nummer 4 1 december 2002 Contribution to the knowledge of the fauna of Bombyces, Sphinges and Noctuidae of the Southern Ural Mountains, with description of a new Dichagyris (Lepidoptera: Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae, Arctiidae) Kari Nupponen & Michael Fibiger [In co-operation with Vladimir Olschwang, Timo Nupponen, Jari Junnilainen, Matti Ahola and Jari- Pekka Kaitila] Abstract. The list, comprising 624 species in the families Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Sphingidae, Notodontidae, Noctuidae, Pantheidae, Lymantriidae, Nolidae and Arctiidae from the Southern Ural Mountains is presented. The material was collected during 1996–2001 in 10 different expeditions. Dichagyris lux Fibiger & K. Nupponen sp. n. is described. 17 species are reported for the first time from Europe: Clostera albosigma (Fitch, 1855), Xylomoia retinax Mikkola, 1998, Ecbolemia misella (Püngeler, 1907), Pseudohadena stenoptera Boursin, 1970, Hadula nupponenorum Hacker & Fibiger, 2002, Saragossa uralica Hacker & Fibiger, 2002, Conisania arida (Lederer, 1855), Polia malchani (Draudt, 1934), Polia vespertilio (Draudt, 1934), Polia altaica (Lederer, 1853), Mythimna opaca (Staudinger, 1899), Chersotis stridula (Hampson, 1903), Xestia wockei (Möschler, 1862), Euxoa dsheiron Brandt, 1938, Agrotis murinoides Poole, 1989, Agrotis sp. -

World Bank Document
Public Disclosure Authorized Desertification Control and Ecological Conservation Project in Ningxia, China Pest Management Plan Public Disclosure Authorized Forestry Bureau of the Ningxia Hui Autonomous Region Public Disclosure Authorized October 10, 2011 Public Disclosure Authorized Contents 2.1 Occurrence of Pests and Diseases ................................................................3 2.2 Current Pest Control Methods in Ningxia ..................................................7 3.1 Pesticide regulatory framework in Ningxia ................................................9 3.2 Administration of pests/diseases control ...................................................10 3.3 Organizational Responsibilities for Quality and Safety .......................... 11 4.1 The basic principles .....................................................................................12 4.2 Improving pesticide use for forest pest control ........................................12 4.3 Management of pesticides distribution and use. ....................................13 4.4 Measures of pesticides use ........................................................................14 5.1 Purpose of an Integrated Pest Management (IPM) System ....................16 5.2 Main Forest Pest Control Methods and Pesticide Types Proposed ........17 5.2.1 Control methods .......................................................................................17 5.2.2 Pesticide types ...........................................................................................18 -

Butterflies & Moths of the Spanish Pyrenees
Butterflies & Moths of the Spanish Pyrenees Naturetrek Tour Report 6 - 13 July 2016 Goat Moth by Chris Gibson Large Tortoiseshell by David Tipping Spotted Fritillary by David Tipping Spanish Purple Hairstreak by Bob Smith Report compiled by Chris Gibson Images courtesy of David Tipping, Bob Smith & Chris Gibson Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ England T: +44 (0)1962 733051 F: +44 (0)1962 736426 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report Butterflies & Moths of the Spanish Pyrenees Participants: Chris Gibson, Richard Cash and Peter Rich (Leaders) with 10 Naturetrek clients Introduction A late, damp spring ensured that the landscape around Berdún, in the foothills of the Aragónese Pyrenees, was much greener than on some previous trips at this time. A wide range of nectar sources had persisted until mid- summer, and when the sun came out at least, attracted large numbers and a rich diversity of butterflies. We explored from the lowlands to the high mountains, in weather that varied from warm and humid, to very hot and dry, albeit with persistent northerly winds on the last couple of days. In total the week produced 113 species of butterfly, together with many dazzling day-flying moths (particularly burnets) and other wonderful bugs and beasties. And almost nightly moth trapping gave us a window into the night-life, albeit dominated by Pine Processionaries, but with a good sample of the big, beautiful and bizarre. Add in to the mix the stunning scenery, a good range of mountain birds, a few mammals and reptiles, and wonderful food, drink and accommodation at Casa Sarasa: the perfect recipe for an outstanding holiday! Day 1 Wednesday 6th July We arrived at Zaragoza Airport, met Peter, and boarded the minibuses to be taken to Casa Sarasa in Berdún; it was sunny and hot, but there were still a few interesting birds to be seen en route, including White Stork, Booted Eagle, and Red and Black Kites. -

ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE Lepidópteros De O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O
ISSN: 1989-6581 Fernández Vidal (2016) www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 16: 77-84 ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) III: Notodontidae. (Lepidoptera). Eliseo H. Fernández Vidal Plaza de Zalaeta, 2, 5ºA. E-15002 A Coruña (ESPAÑA). e-mail: [email protected] Resumen: Se elabora un listado comentado y puesto al día de los notodóntidos (Lepidoptera: Notodontidae) presentes en O Courel (Lugo, Galicia. España, N.O. Península Ibérica), recopilando los datos bibliográficos existentes (sólo para dos especies), a los que se añaden otros nuevos como resultado del trabajo de campo del autor, alcanzando un total de 23 especies. Entre los nuevos registros aportados se incluyen dos primeras citas para Galicia: Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) y Rhegmatophila alpina (Bellier, 1881), así como otras dos para la provincia de Lugo: Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) y Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). Palabras clave: Lepidoptera, Notodontidae, O Courel, Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica. Abstract: Lepidoptera from O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) III: Notodontidae. (Lepidoptera). An updated and annotated list of the prominent moths (Lepidoptera: Notodontidae) known to occur in O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) is made, compiling the existing bibliographic records (only for two species) and reaching up to 23 species after adding new ones as a result of the fieldwork undertaken by the author. The new data reported include two first records for Galicia: Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790) and Rhegmatophila alpina (Bellier, 1881) as well as other two for the province of Lugo: Drymonia velitaris (Hufnagel, 1766) and Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758). -

Aposematism and Mimicry in Caterpillars
Journal of the Lepidopterists' Society 49(4), 1995,386-396 APOSEMA TISM AND MIMICRY IN CATERPILLARS MAY R. BERENBAUM Department of Entomology, University of Illinois, Urbana, llinois 61801, USA ABSTRACT. In the Lepidoptera, described instances of larval mimicry are vastly and curiously fewer in number than those tabulated for adults. This disparity may arise in large part from a lack of pertinent research, rather than actual differences between the two life stages. The evolution of larval coloration and its role in the development of possible larval mimicry complexes represents largely unbroken and fertile ground for study. Aposematic coloration is a conspicuous characteristic of many larval lepidopterans-so conspicuous, in fact, that Darwin (1871:326) was prompted to remark: " ... distastefulness alone would be insufficient to protect a caterpillar unless some outward sign indicated to its would-be destroyer that its prey was a disgusting morsel. ... Under these circumstances it would be highly advantageous to a caterpillar to be instantaneously and certainly recognized as unpalatable by all birds and other animals. Thus the most gaudy colors would be serviceable and might have been gained by variation and the survival of the most easily-recognized individual." Conspicuous in their absence, however, are the mimicry complexes that are associated so frequently with aposematic adult Lepidoptera. Virtually all of mimicry theory as it relates to Lepidoptera revolves around discussions of wing patterns in adults and has done so for over a hundred years (Remington 1963). This bizarre apparent asymmetry in the frequency of mimetic resemblance in larval versus adult stages has been remarked upon, but not satisfactorily accounted for, by several authors (e.g., Sillen-Tullberg 1988, Turner 1984). -

African Butterfly News (2019-5) Includes a Brief Report of an Aberrant Lepidochrysops Plebeia That Was Found in That Period—A Singular Christmas Gift
NOVEMBER 2019 EDITION: AFRICAN ABN 2019 - 6 (SEPTEMBER AND OCTOBER 2019) BUTTERFLY THE LEPIDOPTERISTS’ SOCIETY OF AFRICA NEWS LATEST NEWS Welcome to November’s newsletter! Spring has been and gone and, on the Highveld at least, we’ve had a better season than we’ve had for several years. There haven’t been any remarkable records, but off hand, I can’t think of any “missing” spring butterflies. Unfortunately, with persistently hot, dry weather, things are tailing off a bit now. A final reminder that our annual Conference starts on Saturday 16 Oct; the venue is the Knysna Hollow Conference Centre, Webedacht Road, Knysna. Registration starts at 7h30. I’ve attached a link to the conference program below: 2019 LepSoc Africa Annual Conference Further phosphor frolics (Mark Liptrot) Mark Liptrot recently found the Southern Forest Opal (Chrysoritis phosphor phosphor) at Hogsback. As far as I’m aware, these are the first photographs ever taken of this taxon in the wild It was a sheer fluke that I was in the right place at the right time to see this one. We’d just arrived in Hogsback at the Air B&B Bramber Cottage at mid-afternoon on 4th October, and settled down to have coffee at the outside table. I noticed a lot of insect activity on the adjacent Mexican Orange (Choisya ternata), an exotic aromatic shrub. This attracted plenty of honey bees and a Bradypodion ventrale, the eastern Cape dwarf chameleon (see photo). My wife Cecily and I were lamenting the fact that the Hogsback gardens were full of exotics (Azaleas in particular), and that the Chrysoritis phosphor phosphor (Mark Liptrot) surrounding plantations (mainly pine and wattle) were infesting the gardens and the Afromontane forests. -

Formosan Entomologist Journal Homepage: Entsocjournal.Yabee.Com.Tw
DOI:10.6662/TESFE.202002_40(1).002 台灣昆蟲 Formosan Entomol. 40: 10-83 (2020) 研究報告 Formosan Entomologist Journal Homepage: entsocjournal.yabee.com.tw An Annotated Checklist of Macro Moths in Mid- to High-Mountain Ranges of Taiwan (Lepidoptera: Macroheterocera) Shipher Wu1*, Chien-Ming Fu2, Han-Rong Tzuoo3, Li-Cheng Shih4, Wei-Chun Chang5, Hsu-Hong Lin4 1 Biodiversity Research Center, Academia Sinica, Taipei 2 No. 8, Tayuan 7th St., Taiping, Taichung 3 No. 9, Ln. 133, Chung Hsiao 3rd Rd., Puli, Nantou 4 Endemic Species Research Institute, Nantou 5 Taipei City Youth Development Office, Taipei * Corresponding email: [email protected] Received: 21 February 2020 Accepted: 14 May 2020 Available online: 26 June 2020 ABSTRACT The aim of the present study was to provide an annotated checklist of Macroheterocera (macro moths) in mid- to high-elevation regions (>2000 m above sea level) of Taiwan. Although such faunistic studies were conducted extensively in the region during the first decade of the early 20th century, there are a few new taxa, taxonomic revisions, misidentifications, and misspellings, which should be documented. We examined 1,276 species in 652 genera, 59 subfamilies, and 15 families. We propose 4 new combinations, namely Arichanna refracta Inoue, 1978 stat. nov.; Psyra matsumurai Bastelberger, 1909 stat. nov.; Olene baibarana (Matsumura, 1927) comb. nov.; and Cerynia usuguronis (Matsumura, 1927) comb. nov.. The noctuid Blepharita alpestris Chang, 1991 is regarded as a junior synonym of Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) (syn. nov.). The geometrids Palaseomystis falcataria (Moore, 1867 [1868]), Venusia megaspilata (Warren, 1895), and Gandaritis whitelyi (Butler, 1878) and the erebid Ericeia elongata Prout, 1929 are newly recorded in the fauna of Taiwan. -
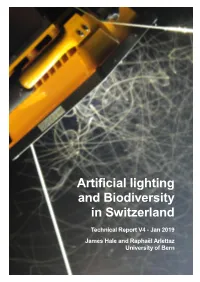
Artificial Lighting and Biodiversity in Switzerland
Artificial lighting and Biodiversity in Switzerland Technical Report V4 - Jan 2019 James Hale and Raphaël Arlettaz University of Bern 1 Table of Contents 1 Introduction .....................................................................................................................4 1.1 Background to this report .........................................................................................4 1.2 Key findings from this study: .....................................................................................4 1.3 Key recommendations: .............................................................................................5 1.4 Ecological actions overview ......................................................................................7 2 Data availability on Swiss artificial lighting .......................................................................9 2.1 Summary ..................................................................................................................9 2.2 Introduction and background ..................................................................................10 2.3 Review and analysis of Swiss lighting data.............................................................10 2.3.1 VIIRS DNB (satellite mounted sensor).............................................................10 2.3.2 ISS images ......................................................................................................12 2.3.3 Street lamp inventories ....................................................................................18 -

DNA Barcoding in Quarantine Inspection: a Case Study on Quarantine Insect Monitoring for Lepidoptera Obtained Through Quarantine Inspection on Foreign Vessels
MITOCHONDRIAL DNA PART B: RESOURCES 2019, VOL. 4, NO. 1, 43–48 https://doi.org/10.1080/23802359.2018.1536447 MITO COMMUNICATION DNA barcoding in quarantine inspection: a case study on quarantine insect monitoring for Lepidoptera obtained through quarantine inspection on foreign vessels Tae Hwa Kanga, Sunam Kima, Ki-Jeong Hongb and Heung Sik Leec aBio Control Research Center, Jeonnam Bioindustry Foundation, Gokseong-gun, Korea; bDepartment of Plant Medicine, Sunchon National University, Suncheon-si, Korea; cPlant Quarantine Technology Center, Animal and Plant Quarantine Agency, Gimcheon-si, Korea ABSTRACT ARTICLE HISTORY We conducted quarantine insect species diversity monitoring using DNA barcoding with 517 lepidop- Received 21 June 2018 teran samples that were obtained from quarantine inspections of foreign vessels entering Korea. For Accepted 20 September 2018 species delimitation and species identification of the analyzed samples, we applied a 2% cutoff rule. KEYWORDS Consequently, 145 (368 samples) were considered taxonomically identified. Therefore the number of samples that were identified to the species level was relatively low, at approximately 71%. Thirty of DNA barcode; Lepidoptera; quarantine pest; vessel; 145 species were not known in Korea, three, i.e., Noctua pronuba (Noctuidae), Orthosia hibisci quarantine inspection (Noctuidae), and Pieris brassicae (Pieridae), were checked as ‘Regulated pests’ in Korea. Introduction invasive species requires, at a minimum, the ability to recog- nize those species (Darling and Blum 2007). Biosecurity is one of the most important issues facing the The Animal and Plant Quarantine Agency of Korea treats international community and encompasses the protection and manages 1552 plant pest species as regulated pests (60 against any risk of biological harm, such as the threatening quarantine pest species and 1492 regulated non-quarantine of ecosystem stability, producer livelihoods, and consumer pest species) (Animal and Plant Quarantine Agency, http:// confidence (Cock 2003; Armstrong and Ball 2005). -
Cyclopelta Robusta, a New Species of Dinidorid Bugs
P O L I S H JOU R NAL OF ENTOM O LOG Y POL SKIE PISMO ENTOMOL OGICZ N E VOL. 80: 83-116 Gdynia 31 March 2011 DOI: 10.2478/v10200-011-0007-2 Contribution to knowledge of the butterflies and moths (Lepidoptera) of north-eastern Poland with a description of a new tineid species from the genus Monopis HÜBNER, 1825 JAN ŠUMPICH *, JAN LIŠKA **, IVO DVOŘÁK *** * CZ-582 61 Česká Bělá 212, Czech Republic; e-mail: [email protected]; ** Forestry and Game Management Research Institute Jíloviště-Strnady, CZ–156 04 Prague 5 – Zbraslav, Czech Republic; e-mail: [email protected]; *** Tylova 23, CZ-586 01 Jihlava, Czech Republic; e-mail: [email protected] ABSTRACT. This work contains faunistic data on the occurrence of 677 butterfly and moth species found during 2000-2008 in north-eastern Poland (Podlasie Province). The species Monopis fenestratella (HEYDEN, 1863), Amphisbatis elsae SVENSSON, 1982, Coleophora ptarmicia WALSINGHAM, 1910 and Epermenia falciformis (HAWORTH, 1828) were found in Poland for the first time. Recent data are provided for five other species – Monochroa servella (ZELLER, 1839), Teleiodes aenigma SATTLER, 1983, Dichomeris limosella (SCHLÄGER, 1849), Aethes rutilana (HÜBNER, 1817) and Eana derivana (LA HARPE, 1858) – known in Poland only from historical data. The occurrence in Podlasie of 75 species is reported for the first time, and the occurrence of 6 other species is confirmed for this area after more than 50 years. This work also describes a new species, Monopis bisonella ŠUMPICH, sp. n. A number of species are very rare in Poland and occur only locally. -
Neue Entomologische Nachrichten
©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at J)/SS NEUE ENTOMOLOGISCHE NACHRICHTEN aus dem Entomologischen Museum Dr. Ulf Eitschberger Beiträge zur Ökologie, Faunistik und Systematik von Lepidopteren 25. Band ISSN 0722-3773 Okt. 1989 ALEXANDER SCHINTLMEISTER Zoogeographie der palaearktischen Notodontidae (Lepidoptera) Verlag: Dr. Ulf Eitschberger, Humboldtstr. 13a, D-8688 Marktleuthen Einzelpreis: DM 42,— ©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at NEUE ENTOMOLOGISCHE NACHRICHTEN aus dem Entomologischen Museum Dr. Ulf Eitschberger Beiträge zur Ökologie, Faunistik und Systematik von Lepidopteren Herausgeber und Schriftleitung: Dr. ULF EITSCHBERGER, Humboldtstr. 13a, D-8688 Marktleuthen Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Jede Ver wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen auf foto mechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie), Übersetzun gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verar beitung in elektronischen Systemen. ISSN 0722-3773 ©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at NEUE ENTOMOLOGISCHE NACHRICHTEN aus dem Entomologischen Museum Dr. Ulf Eitschberger Beiträge zur Ökologie, Faunistik und Systematik von Lepidopteren 25. Band ISSN 0722-3773 Okt. 1989 ALEXANDER SCHINTLMEISTER Zoogeographie der palaearktischen Notodontidae (Lepidoptera) ©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at ©Entomologisches Museum Dr. Ulf Eitschberger, download unter www.zobodat.at Zoogeographie der palaearktischen Notodontidae (Lepidoptera) von A lexander S chintlmeister 1 Inhaltsverzeichnis Zusammenfassung 5 Taxonomische Veränderungen 6 Neue Synonyme 6 1. Einleitung, Dank 7 2. Abgrenzung des Gebietes 8 3. Material 8 4. Durchforschungsstand des Untersuchungsgebietes 9 5. Die kausal-historische Methode in der Zoogeographie 10 6. -
Lichtfallenfänge Des Hermelinspinners Cerura Erminea ESPER, 1784, Im Niederbayerischen Inntal (Zahnspinner, Notodontidae)
© Mitt. Zool. Ges. Braunau/Austria, download unter www.biologiezentrum.at MITT. ZOOL. GES. BRAUNAU Bd. 9, Nr. 3: 199 - 204 Braunau a. I., Dezember 2007 ISSN 0250-3603 Lichtfallenfänge des Hermelinspinners Cerura erminea ESPER, 1784, im niederbayerischen Inntal (Zahnspinner, Notodontidae) von JOSEF H. REICHHOLF Einleitung Der Hermelinspinner, auch Gro- Brandenburg häufiger am Licht als ßer Weißer Gabelschwanz genannt, vinula (d. h. als der Große Gabel- kommt nach SAGE (1996) im süd- schwanz; Anmerkung des Verfas- ostbayerischen Inn-Salzach-Gebiet sers); Raupen dort auch an Hybrid- selten bis sehr selten vor. Die Auf- pappeln, selbst in Neubaugebieten.“ listung enthält diese sehr markante Zu letzterer Angabe nehmen die und zweifellos auch als schön zu Autoren Bezug auf GELBRECHT, was bezeichnende Art in vier der neun wohl dessen mit mehreren Mitarbei- Teilgebiete und nur in einem fand tern erstellte ‚Kommentierte Ver- Walter SAGE selbst bis 1995 den zeichnis der Großschmetterlinge Hermelinspinner. Er charakterisiert (Macrolepidoptera) der Länder Ber- das Vorkommen in folgender Wei- lin und Brandenburg im Band von se: „Seltene Art, die nur unregel- GERSTNER & MEY (1993) meint. mäßig am Licht erscheint und oft Die Auen am unteren Inn sollten über Jahre hinweg ausbleibt. Die mit ihren ausgedehnten Vorkommen Raupen fressen in den Gipfelregio- von Weiden sowie den großen nen alter Pappeln und Weiden.“ Schwarz- Populus nigra und Be- Ähnlich äußerten sich WEIDEMANN & ständen von Balsampappeln P. tri- KÖHLER (1996) zu Vorkommen und chocarpa sowie insbesondere den Seltenheit des Großen Weißen Ga- ausgedehnten Pflanzungen kanadi- belschwanzes. Sie führen zu den scher Hybridpappeln P. x canaden- Hauptfutterpflanzen jedoch Genaue- sis somit weit bessere Vorausset- res aus: „Die Raupen besiedeln zungen für Vorkommen und Häufig- Weiden sowie lichte Bestände ho- keit des Hermelinspinners bieten als her, alter Pappeln, besonders Py- das den Angaben von SAGE (1996) ramidenpappeln in Auelandschaf- zufolge der Fall ist.