Johannes-Bobrowski-Gesellschaft.De/Index.Html
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Millennium of Struggle? Introduction to the History of Polish-German Relations in Its European Context
A Millennium of Struggle? Introduction to the History of Polish-German Relations in its European Context Spring 2011 GRC 360E, REE 335, EUS 346, HIS 362G, POL 324 Unique # 38395, 45205, 36505, 39835, 45457 Class meets: T, Th 9:30 a.m. – 11:00 a.m. BUR 337 Instructor: Jan Musekamp Office: Burdine 368 Phone: 232-6374 Email: [email protected] Office Hours: T 1:30 p.m. – 3:30 p.m. and by appointment Course Description: In 1945, Polish historian Zygmunt Wojciechowski edited a book entitled ―Germany-Poland. 1000 years of struggle.‖ The author was well-known for his anti-German attitude, and was a prominent supporter of the ―Polish Western Idea‖ during the interwar period. Proponents of the ―Western Idea‖ proposed a shift of Polish borders deep into German territory; they wanted to ‗return‘ territory belonging to the first Polish state in the tenth century. Much of the land had been settled by German-speakers (with assimilated Slavic-speaking populations) since the thirteenth century. After World War II, the ―Western Idea‖ was incorporated by Polish communists in an attempt to cater to nationalist rhetoric; accordingly, the communist ―Western Idea‖ projected an endless struggle between Germans and Poles in order to justify new Polish borders and an anti-German stance. Not surprisingly, positive aspects of Polish-German history had no place in the picture. In this course, we will explore Polish-German relations in the context of European change. On the one hand, the region is typified by territorial conflict (as best revealed by the eighteenth century elimination of Poland through Prussian, Austrian and Russian partition). -

Johannes Bobrowski: Poetry from East Germany
CutBank Volume 1 Issue 14 CutBank 14 Article 55 Spring 1980 Johannes Bobrowski: Poetry from East Germany Rich Ives Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/cutbank Part of the Creative Writing Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Ives, Rich (1980) "Johannes Bobrowski: Poetry from East Germany," CutBank: Vol. 1 : Iss. 14 , Article 55. Available at: https://scholarworks.umt.edu/cutbank/vol1/iss14/55 This Review is brought to you for free and open access by ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in CutBank by an authorized editor of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. REVIEWS From the Rivers International Writing Program, University of Iowa Iowa City, Iowa $2.50, paper Johannes Bobrowski: Poetry from East Germany Johannes Bobrowski is probably the best known East German poet in this country and his recognition here is due in large part to the carefully evocative translations of Ruth and Mathew Mead. With the addition ofFrom the Rivers (International Writing Program, University of Iowa) to the earlier volume,Shadowland (published in the United States by Alan Swallow and included in the Penguin volumeJohannes Bobrowski: Selected Poems) English readers now have nearly all of Bobrowski’s poems available to them. Other translators have also published translations of Bobrowski in magazines and anthologies, and I would hope there might be an eventual gathering of these into a “Collected Poems” volume with Shadowland andFrom the Rivers. Much of Bobrowski’s poetry bears a superficial relationship to the earlier German poetry of nature, but unlike much of that vein’s shallow description of idyllic settings, Bobrowski is supremely concerned with the people in his landscapes and demonstrates a facility with technique that makes the poems seem at once spare and vibrating with covert meaning. -

UNIVERSITY of TURKU Faculty of Humanities Baltic Sea Region Studies
UNIVERSITY OF TURKU Faculty of Humanities Baltic Sea Region Studies Master’s Thesis BECOMING LOCALS IN A BORDERLAND OF EXILES. SENSE OF PLACE IN THE STORIES OF LITHUANIA MINOR DWELLERS. Camilla Marucco Turku August 2014 The originality of this thesis has been checked in accordance with the University of Turku quality assurance system using the Turnitin Originality Check service. THE UNIVERSITY OF TURKU Baltic Sea Region Studies Faculty of Humanities MARUCCO, CAMILLA: Becoming Locals in a Borderland of Exiles. Sense of Place in the Stories of Lithuania Minor Dwellers. Master’s thesis, 119 p., 1 appendix page Baltic Sea Region Studies August 2014 This thesis deals with sense of place, the relation that we construct with our dwelling and the surrounding environment. The topic belongs to the field of human geography. Sense of place is deeply intertwined with the ideas of feeling at home and having a place where to return. I argue that narratives of life experience help us relate to the places we inhabit, go through, leave. My analysis concerns Lithuania Minor, the Lithuanian region lying by the border with Kaliningrad, and focuses in particular on Vilkyškiai, a village in the municipality of Pagėgiai. Most of the area’s original population disappeared in the war. After 1945, people from all over the country and the USSR settled here. This raised the prickly question of who belongs to the borderland. Refugees, migrants and settlers allow us to observe closely the development of sense of place and its main constituents. Through this analysis, I challenge the idea of people’s natural rights to places and shows how time, engagement in local-based cultural activities and recollection help foreigners become locals. -
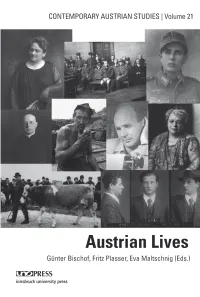
CAS21 for Birgit-No Marks
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Austrian Lives
Austrian Lives Günter Bischof, Fritz Plasser, Eva Maltschnig (Eds.) CONTEMPORARY AUSTRIAN STUDIES | Volume 21 innsbruck university press Copyright ©2012 by University of New Orleans Press, New Orleans, Louisiana, USA. All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher. All inquiries should be addressed to UNO Press, University of New Orleans, LA 138, 2000 Lakeshore Drive, New Orleans, LA, 70119, USA. www.unopress.org. Printed in the United States of America. Book and cover design: Lauren Capone Cover photo credits given on the following pages: 33, 72, 119, 148, 191, 311, 336, 370, 397 Published in the United States by Published and distributed in Europe University of New Orleans Press: by Innsbruck University Press: ISBN: 9781608010929 ISBN: 9783902811615 Contemporary Austrian Studies Sponsored by the University of New Orleans and Universität Innsbruck Editors Günter Bischof, CenterAustria, University of New Orleans Fritz Plasser, Universität Innsbruck Production Editor Copy Editor Bill Lavender Lauren Capone University of New Orleans University of New Orleans Executive Editors Klaus Frantz, Universität Innsbruck Susan Krantz, University of New Orleans Advisory Board Siegfried Beer Sándor Kurtán Universität Graz Corvinus University Budapest Peter Berger Günther Pallaver -

Veränderte Landschaft: East German Nature Poetry Since Reunification
Veränderte Landschaft: East German Nature Poetry Since Reunification Axel Goodbody, Bath ISSN 1470 – 9570 Veränderte Landschaft 103 Veränderte Landschaft. East German Nature Poetry since Reunification Axel Goodbody, Bath This paper asks what has become of the distinctive tradition of GDR landscape poetry since reunification. It examines the representation of the physical changes which have come over the East German landscape in the work of older and younger poets, and considers the extent to which they provide objective correlatives for the socio-political and cultural changes experienced since 1989. The role played by landscape poetry in identity construction is also discussed. The past, travel and Heimat are themes associated with a new critical regionalism in the new Länder founded on personal and collective, local and East German experience. The principal focus is on the poems of Volker Braun, Heinz Czechowski, Wulf Kirsten and Thomas Rosenlöcher, but reference is also made to texts by younger contemporaries such as Kurt Drawert, Durs Grünbein and Michael Wüstefeld. 1. The Landscape Poem as a genre articulating responses to social transformation ‘Veränderte Landschaft’ was the title of an anthology of GDR landscape poetry published by the Insel Verlag in 1979. Its editor, Wulf Kirsten, paid tribute to his former teacher at the Johannes R Becher Literature Institute in Leipzig, Georg Maurer, by opening the volume with Maurer’s poem ‘Veränderte Landschaft’, which expressed the feeling of a new beginning at the end of the Second World War, and adopting the phrase to denote a poetic programme celebrating the transformation of society in the GDR under socialism. -

KURT MASUR Der Besuch Der Tagung Ist Frei. Eine Anmeldung
eit über einem halbem Jahrhundert ist Prof. Siegfried Matthus (*1934) freischaffender SKomponist großer Opern, vokaler Miniaturen, expressiver Sinfonik wie auch virtuoser Konzerte. Seine Kompositionen schöpfen aus der conditio humana, bewegen die Frage nach ANNA AMALIA UND GOETHE AKADEMIE ZU WEIMAR den Bedingungen des Menschseins wie auch deren Verhältnis zur Natur: Frieden und Krieg, INTERNATIONALES SYMPOSIUM MIT KONZERTEN ZUM 80. GEBURTSTAG INTERNATIONALE SIEGFRIED MATTHUS Zwang und Freiheit, Liebe und Tod gepaart mit Lust auf musikalische Lichte, deren Einfälle und Kreativität auch in der Fröhlichkeit, dem Humor und dem Charme des Komponisten Der Besuch der Tagung ist frei. Eine Anmeldung nicht erforderlich. SCHIRMHERRSCHAFT / PATRONAGE GESELLSCHAFT e . V. ihren tragenden Grund finden. Schon ab den 1970er Jahren gewann Siegfried Matthus in- ternationale Aufmerksamkeit und Anerkennung, was unter anderem zur Ernennung zum KURT MASUR Mitglied in Akademien in Ost- wie auch in Westdeutschland führte. Das Jubiläum eröffnet In Kooperation mit / In Cooperation with die Möglichkeit, prägende literarische Wurzeln Moderner Musik zu untersuchen. Bezüge zur klassischen Literatur sind gerade bei Siegfried Matthus von konstitutiver Bedeutung für sei- UNIVERSITÄT LEIPZIG • HOCHSCHULE FÜR MUSIK ne Kompositionen. Ein Schwerpunkt bildet daher das umfangreiche Opernwerk, etwa die RANZ ISZT EIMAR – NSTITUT FÜR Die INTERNATIONALE SIEGFRIED MATTHUS GESELLSCHAFT F L W I vielbeachtete Oper »Die unendliche Geschichte« nach Michael Ende (2004), die die Selbstent- -
In Contemporary German Poetry: Gerald Zschorsch, Kurt Drawert, Brigitte Oleschinski
CALL: Irish Journal for Culture, Arts, Literature and Language Volume 1 Issue 1 Language, Migration and Diaspora Article 15 2016 "The Wild East" in Contemporary German Poetry: Gerald Zschorsch, Kurt Drawert, Brigitte Oleschinski Sabine Egger Mary Immaculate College, University of Limerick, [email protected] Follow this and additional works at: https://arrow.tudublin.ie/priamls Part of the German Language and Literature Commons Recommended Citation Egger, Sabine (2016) ""The Wild East" in Contemporary German Poetry: Gerald Zschorsch, Kurt Drawert, Brigitte Oleschinski," CALL: Irish Journal for Culture, Arts, Literature and Language: Vol. 1: Iss. 1, Article 15. doi:10.21427/D7RG64 Available at: https://arrow.tudublin.ie/priamls/vol1/iss1/15 This Article is brought to you for free and open access by the Ceased publication at ARROW@TU Dublin. It has been accepted for inclusion in CALL: Irish Journal for Culture, Arts, Literature and Language by an authorized administrator of ARROW@TU Dublin. For more information, please contact [email protected], [email protected]. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 License Egger: "The Wild East" in Contemporary German Poetry: Gerald Zschorsch, “The Wild East” in Contemporary German Poetry: Gerald Zschorsch, Kurt Drawert, Brigitte Oleschinski1 Sabine Egger Mary Immaculate College, University of Limerick / Irish Centre for Transnational Studies, Ireland [email protected] Abstract This article discusses images of a “European” or “Wild” -

I Transforming Suicides: Literary Heritage, Intertextuality, and Self-Annihilation in GDR Fiction of the 1970S and 1980S Robert
Transforming Suicides: Literary Heritage, Intertextuality, and Self-Annihilation in GDR Fiction of the 1970s and 1980s Robert Blankenship A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Germanic Languages and Literatures. Chapel Hill 2011 Approved by Advisor: Dr. Richard Langston Reader: Dr. Alice Kuzniar Reader: Dr. Eric Downing Reader: Dr. Gabriel Trop Reader: Dr. Edna Andrews i ABSTRACT Transforming Suicides: Literary Heritage, Intertextuality, and Self-Annihilation in GDR Fiction of the 1970s and 1980s (Under the direction of Dr. Richard Langston) This dissertation examines fictional suicides in the literature of the second half of the German Democratic Republic and questions the common assumption that these works represent a direct, realistic reflection of East German society. I point instead to intertextuality in these works and investigate the relationship between fictional suicide in the literature of the German Democratic Republic and the canonical literary works revered by that country’s cultural authorities. These intertextual, fictional suicides disrupt the literary heritage of the GDR, a matter that is even more subversive than implying that people killed themselves in the GDR. Each of the four main chapters of the dissertation focuses on one GDR text and and the literary heritage that it subverts. Ulrich Plenzdorf’s Die neuen Leiden des jungen W. brings Goethe’s Die Leiden des jungen Werther into contact with GDR youth culture when the novel’s main character reads Goethe’s work without context and, like the main character in Goethe’s work, kills himself. -

Istorinė Pagėgių Ir Sovetsko Miestų Genezė
Istorinė Pagėgių ir Sovetsko I miestų genezė 1 Kiekvienos šalies istorinė raida savita, tačiau praeityje Klaipėdos kraštas ir Rusijos Federacijos Kaliningrado (Karaliaučiaus) sritis buvo nedalomi Prūsijos karalystės teri- toriniai vienetai. Prūsijos karalystė – tai nebe egzistuojanti istorinė valstybė kelis šimtmečius dariusi didelę ekonominę, politinę ir kultūrinę įtaką visai Europai. Prūsijos karalystė užėmė didelę teritoriją, todėl 1752 m. buvo perskirstyta į 10 sričių. Didžiausia sritis – Įsrutis (Rytų Prūsija), kurią sudarė Įsručio, Ragainės, Tilžės ir Klaipėdos apskritys. 1871 m. suvienijus Vokietiją, Prūsija tapo jos dalimi. Pagėgiai, eilinis to meto kaimas, įėjo į Klaipėdos, o Tilžės (Sovetsko) miestas, garsėjantis savo turgumis, į Tilžės apskritį. XX a. pr. per Pagėgius į Lietuvą buvo intensyviai gabenama draudžiama lietuviška spauda. Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, Pagėgiai tapo apskrities centru. 1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, Pagėgiai gavo miesto teises. Nuo tada šis miestelis ėmė sparčiai augti. Iškilo modernių to meto architektūros statinių – kotedžai, vilos, nutiestos pagrindinės gatvės, kuriamos lietuviškos įstaigos, mokyklos, bankai, viešbučiai, užeigos. Po Antrojo pasaulinio karo buvęs Rytų Prūsijos regionas padalytas dviems karą laimėjusioms valstybėms – Sovietų Sąjungai ir Lenkijai. Sovietmečiu Pagėgių mi- estas sunyko ir ilgainiui buvo įtrauktas į Šilutės rajono sudėtį. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Pagėgiai, atskirti nuo Šilutės rajono, ėmė sparčiai vystytis. 2000 m. Pagėgiai tampa naujai įsteigtos Pagėgių savivaldybės centru, kuri šiandien priklauso Tauragės apskričiai. Šiuo metu Pagėgių mieste gy- vena apie 2 tūkst. gyventojų. Pagėgių miesto herbe pavaizduota sidabrinė gegutė, kojomis nešanti auksinį raktą. Žalias herbo fonas simbolizuoja viltį ir gamtos grožį. Gegutė siejama su liaudiška Pagėgių vardo etimologija. Auksinis raktas reiškia pasienio miestą. Herbas sukurtas 1995 m., autorė – dailininkė Laima Ramonienė. -

Depictions of Daily Life in the East German Cinema, 1949–1989 the Joshua Feinstein Triumph of the Ordinary
The Triumph of the Ordinary Depictions of Daily Life in the East German Cinema, 1949–1989 The joshua feinstein Triumph of the Ordinary The University of North Carolina Press Chapel Hill & London ∫ 2002 The University of North Carolina Press All rights reserved Designed by Richard Hendel Set in Charter and Meta types by Keystone Typesetting, Inc. Manufactured in the United States of America This book was published with the assistance of the William Rand Kenan Jr. Fund of the University of North Carolina Press. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Committee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Feinstein, Joshua. The triumph of the ordinary : depictions of daily life in the East German cinema, 1949–1989 / by Joshua Feinstein. p. cm. Based on the author’s thesis—Stanford. Filmography: p. Includes bibliographical references and index. isbn 0-8078-2717-7 (cloth: alk. paper) isbn 0-8078-5385-2 (pbk.: alk. paper) 1. Motion pictures—Germany (East)—History. I. Title. pn1993.5.g3 f37 2002 791.43%0943%1—dc21 2001059826 Excerpts from the screenplay to Die Legende von Paul und Paula by Ulrich Plenzdorf quoted by permission of Suhrkamp Verlag. ∫ Henscheverlag 1974; all rights reserved by Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. cloth060504030254321 paper 06 05 04 03 02 54321 To my parents, Edith and Leonard contents Acknowledgments, ix Abbreviations, xiii Introduction: Back to the Future, 1 1. Conquering the Past and Constructing the Future: The DEFA Film Studio and the Contours of East German Cultural Policy, 1946–1956, 19 2. -

Die Symbolische Aneignung Historischer Räume Im Östlichen Preussen
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Klaipeda University Open Journal Systems DIE SYMBOLISCHE ANEIGNUNG HISTORISCHER RÄUME IM ÖSTLICHEN PREUSSEN. NATIONALE UND REGIONALE STRATEGIEN Jörg Hackmann Abstract The paper discusses different appropriation strategies applied to the same historical region of East Prussia. By dating the beginning of the symbolic appropriation to the early 19th cen- tury, the author reviews the strategies, first applied by Germans and Poles, and later also by 170 Lithuanians and Russians, to make East Prussia or their respective part (Warmia and Masuria, Lithuania Minor, and the Kaliningrad Oblast) their own. This is demonstrated by several pe- riods, starting with the situation before 1914, the First World War, the interwar period, and the Second World War, when East Prussia still existed; and finishing with the postwar period and the changes after 1989. A distinction is made between national and regional East Prussia appropriation strategies, as well as different levels of the process, i.e. publicistic (literary) and practical. Key Words: East Prussia, symbolic appropriation, appropriation strategies, polyculturalism, cultural contacts. Anotacija Straipsnyje aptariamos skirtingos pasisavinimo strategijos, taikytos tam pačiam istoriniam re- gionui – Rytų Prūsijai. Autorius, šio regiono simbolinio pasisavinimo pradžią datuodamas XIX a. pradžia, apžvelgia, kokias strategijas iš pradžių vokiečiai ir lenkai, o paskui ir lietuviai bei rusai taikė, paversdami Rytų Prūsiją ar atitinkamą jos dalį (Varmiją ir Mozūriją, Mažąją Lietuvą, Kali- ningrado sritį) sava. Tai parodoma keliais laikotarpiais, pradedant situacija prieš 1914 metus, Pirmuoju pasauliniu karu, tarpukario periodu ir Antruoju pasauliniu karu, kai Rytų Prūsija dar egzistavo, baigiant pokariu bei pokyčiais po 1989-ųjų.