3. BABOU Cheikh Anta.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Circular Economy in Africa-EU Cooperation
Circular Economy in Africa-EU Cooperation Country Report Senegal Written by November - 2020 EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Environment Directorate F – Global Sustainable Development Unit F2 - Bilateral & Regional Environmental Cooperation Contact: Gaëtan Ducroux E-mail: [email protected] European Commission B-1049 Brussels EUROPEAN COMMISSION Circular Economy in Africa-EU Cooperation Country Report Senegal Authors: Bonnaire, S.M.; Jagot, J.; Spinazzé, C.; Potgieter, J.E.; Rajput, J.; Hemkhaus, M.; Ahlers, J.; Koehler, J.; Van Hummelen, S. & McGovern, M. Acknowledgements We acknowledge the valuable contribution of several co-workers from within the four participating institutions, as well as the feedback received from DG Environment and other DG’s of the European Commission as well as the Members of the EU delegation to Senegal. Preferred citation Bonnaire, S.M.; Jagot, J.; Spinazzé, C. (2020) Circular economy in the Africa-EU cooperation - Country report for Senegal. Country report under EC Contract ENV.F.2./ETU/2018/004 Project: “ “Circular Economy in Africa-Eu cooperation”, Trinomics B.V., ACEN, adelphi Consult GmbH and Cambridge Econometrics Ltd. In association with: LEGAL NOTICE This document has been prepared for the European Commission however it reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. More information on the European Union is available on the Internet (http://www.europa.eu). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020 PDF ISBN 978-92-76-26828-4 doi:10.2779/042060 KH-06-20-056-EN-N © European Union, 2020 The Commission’s reuse policy is implemented by Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. -

Akon City, Senegal June 3Rd, 2020 Akon City Has Awarded the Contract
off-grid energy. A large Artificial Intelligence Akon City, Senegal Cluster to run the hospital is currently under June 3rd, 2020 development. Akon City's Phase 1 is expected to complete by end of 2023, and will see the construction of roads, a Hamptons Hospital campus, a Hamptons Mall, residences, hotels, a police station, a school, a waste facility and a solar power plant. Akon City Phase 2 will run from 2024 to 2029 and will end with a complete cryptocurrency City Akon City has awarded the contract for building running exclusively on AKOIN cryptocurrency. and executing the city to KE International, a US The initial US $4 billion investment secured by KE based Consulting and Engineering firm. The US $6 International for Akon City, is led by leaders in Billion futuristic-cryptocurrency themed City is healthcare and technology infrastructure and founded by Senegalese-American superstar and include MMTC's Julius Mwale. Mr. Mwale's philanthropist Akon. Hamptons Hospital, Mall, supermarket, solar With the awarding of the contract, KE power group, and data centers will be part of International has secured US $4 Billion from phase 1 of Akon City. investors for the first and second Phases of execution of Akon City, and will have Dubai based Bakri & Associates Development Consultants lead the architectural designs under KE International guidance. KE International is known for the design and execution of the US $2 billion Mwale Medical and Technology City (MMTC), a green City based in Western Kenya, which began in 2014 and is Another Co-development partner is Senegal's expecting completion in December 2020. -

IOM WCA a REGION on the MOVE 2020 Compressed.Pdf (PDF
HIGHLIGHTS S’ez A REGION ON THE MOVE MOBILITY TRENDS IN WEST AND CENTRAL AFRICA JANUARY — DECEMBER 2020 A Region on the Move – International Organization for Migration – West and Central Africa | 1 HIGHLIGHTS The opinions expressed in the report are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the International Organization for Migration (IOM). The designations employed and the presentation of material throughout the report do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of IOM concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning its frontiers or boundaries. IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society. As an intergovernmental organization, IOM acts with its partners in the international community: to assist in meeting the growing operational challenges of migration management; advance understanding of migration issues; encourage social and economic development through migration; and uphold the human dignity and well-being of migrants. The maps included in this document are for illustration purposes only. The depiction and use of boundaries, geographic names and related data shown on maps and included in this report are not warranted to be error free nor do they imply judgment on the legal status of any territory, or any endorsement or acceptance of such boundaries by IOM. PUBLISHER International Organization for Migration, Regional Office for West and Central Africa Dakar, Senegal © 2021 International Organization for Migration (IOM) Cover Picture: ©IOM/Amanda Nero All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior written permission of the publisher. -

The Senegambia Confederation In
Aka: The Continued Search for Appropriate Structures for Governance an AkaCameraReady final (Do Not Delete) 7/5/2017 10:05 AM CALIFORNIA WESTERN INTERNATIONAL LAW JOURNAL VOLUME 47 SPRING 2017 NUMBER 2 THE CONTINUED SEARCH FOR APPROPRIATE STRUCTURES FOR GOVERNANCE AND DEVELOPMENT IN AFRICA IN THE 21ST CENTURY: THE SENEGAMBIA CONFEDERATION IN HISTORICAL AND COMPARATIVE PERSPECTIVE PHILIP C. AKA*† * Professor of Political Science, Chicago State University; Adjunct Professor of Law, Indiana University Robert H. McKinney School of Law—Indianapolis; Member of the Illinois Bar; former Vice Chair, ABA Committee on International Human Rights; and Corresponding Editor, International Legal Materials (ILM); S.J.D., IU Robert H. McKinney School of Law—Indianapolis; Ph.D., Howard University; LL.M. (summa cum laude), IU Robert H. McKinney School of Law— Indianapolis; J.D., Temple University Beasley School of Law; M.A., University of North Texas; B.A. (magna cum laude), Edinboro University of Pennsylvania. Dr. Aka has written extensively on issues related to minority populations in Africa and the United States, including human rights. His recent publications germane to these topics include HUMAN RIGHTS IN NIGERIA’S EXTERNAL RELATIONS: BUILDING THE RECORD OF MORAL SUPERPOWER (Lexington Books, 2017), and Bridging the Gap Between Theory and Practice in Humanitarian Action: Eight Steps to Humanitarian Wellness in Nigeria, 24 WILLAMETTE JOURNAL OF INT’L LAW & DISPUTE RESOLUTION 1 (Fall 2016). † This Article evolved from a contribution to a festschrift for Professor Sulayman S. Nyang on his retirement following a distinguished academic career at 109 Published by CWSL Scholarly Commons, 2017 1 California Western International Law Journal, Vol. -
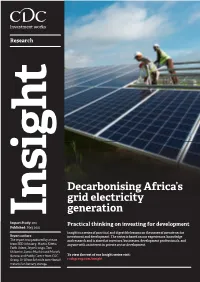
Decarbonising Africa's Grid Electricity Generation
Research Decarbonising Africa’s grid electricity generation Impact Study: 019 Practical thinking on investing for development Published: May 2021 Insight is a series of practical and digestible lessons on the issues of private sector Report authors: investment and development. The series is based on our experiences, knowledge The report was produced by a team and research and is aimed at investors, businesses, development professionals, and from EED Advisory: Martin Kitetu, anyone with an interest in private sector development. Faith Odero, Joyce Irungu, Tom Shikorire, James Muchiri and Murefu Barasa, and Paddy Carter from CDC To view the rest of our Insight series visit: Group. Dr Oliver Schmidt contributed cdcgroup.com/insight material on battery storage. Executive summary Contents Executive summary 2 The world faces a climate emergency. Global greenhouse gas emissions are falling nowhere near fast enough to avoid massive harm from global 1 Introduction 7 warming. The emissions from power plants alone, already operating or commissioned worldwide, have exhausted the carbon budget compatible 2 Africa’s need for power 8 with keeping warming to 1.5 degrees. 3 What it takes to keep the Africa faces a poverty emergency. The proportion of Africans living in lights on 15 extreme poverty is falling but population growth means the absolute number is still rising, and most projections foresee that trend continuing to 2030. And 4 Country case studies 29 eliminating the most extreme poverty (as measured by purchasing power 4.1 Nigeria 29 parity (PPP) of $1.90 per day) is an unacceptably low bar for African 4.2 South Africa 32 development aspirations. -

COVID-19) Global Epidemic Date of Issue: 3 March 2020
Outbreak Brief #7: Novel Coronavirus (COVID-19) Global Epidemic Date of Issue: 3 March 2020 88,948 cases and 3,044 deaths Data sources: National Health Commission of the People's Republic of China, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and African Union Member States Outbreak Update: Since the last brief, 9,611 new novel coronavirus (COVID-19) cases1 and 426 new deaths have been reported globally. Thirty-six new countries, including five new African countries, are reporting cases (Algeria, Armenia, Azerbaijan, Austria, Belarus, Brazil, Croatia, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, Estonia, Finland, Georgia, Greece, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Mexico, Monaco, Morocco, Netherlands, New Zealand, North Macedonia, Norway, Nigeria, Pakistan, Qatar, Romania, San Marino, Senegal, Switzerland, and Tunisia) and one new country (the United States) is reporting deaths for the first time. To date, 88,948 total COVID-19 confirmed cases, and 3,043 related deaths have been reported. Most cases (80,174; 90%) and deaths (2,915; 96%) have been reported from mainland China. Sixty-four different countries outside of China have reported 8,774 cases. To date 129 total deaths have been reported outside China from seven countries. The case fatality rate for COVID-19 has remained between 2-4% throughout the outbreak. For more detailed information on cases and deaths being reported outside of Africa, refer to the WHO daily situation reports2. To date, 30 countries in Africa have reported persons under investigation (PUI) for COVID-19: Algeria, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cameroon, Côte d’Ivoire, DRC, Egypt, Equatorial Guinea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritius, Morocco, Mozambique, Namibia, Nigeria, South Africa, Senegal, Seychelles, South Sudan, Sudan, Tunisia, Uganda, Zimbabwe. -

Outbreak Brief #5: Novel Coronavirus (COVID-19) Global Epidemic Date of Issue: 18 February 2020
Outbreak Brief #5: Novel Coronavirus (COVID-19) Global Epidemic Date of Issue: 18 February 2020 71,429 cases and 1,775 deaths Data sources: National Health Commission of the People's Republic of China, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and African Union Member States. Outbreak Update: Since the last brief, 28,321 new novel coronavirus (COVID-19) cases1 and 757 new deaths have been reported globally. Egypt reported its first COVID-19 case on 14 February 2020. The man was a 33 year old man of foreign origin with no signs of infection who tested positive for SARS-CoV-2 virus by PCR. Seventeen contacts of the man have been identified; all contacts currently report no symptoms, have tested negative for infection, and have been instructed to remain at home for 14 days. This is the first report of a laboratory confirmed case of COVID-19 in Africa. To date, 71,429 total COVID-19 confirmed cases, and 1,775 related deaths have been reported. Most cases (70,635; 99%) and deaths (1,772; 99%) have been reported from mainland China. Twenty-five different countries outside of China have reported 794 cases: Germany (16), Australia (15), Belgium (1), Cambodia (1), Canada (7), Egypt (1), Finland (1), France (12), India (3), Italy (3), Japan (59 mainland; 454 international conveyance), Thailand (35), Nepal (1), Malaysia (22), the Philippines (3), Russia (2), Singapore (75), South Korea (30), Spain (2), Sri Lanka (1), Sweden (1), United Arab Emirates (9), United Kingdom (9), the United States (15), and Vietnam (16). -

The Gambia After Elections: Implications for Governance and Security in West Africa Edrissa Sanyang and Sanna Camara
d Secur n ity a e S c e a r i e e s P FES Edrissa Sanyang and Sanna Camara The Gambia after Elections: Implications for Governance and Security in West Africa Edrissa Sanyang and Sanna Camara The Gambia after Elections: Implications for Governance and Security in West Africa About the Authors CONTENTS Edrissa SANYANG Edrissa S. Sanyang is a Gambian politician. Like many other Gambian citizens opposed to Jammeh, he had to flee the country in 1996 following the government takeover by the Jammeh Executive Summary 4 administration and lived ever since in the USA. He is a member of the government party UDP. Introduction 5 Following the positive outcome of the election process last December, he decided to move back to The Gambia to help to rebuilding the country after the departure of Jammeh. The Economy 6 Tourism 6 Sanna CAMARA Sanna Camara is a Gambian journalist living in exile since 2014. He has been a political and human The Historical Background 6 rights journalist in The Gambia since 2001. Sanna was a teaching assistant at Gambia Press Union The SeneGambia Confederation 6 School of Journalism; he is a member of the Pan African Bloggers League and Web Activists for Democracy (Africtivists). He is currently a freelance journalist, a contributing Writer to World Policy The Making of Jammeh 7 Journal’s African Angle; Africa editor for Democracy Watch News, and correspondent for Paris based Internet Sans Frontieres. Institutional Settings 8 Collective Security 9 Individual Freedoms 9 Arms Trafficking 9 Drugs 10 Governance 11 Term Limits 11 The Media 11 Elections 13 The Election Process 13 Electoral Procedures 13 Imprint Elections 2016 14 Friedrich-Ebert-Stiftung Peace and Security The Transitional Period 16 Centre of Competence Sub-Saharan Africa Point E, boulevard de l’Est, Villa n°30 The Implications of a Jammeh Victory 17 P.O. -

Outbreak Brief #6: Novel Coronavirus (COVID-19) Global Epidemic Date of Issue: 25 February 2020
Outbreak Brief #6: Novel Coronavirus (COVID-19) Global Epidemic Date of Issue: 25 February 2020 79,337 cases and 2,618 deaths Data sources: National Health Commission of the People's Republic of China, World Health Organization, European Centre for Disease Prevention and Control, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, and African Union Member States Outbreak Update: Since the last brief, 7,906 new novel coronavirus (COVID-19) cases1 and 843 new deaths have been reported globally. This includes seven new countries reporting cases (Afghanistan, Bahrain, Iran, Israel, Kuwait, and Lebanon, and Oman) and three new countries (Iran, Italy, and South Korea) reporting deaths for the first time. For the first time since the beginning of the outbreak, several countries outside of China are reporting a rapid increase in cases. Specifically, Iran, Italy, Japan, and South Korea reported that the number of cases doubled or tripled over the weekend. To date, 79,337 total COVID-19 confirmed cases, and 2,618 related deaths have been reported. Most cases (77,262; 98%) and deaths (2,595; 99%) have been reported from mainland China. Thirty-two different countries outside of China have reported 2,075 cases: Afghanistan(1), Australia (22), Bahrain (2), Belgium (1), Cambodia (1), Canada (9), Egypt (1), Finland (1), France (12), Germany (16), Iran (43), Israel (1), India (3), Italy (124), Japan (mainland: 144; international conveyance: 695), Kuwait (5), Lebanon (1), Malaysia (22), Nepal (1), Oman (1), the Philippines (3), Russia (2), Singapore (89), South Korea (763), Spain (2), Sri Lanka (1), Sweden (1), Thailand (35), United Arab Emirates (13), United Kingdom (9), the United States (35), and Vietnam (16). -

Historical Dictionary of the Gambia
HDGambiaOFFLITH.qxd 8/7/08 11:32 AM Page 1 AFRICA HISTORY HISTORICAL DICTIONARIES OF AFRICA, NO. 109 HUGHES & FOURTH EDITION PERFECT The Gambia achieved independence from Great Britain on 18 February 1965. Despite its small size and population, it was able to establish itself as a func- tioning parliamentary democracy, a status it retained for nearly 30 years. The Gambia thus avoided the common fate of other African countries, which soon fell under authoritarian single-party rule or experienced military coups. In addi- tion, its enviable political stability, together with modest economic success, enabled it to avoid remaining under British domination or being absorbed by its larger French-speaking neighbor, Senegal. It was also able to defeat an attempted coup d’état in July 1981, but, ironically, when other African states were returning to democratic government, Gambian democracy finally suc- Historical Dictionary of Dictionary Historical cumbed to a military coup on 22 July 1994. Since then, the democracy has not been restored, nor has the military successor government been able to meet the country’s economic and social needs. THE This fourth edition of Historical Dictionary of The Gambia—through its chronology, introductory essay, appendixes, map, bibliography, and hundreds FOURTH EDITION FOURTH of cross-referenced dictionary entries on important people, places, events, institutions, and significant political, economic, social, and cultural aspects— GAMBIA provides an important reference on this burgeoning African country. ARNOLD HUGHES is professor emeritus of African politics and former direc- tor of the Centre of West African Studies at the University of Birmingham, England. He is a leading authority on the political history of The Gambia, vis- iting the country more than 20 times since 1972 and authoring several books and numerous articles on Gambian politics. -
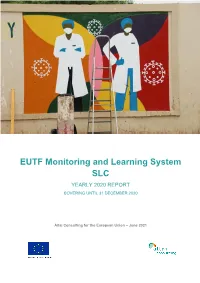
EUTF SLC 2020-S2 Report
E pense EUTF Monitoring and Learning System SLC YEARLY 2020 REPORT COVERING UNTIL 31 DECEMBER 2020 Altai Consulting for the European Union – June 2021 © European Union June 2021 Unless specified otherwise, all pictures in this report are credited to Altai Consulting. This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Altai Consulting and do not necessarily reflect the views of the European Union. Cover photo: © IOM, 2020, Daniel Kisito Kouawo – Niamey, Monica Chiriac – Agadez. ‘Since 2019, the International Organization for Migration (IOM) in West and Central Africa has been using street art as a key outreach activity based on “human-centred design” to engage with migrants and community members. In 2020, amidst the COVID-19 pandemic, IOM continues the initiative in Senegal, Ghana and Niger with the objective to improve relations between migrants and host communities, while stimulating the debate surrounding how to reduce the spread of misinformation and xenophobia, two particularly sensitive topics during COVID-19 times.’ ALTAI CONSULTING Altai Consulting provides research and monitoring & evaluation services to public institutions and international organisations in developing countries. Our teams operate in more than 50 countries in Africa, the Middle East and Central Asia. Since its inception 18 years ago, Altai Consulting has developed a strong focus on migration, governance and sustainable development related research and programme evaluations. Contact Details: Philibert de Mercey (Project Director): [email protected] Eric Davin (Altai Partner): [email protected] www.altaiconsulting.com MLS SLC S2 2020 REPORT Altai Consulting 2 June 2020 ACKNOWLEDGMENTS This report was prepared by Eric Davin, Justine Rubira, Philibert de Mercey, Garance Dauchy, Marie Faou, Sarah Akesbi, Solène Cros, Paul Olivier and Rim Wazni. -

Current Situation with Respect to Regional and Subregional Cooperation in Addressing and Countering the World Drug Problem
UNODC/HONLAF/30/3 7 August 2020 Original: English* Thirtieth Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Africa* Item 3 of the provisional agenda** Current situation with respect to regional and subregional cooperation in addressing and countering the world drug problem Current situation with respect to regional and subregional cooperation in addressing and countering drug trafficking Report of the Secretariat I. Introduction 1. This report provides an overview of the drug trafficking situation in the areas covered by United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) field offices in Africa, namely the Regional Office for West and Central Africa, the Regional Office for Eastern Africa, the Regional Office for the Middle East and North Africa, the Regional Office for Southern Africa and the country office in Nigeria, and the related efforts to address and counter the world drug problem in the period since the Twenty-ninth Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Africa, held in Balaclava, Mauritius, from 16 to 20 September 2019. 2. UNODC policies on and efforts in addressing drug matters in Africa are in line with the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular Sustainable Development Goal 16 (on promoting peace, providing access to justice for all and building effective, accountable and inclusive institutions at all levels), as well as Goal 3 (good health and well-being), Goal 10 (reducing inequalities within and among countries) and Goal 17 (strengthening the Global Partnership for Sustainable Development). All activities are undertaken under regional programmes, which act as frameworks for the implementation of projects. II.