Herwarth Walden (1878-1941)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Between Worlds Contents
BETWEEN WORLDS CONTENTS 14 Acknowledgments 16 Introduction Timothy 0. Benson and Eva Forgacs SECTION 1: STYLE AS THE CRUCIBLE OF PAST AND FUTURE Chapter 1: National Traditions Germany Carl Vinnen. "Quousque Tandem," from A Protest of German Artists [1911I Wilhelm Worringer, "The Historical Development of Modern Art," from The Struggle for Art (1911) Czech-Speaking Lands Milos Jiranek, "The Czechness of our Art," Radikatni iisty (1900I Bohumil Kubista, "Josef Manes Exhibition at the Topic Salon," Prehled ii9ii) Poland Juliusz Kaden-Bandrowski, "Wyspiariski as a Painter-Poet (Personal Impressions]," Przeglqd Poranny I1907] Stanistaw Witkiewicz, Excerpts from Jon Matejko (1908) Jacek Malczewski, "On the Artist's Calling and the Tasks of Art" I1912I Wtodzirnierz Zu-tawski, "Wyspiariski's Stained Glass Windows at the Wawel Cathedral," Maski (1918] Hungary Lajos Fulep, Excerpt from Hungarian Art I1916I Yugoslavia Exhibition Committee of University Youth (Belgrade], Invitation Letter (1904) Chapter 2: New Alternatives Prague Emil Filla, "Honore Daumier: A Few Notes on His Work," Volne smery (1910] Pavel Janak, "The Prism and the Pyramid" Umeiecky mesicnik (1911] Otto Gutfreund, "Surface and Space," Umeiecky mesicnik (1912) Emil Filla, "On the Virtue of Neo-Primitivism," Volne smery (1912) Vaclav Vilem Stech, Introduction to the second Skupina exhibition catalogue (1912) Bohumil Kubista, "The Intellectual Basis of Modern Time," Ceska kutturo I1912-13] Josef Capek, Fragments of correspondence I1913] Josef Capek, "The Beauty of Modern Visual Form," Printed [1913-14I Vlastislav Hofman, "The Spirit of Change in Visual Art," Almanoch no rok [1914) Budapest Gyb'rgy Lukacs, "Forms and the Soul," Excerpt from Richard Beer-Hoffmann 11910) Karoly Kernstok, "Investigative Art," Nyugat (1910) Gyorgy Lukacs, "The Ways Have Parted," Nyugat [1910) Karoly Kernstok, The Role of the Artist in Society," Huszadik szazad (1912) Bucharest Ion Minulescu, Fragment from "Light the Torches," Revisto celorlaiti (1908) N. -

OER STURM Oo PQ Os <Rh IRH ZEMIT A
De Styl 2x2 <rH IRH & Weimar Biflxelles OER STURM L'ESPRIT Berlin £ Wlan NOUVEAU 3 o CO a LA o .6 VIE o s £ D E Paris PQ S IU LETTRES DIE AKTION ET DES ARTS Paris ZEMIT Berlin Berlin InternaclonAIlt akllvlsta mQv^ssetl foly61rat • Sserkeutl: KattAk Uijof m Fe- leldssievkesxtO: Josef Kalmer • Sxerkesxtds^g £• klad6hlvafal: Wlen, XIIL Bei* Amallenstrasse 26. L 11 • Megjelen^s dAtuma 1922 oktdber 19 m EUfflrctM Ar: EOT £VRE: 3S.OOO osztr&k kor^ 70 ssokol, lOO dlnAr, 200 lei, SOO mArka m EQTE8 SZXM XltA: 3000 ositrAk korona, 7 siokol, lO dlnAr, 20 lei, SO mArka MA •b VIE 6vfolyam, 1. tx6m • A lapban megJelenO clkkek6rt a weriO felel. Drackerei .Elbemflfcl", Wien, IX., Berggtue 31. a sourcebook of central european avant-gardes, 1910-1930 CONTENTS 14 Acknowledgments 16 | Introduction Timothy 0. Benson and Eva Forgacs 49 Germany 50 Carl Vinnen, "Quousque Tandem," from A Protest of German Artists (1911) 52 Wilhelm Worringer, "The Historical Development of Modern Art," from The Struggle for Art (1911) 55 Czech-Speaking Lands 56 Milos Jiranek, "The Czechness of our Art," Radikalni tisty (1900) 57 Bohumil Kubista, "Josef Manes Exhibition at the Topic Salon," Prehled [1911) 59 Poland 60 ; Juliusz Kaden-Bandrowski, "Wyspianski as a Painter-Poet (Personal Impressions)," Przeglad Poranny (1907) 61 Stanistaw Witkiewicz, Excerpts from Jan Matejko (1908) 64 Jacek Malczewski, "On the Artist's Calling and the Tasks of Art" (1912) 66 Wiodzimierz Zutawski, "Wyspianski's Stained Glass Windows at the Wawel Cathedral," Maski (1918) 70 Hungary 71 ! Lajos Fulep, -

Museum – Digital: Die Präsentation Von Exponaten Aus Bibliotheken in Realen Und Digitalen Räumen Am Beispiel Des Sturm-Archivs
HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN INSTITUT FÜR BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSWISSENSCHAFT BERLINER HANDREICHUNGEN ZUR BIBLIOTHEKS- UND INFORMATIONSWISSENSCHAFT HEFT 367 BIBLIOTHEK – MUSEUM – DIGITAL: DIE PRÄSENTATION VON EXPONATEN AUS BIBLIOTHEKEN IN REALEN UND DIGITALEN RÄUMEN AM BEISPIEL DES STURM-ARCHIVS EINE VERGLEICHENDE STUDIE VON BERNHARD ANDERGASSEN BIBLIOTHEK – MUSEUM – DIGITAL: DIE PRÄSENTATION VON EXPONATEN AUS BIBLIOTHEKEN IN REALEN UND DIGITALEN RÄUMEN AM BEISPIEL DES STURM-ARCHIVS EINE VERGLEICHENDE STUDIE VON BERNHARD ANDERGASSEN Berliner Handreichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft Begründet von Peter Zahn Herausgegeben von Konrad Umlauf Humboldt-Universität zu Berlin Heft 367 Andergassen, Bernhard Bibliothek – Museum – Digital: Die Präsentation von Exponaten aus Bibliotheken in realen und digitalen Räumen am Beispiel des Sturm- Archivs : Eine vergleichende Studie / von Bernhard Andergassen. - Berlin : Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft der Humboldt- Universität zu Berlin, 2014. - 86 S. : graph. Darst. (Berliner Hand- reichungen zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft ; 367) ISSN 14 38-76 62 Abstract: In der Informationsgesellschaft ergeben sich neue Möglichkeiten biblio- thekarische Bestände in Ausstellungen zu präsentieren. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, inwieweit sich das STURM-ARCHIV, als bedeutender Kunst- und Literaturnachlass, dazu eignet, real und digital einem Publikum vorgestellt zu werden. Das Thema wird anhand von relevanten Quellen, Fachliteratur und Internetressourcen -

Avantgarde Und Geistesgegenwart. Okkultistische Erinnerungspraktiken Im Künstlerkreis Der Sturm
www.medienobservationen.de 1 Anne Lorenz Avantgarde und Geistesgegenwart. Okkultistische Erinnerungspraktiken im Künstlerkreis Der Sturm. Die Verbindungslinien zwischen Okkultismus und Avantgarde sind bereits vielfach nachgezeichnet worden, Beispiele sind Künstler wie Wassily Kandinsky, aber auch Alfred Döblin, die beide zum Sturm-Kreis gehörten. In welchem Verhältnis Herwarth Walden, der Leiter der avantgardistischen Künstlervereinigung, zu okkulten Praktiken und paranormalen Phänomenen tatsächlich stand, gleicht hingegen einem blinden Fleck. Ausgehend von einem Brief Döblins und den darin berichteten Wahrträumen Nell Waldens soll eine Spurensuche zeigen, inwieweit Walden vor dem Hintergrund seines Kunstideals und des ersten Weltkriegs eine Art spiritistisches Erinnerungsritual praktizierte. 1. Nell Waldens Traum Am 4. April 1918 schreibt Alfred Döblin an seinen Kunst- und Geschäftsfreund Herwarth Walden in einer Angelegenheit der anderen Art. Es geht nicht etwa um den Kunstbetrieb und um den Sturm, das Kunstunternehmen, das Herwarth Walden samt gleichnamiger Zeitschrift und Kunstgalerie leitete. Döblin erzählt auch nicht aus seinem Kriegsalltag, den er zu jener Zeit als Lazarettarzt in Hagenau verlebte. Vielmehr beschäftigen ihn die Wahrträume Nell Waldens, geborene Roslund, Malerin und Ehefrau des Kunstförderers und Wegbereiters der künstlerischen Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts. Die Hauptfigur in einem dieser wahrhaften Träume ist demnach der Dichter August Stramm und sein Tod an der Front – die hauptsächliche Handlung –, die sich erst im Nachhinein bewahrheiten sollte.1 Wie aus Döblins Brief hervorgeht, muss ihm Nell Walden in Berlin während eines Fronturlaubs von ihrem Traumerlebnis berichtet haben. Der für ihn insbesondere als Mediziner sensationelle Fall schien Döblin 1 August Stramm fiel am 1. September 1915 beim Angriff auf russische Stellungen am Dnepr-Bug-Kanal in der Nähe der Stadt Kobryn. -

Checklist of the Judith Rothschild Foundation Gift
Checklist of The Judith This checklist is a comprehensive ascertained through research. When a For books and journals, dimensions Inscriptions that are of particular his- record of The Judith Rothschild place of publication or the publisher given are for the largest page and, in torical or literary interest on individual Rothschild Foundation Gift Foundation gift to The Museum of was neither printed in the book nor cases where the page sizes vary by books are noted. Modern Art in 2001. The cataloguing identified through research, the des- more than 1/4,” they are designated Coordinated by Harper Montgomery system reflects museum practice in ignation “n.s” (not stated) is used. irregular (“irreg.”). For the Related The Credit line, Gift of The Judith under the direction of Deborah Wye. general and the priorities of The Similarly, an edition size is some- Material, single-sheet dimensions in Rothschild Foundation, pertains to all Museum of Modern Art’s Department times given as “unknown” if the print which the height or width varies from items on this checklist. To save space Researched and compiled by of Prints and Illustrated Books in par- run could not be verified. City names one end to the other by more than and avoid redundancy, this line does Jared Ash, Sienna Brown, Starr ticular. Unlike most bibliographies are given as they appear printed in 1/4” are similarly designated irregular. not appear in the individual entries. Figura, Raimond Livasgani, Harper and library catalogues, it focuses on each book; in different books the An additional credit may appear in Montgomery, Jennifer Roberts, artists rather than authors, and pays same city may be listed, for example, Medium descriptions (focusing on parentheses near the end of certain Carol Smith, Sarah Suzuki, and special attention to mediums that as Petersburg, St. -

Künstlerbriefe an Herwarth Walden
Künstlerbriefe an Herwarth 1932, Berlin (Nationalgalerie) 1961 Walden Sonia Delaunay Albert Bloch - Brief vom 25.7.1913, in: Briefe aus - Brief vom 18.3.1916, in: Ausst.kat: dem Sturm-Archiv. Begleitheft zur Der Sturm. Herwarth Walden und die Ausstellung “Avantgarde!” europäische Avantgarde Berlin 1912- 1932, Berlin (Nationalgalerie) 1961 - ‘Notiz ohne Datum’ (1916), in: Robert Delaunay Ausst.kat: Der Sturm. Herwarth Walden und die europäische - Brief aus dem Jahr 1913, in: Lionel Avantgarde Berlin 1912-1932, Berlin Richard (Hg.): Direction Berlin: (Nationalgalerie) 1961 Herwarth Walden et la revue Der Sturm. Brüssel 2008, S. 81ff. und in Briefe aus dem Sturm-Archiv. Umberto Boccioni Begleitheft zur Ausstellung “Avantgarde!” - Brief vom 8.5.1912, abgedruckt in: - Brief vom 20.3.1914, in: Richard, Ausst.kat: Der Sturm Herwarth Walden Direction Berlin, S.97, und in Briefe und die Europäische Avantgarde, aus dem Sturm-Archiv. Begleitheft zur Berlin 1912-1932, Berlin Ausstellung “Avantgarde!” (Nationalgalerie) 1961, S.30 und in: - Brief (?) vom 28.1.1913, in: Ausst.kat: Federica Rovati (Hg.): Umberto Der Sturm. Herwarth Walden und die Boccioni. Lettere futuriste, Rovereto europäische Avantgarde Berlin 1912- 2009, S.43 1932, Berlin (Nationalgalerie) 1961 - Brief vom November 1913, in: Federica Rovati (Hg.): Umberto Boccioni. Lettere futuriste, Rovereto Lyonel Feininger 2009, S. 99 - Brief vom 14.9.1917, in: Ausst.kat: Der Sturm Herwarth Walden und die Heinrich Campendonk Europäische Avantgarde, Berlin 1912- 1932, Berlin (Nationalgalerie) 1961, - Brief vom 18.1.1918, in: “Sehr S.52 und in Briefe aus dem Sturm- verehrter Herr Walden...”. Briefe aus Archiv. Begleitheft zur Ausstellung dem Sturm-Archiv. Begleitheft zur “Avantgarde!” Ausstellung “Avantgarde!”, Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Albert Gleizes Berlin, 2014 - Brief vom 9.8.1916, in: Ausst.kat: Der - Brief vom 30.4.1920, in: Ausst.kat: Sturm. -

Herwarth Walden. Ein Essayist Der Moderne
Moira Paleari Herwarth Walden. Ein Essayist der Moderne This article focuses on Walden’s essays as a clear indicator of his modernism and of his avant-garde position in German expressionism. The modern dimension of Walden’s works results on the one hand from his progressive understanding of art, literature and European cultural life, and on the other from his innovative impulses, demonstrated in the dialectical form of his essays, which avoid every closed theory and can be seen as a manifesto for experimental writing at the beginning of the twentieth century. I. Auf die Frage “Wer ist ‘Der Sturm’, der so verkannt wird und so erkennt?”, soll der Dichter August Stramm folgende Antwort gegeben haben: “Der Sturm ist Herwarth Walden”.1 Die Identifikation des Namens und des Wirkens Wal- dens mit der 1910 von ihm in Berlin gegründeten Zeitschrift Der Sturm ist auf seine außergewöhnliche Tätigkeit als Herausgeber, Publizist, Schriftstel- ler sowie Förderer junger Künstler und neuer Kunst zurückzuführen. Obwohl Walden solch eine herausragende Stellung innerhalb der expressionistischen Kultur innehatte, ging es ihm dennoch wie den meisten Expressionisten, die erst in den fünfziger Jahren wieder entdeckt wurden. Der Neudruck seines Periodikums Der Sturm erfolgte 1970,2 und monographische Studien darüber erschienen ebenso ab diesem Zeitpunkt.3 1 Lothar Schreyer: Zur Geschichte des Sturm. In: Herwarth Walden: Einblick in Kunst. Expressionismus Futurismus Kubismus. Berlin: Der Sturm 1924. S. 168. 2 Der Reprint der Zeitschrift Der Sturm erfolgte 1970 beim Verlag Nendeln/ Liechtenstein. Seit den späten sechziger Jahren erlaubten die Neudrucke expres- sionistischer Zeitschriften und Anthologien eine starke Expansion der Expres- sionismus-Forschung. -

Else Lasker-Schüler's Collaborative Avant Garde
Else Lasker-Schüler’s Collaborative Avant Garde: Text & Image in Berlin c. 1910 By Jennifer Cashman Ingalls A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Elaine Tennant (chair) Professor Chenxi Tang Professor John Efron Spring 2017 Else Lasker-Schüler’s Collaborative Avant Garde: Text & Image in Berlin c.1910 ©2017 Jennifer Cashman Ingalls Abstract Else Lasker-Schüler’s Collaborative Avant Garde: Text & Image in Berlin c. 1910 by Jennifer Cashman Ingalls Doctor of Philosophy in German University of California, Berkeley Professor Elaine Tennant, Chair Between 1910-1914, the German poet Else Lasker-Schüler formed her infamous alter ego, Prinz Jussuf von Theben, in her frequent publications in the expressionist periodicals Der Sturm and Die Aktion. The publishing opportunities in these periodicals allowed Lasker- Schüler the space to explore genre conventions and to begin including her own graphic art. Central to Lasker-Schüler’s creation of Prinz Jussuf and her increasing incorporation of visual art, were her unsuccessful and successful collaborations with Oskar Kokoschka and Franz Marc. The texts published in the two periodicals ranged from short theater, book, and art gallery reviews to her poetry and two epistolary novels. In Der Sturm, Lasker-Schüler serially published Briefe nach Norwegen, a series of letters written to her husband and Der Sturm editor Herwarth Walden on his two-week trip to Scandinavia. The letters were published over nine months and chronicle life in bohemian circles in Berlin, merging Lasker-Schüler’s emerging fantasy world into her artistic practice. -
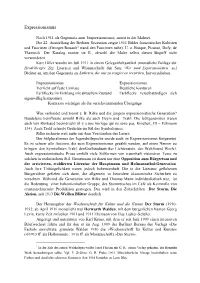
Expressionismus
Expressionismus Nach 1911 als Gegensatz zum Impressionismus, zuerst in der Malerei. Die 22. Ausstellung der Berliner Sezession zeigte 1911 Bilder französischer Kubisten 1 und Fauvisten (Georges Rouault stand den Fauvisten nahe). U. a. Braque, Picasso, Dufy, de Vlaminck. Der Katalog nannte sie E., obwohl die Maler selbst diesen Begriff nicht verwendeten. Kurt Hiller wandte im Juli 1911 in einem Gelegenheitsartikel (monatliche Beilage der Heidelberger Ztg. Literatur und Wissenschaft) den Satz ‘Wir sind Expressionisten´ auf Dichter an, um den Gegensatz zu Ästheten, die nur zu reagieren verstehen, hervorzuheben. Impressionismus Expressionismus Verzicht auf feste Umrisse Deutliche Konturen Farbflecke im Einklang mit aktuellem Zustand Farbflecke verselbständigen sich eigenwillig komponiert Kontraste wichtiger als die verschwimmenden Übergänge Was verbindet und trennt z. B. Rilke und die jüngere expressionistische Generation? Baudelaire beinflusste sowohl Rilke als auch Heym und Trakl. Die letztgenannten waren auch von Rimbaud beeindruckt (il y a une horloge qui ne sone pas, Kindheit, III – Fühmann 134). Auch Trakl schreibt Gedichte im Stil des Symbolismus. Rilke rechnete weit mehr mit dem Verständnis des Lesers. Der Stilpluralismus der Jugendstilepoche wurde auch im Expressionismus fortgesetzt. Es ist schwer alle Autoren, die zum Expressionismus gezählt werden, auf einen Nenner zu bringen: den Symbolisten Trakl, denGroßstadtsatiriker Lichtenstein, den Weltfreund Werfel. Auch expressionistische Prosa umfaßt viele Stilformen von traumhaft visionären -

Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter 6ce, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely afreet reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Ifigher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell & Howell Infonnation Compaoy 300 North Zeeb Road, Ann Arbor MI 48106-1346 USA 313/761-4700 800/521-0600 MODERNISM BETWEEN EAST AND WEST: THE HUNGARIAN JOURNAL MA (1916-1925) AND THE INTERNATIONAL AVANT-GARDE DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Marian Mazzone, B.A., M.A. -

9782390250739.Pdf
1912 - 1932 .) ed INGA INGA ( ROSSI-SCHRIMPF the new 7 MICHEL DRAGUET PREFACE 8 TIMELINE 1912 – 1932 15 INGA ROSSI-SCHRIMPF FROM ART NOUVEAU TO NEW OBJECTIVITY 33 HELMUTH KIESEL BERLIN FROM ITS EXPANSION INTO A WORLD-CLASS METROPOLIS UP TO THE EVE OF THE APOCALYPSE 43 BURCU DOGRAMACI NEW BERLINERS 53 JANINA NENTWIG REVOLUTION!? DADA, ARBEITSRAT FÜR KUNST AND NOVEMBER GRUPPE 63 MATTHIAS SCHIRREN MELTING POT OF MODERNITY 73 ANNE SÖLL VISIONS OF EQUALITY 83 SABINE T. KRIEBEL SUBJECTIVITY, PHOTOMONTAGE, AND MODERNITY 93 NICHOLAS BAER POST-PERSPECTIVAL AESTHETICS IN 'THE CABINET OF DR. CALIGARI' THE NEW BERLIN 1912 – 1932 101 I URBAN AVANT-GARDE & WAR 125 II REVOLUTION & UTOPIA 167 III BERLIN MYTH 217 IV CRISIS 239 APPENDICES CAT. 1 PAUL KLEE Mit dem Kometen (With the Comet), 1917 Watercolour on gypsum-based cotton gauze, Indian ink on cardboard; 24.5 × 22 cm Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels, inv. 11191 PREFACE On 11 November 1918, the armistice signed by the German delegation in Compiègne brings an official and definitive end to hostilities on the Western Front. For Belgium, this means liberation from just over four years of German occupation. The idea of creating a new world haunted young Germans—just as much as it did the young Belgian generation—and their eyes now turned toward Germany and its young capital, Berlin. The current exhibition, which is part of commemorations for the Great War, focuses more specifically on the period when the metropolis of Berlin was seen as a symbol for renewal, and on a post- war era where “everything seemed possible”. -

Albert Bloch and the Blue Rider the Munich Years
Albert Bloch and the Blue Rider The Munich Years Introduced by Frank Baron Photographs edited by Jon Blumb Lawrence, Kansas: Jayhawk Ink at the University of Kansas, 2014 Front cover illustration: detail of Häuserstudie Nr. 2, 1911. Back cover illustration: detail of Häuserstudie Nr. 1, 1911 ISBN 978-0-692-22260-7 Copyright@2014 by Frank Baron and Jon Blumb Table of Contents Preface vii Introduction 1 Record Book I 31 Record Book II 35 Black and White Figures 39 Color Plates 182 Appendix: Exhibitions 195 Index of Names 211 Index of Paintings 213 Preface On the one hand, this collection of Albert Bloch’s photographic “Record Books” represents, a unique chronicle of Bloch’s personal artistic career during a most active period. On the other hand, it indirectly reflects and documents the dramatic evolution of modern art in the early twentieth century. The “Record Books” provide a detailed log of paintings over the crucial decade of that development. Because of the age and crowded arrangement of Bloch’s photographs in the “Record Books,” it was necessary to reproduce the images individually. Decisions were based on tonality, contrast, and sharpness, to show these versions of vintage works in open tones and readable contrasts. This had to be done without altering the atmosphere and mood of the original art. Despite a wide range of problems with the prints pasted into the “Record Books,” the quality and detail of the original paintings is often amazingly clear and true. The sizes of the original photographs were maintained as closely as possible to give the impact Bloch intended in the original albums.