Gewässerentwicklungskonzept Aland
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
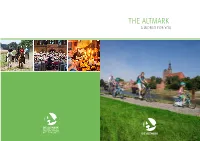
The Altmark. a World for You
THE ALTMARK A WORLD FOR YOU The Altmark – a world for you. Dear readers, Overview Active Map of the Altmark Washed with all waters | 20 Inside cover The Blue Belt in the Altmark Editorial | 01 Freedom now starts where it used to stop | 22 The Altmark – a world for you. The Green Belt – from deadly no man's land to paradise And if it were true …? | 02 Legends and truth in the Altmark tourist region The wonderful difficulty of having to decide | 24 Cycling in the Altmark Little Venice and the medieval beer rebels | 04 Towns and places in the Altmark On the film set of reality | 26 Magical hiking and riding in the Altmark Towns and places in the Altmark | 06 The Hanseatic League & contemporary witnesses of medieval prosperity DELIGHT The difference between liquid and solid gold | 28 Culture Beautiful views in Tangerhütte park Culinary specialities from the Altmark Where life blossoms eternally | 08 When the imperial couple enters Tangermünde … | 30 We would like to take you on a trip to the Altmark in the This brochure reveals to you all the variety the Altmark has Rich landscaped gardens and wide parks Folk festivals and Altmark gastronomy north of Saxony-Anhalt. On a journey into a world that to offer: so if you are looking for new inspiration for a city Scattered beauties | 10 is about the red bricks on the Romanesque Road, about trip, if you like hiking or cycling, if you enjoy concerts in Castles and manor houses in the Altmark magnificent Hanseatic towns and uniquely preserved nat- Romanesque churches, or if you are interested in history ural landscapes: in the glow of the sun, the blue of Arend- and want to walk in the footsteps of "Iron Chancellor" "See red" on the Romanesque Road | 12 The Altmark see Lake is dazzling and can be found in the Drömling Otto von Bismarck … then you will find exactly what you Churches, monasteries and the magic of bricks The Altmark's economy | 32 Biosphere Reserve in the diverse play of nature's colours. -

Antwort Der Landesregierung Auf Eine Kleine Anfrage Zur Schrift- Lichen Beantwortung
Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 6/1318 18.07.2012 Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift- lichen Beantwortung Abgeordneter Dietmar Weihrich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Klärung des Zustandes der Fließgewässer und des Standes der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union (WRRL) in Sachsen-Anhalt Kleine Anfrage - KA 6/7525 Vorbemerkung des Fragestellenden: Die WRRL schreibt eine Erreichung der in Art. 4 WRRL formulierten Umweltziele bis 2015 vor. Es gilt grundsätzlich das Verschlechterungsverbot für alle Gewässer. Wei- tergehend ist die Durchführung von Maßnahmen erforderlich, um einen guten ökolo- gischen und chemischen Zustand der Gewässer zu erreichen. Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Vorbemerkung Die Grundlage für die Beantwortung der Fragen zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bilden die ersten Bewirtschaftungspläne und Maß- nahmenprogramme der Flussgebietseinheiten Elbe und Weser vom 22.12.2009. Diese enthalten unter anderem Informationen und Daten zum chemischen und öko- logischen Zustand und zum ökologischen Potenzial, über die Ausweisung der künst- lichen und erheblich veränderten Wasserkörper, über die Inanspruchnahme von Fristverlängerungen oder weniger strengen Umweltzielen aller nach WRRL berichts- pflichtigen Gewässer. Zusätzlich sind diese Informationen im Gewässerrahmenkon- zept für das Land Sachsen-Anhalt, verfügbar unter www.saubereswasser.sachsen- anhalt.de, dargestellt. Hinweis: Die Drucksache steht vollständig -
Zur Verbreitung Des Fischotters (Lutra Lutra L., 1758) in Sachsen
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Hercynia Jahr/Year: 1999 Band/Volume: 32 Autor(en)/Author(s): Hauer Silke, Heidecke Dietrich Artikel/Article: Zur Verbreitung des Fischotters (Lutra lutra L., 1758) in Sachsen- Anhalt 149-160 ©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ISSN 0018-0637 Hercynia N. F. 32 (1999): 149- 160 149 Zur Verbreitung des Fischotters (Lutra lutra L., 1758) in Sachsen-Anhalt* Silke HAUER und Dietrich HElDECKE 3 Abbildungen und 3 Tabellen ABSTRACT HAUER, S.; HEIDECKE, D.: Distribution of the otter (Lutra lutra) in Sachsen-Anhalt.- Hercynia N. F. 32 (1999): 149-160. The otter is one of the most endangered mammal species in Europe. Decline of otter in Sachsen-Anhalt reached a maximum at the end of the seventies and beginning of the eighties. Little and only frag mented information on the distribution of otters during the last decade was present and no systematic survey has been done before. Based on information obtained by the inquiry of hunters and provided by people interested in nature as weil as by voluntary coworkers ofthe "Bezirksarbeitsgruppe Artenschutz" Magdeburg priority regions for the survey were selected. Otters are widely distributed in the north (Elbe-Havel-Winkel) and southeast (Eibe-Elster-Winkel) closely connected to viable populations in Brandenburg. At most big rivers in Sachsen-Anhalt and especially all along the river Eibe otter-signs were noticeable. River Eibe equally connects local patches of otter occurrence as weil as populations at a supra-regional Ievel. Comparing the actual distribution of otters with older data a re-colonisation of earlier settled areas can be ascertained. -

Altmarkkreis Salzwedel) 55-57 Mitt
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen zur floristischen Kartierung in Sachsen-Anhalt Jahr/Year: 2018 Band/Volume: 23 Autor(en)/Author(s): Hartenauer Katrin Artikel/Article: Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze bei Hagenau (Altmarkkreis Salzwedel) 55-57 Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle 2018)23 : 55–57 55 Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze bei Hagenau (Altmarkkreis Salzwedel) Katrin Hartenauer Zusammenfassung Hartenauer, K. (2018): Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze bei Hagenau (Altmark- kreis Salzwedel). – Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle) 23: 55–57. Es wird vom Vor- kommen der Seekanne bei Hagenau berichtet sowie ein Überblick über die aktuellen Verbrei- tungsschwerpunkte der Art in Sachsen-Anhalt gegeben. Abstract Hartenauer, K. (2018): Occurrence of Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze near Hagenau (rural district Salzwedel). – Mitt. florist. Kart. Sachsen-Anhalt (Halle) 23: 55–57. It is reported about a stand of Nymphoides peltata near Hagenau. A survey about the present distribution of the species in Saxony-Anhalt is additionally given. Im Zuge einer privaten Exkursion am 09.09.2018 an die Biese fiel in Hagenau ein Graben durch seine reiche Wasser- und Schwimmblattvegetation auf. Der Graben verläuft unmittel- bar östlich der Dorfstraße in Richtung Biesenthal. Er befindet sich nördlich der Biese und hat vermutlich einen verrohrten Abfluss zu dieser. Östlich des Grabens befindet sich Grün- land, welches als Pferdeweide genutzt wird. Der Graben ist vergleichsweise breit und tief. Trotz der anhaltenden Trockenheit im Jahr 2018 zeigte er kein Wasserdefizit. Die Wasser- und Schwimmblattvegetation füllte den Wasserkörper vollständig aus, wobei Hydrocharis morsus- ranae und Elodea canadensis dominierten. -

MEL05 – Milde-Biese-Aland
3.2.3.6 MEL05 – Milde-Biese-Aland Gebietsbeschreibung Der Betrachtungsraum „MEL05 – Milde-Biese-Aland“ liegt im Norden des Bundeslandes. Auf einer Fläche von 1.908 km² (BR liegt vollständig im Land Sachsen-Anhalt) leben 115.500 Einwohner. Das Gebiet ist zu 17% von Wald bedeckt, 60% der Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. Auf diesen Flächen gibt es einen potentiellen Sedimenteintrag von 1.200 t/a in die Gewässer, ohne Hotspot von mindestens 20 t/a. Im Betrachtungsraum leiten 17 kommunale Kläranlagen ihr gereinigtes Abwasser in die Gewässer ein, davon haben 6 die Größenklasse 3 oder größer (≥ 5.000 EGW). Weiterhin gibt es 10 industrielle und gewerbliche Direkteinleiter. Gewässerübersicht Sachsen-Anhalt hat Anteile an 29 Oberflächenwasserkörpern des Betrachtungsraumes, für die es alle zuständig ist. Insgesamt haben die WRRL-relevanten Fließgewässer auf dem Landesgebiet eine Länge von 727 km. Diese Gewässer gliedern sich wie folgt: (Elbe) ─────── Aland ├─────────── Augraben Krüden ├─────────── Elbgraben ├─────────── Elbdeichwässerung ├─────────── Landwerdergraben Seehausen ├─────── Tauber Aland Biese ├───────── Bruchgraben Behrend ├─────── Große Wässerung │ ├─── Westwässerung │ │ ─── Herzgraben Behrendorf │ Sandauerholz Polder ├───────── Kalandsgraben ├────── Seegraben Iden │ ├─── Beverlake │ │ │ │ │ Beverlake Busch │ ─── Wolterslager Straßengraben ├──────────────── Landgraben Dobbrun ├─────── Cositte │ ├─── Calberwischer Wässerung │ ├─── Hufergraben │ Balsamgraben │ ─── Beelitzer Balsam ├─── Uchte │ ├─── Schaugraben │ ├─────── Rhingraben -

Gewässerentwicklungskonzept „Milde/Biese“
GEWÄSSERENTWICKLUNGSKONZEPT „MILDE/BIESE“ IM AUFTRAG DES LANDESBETRIEB FÜR HOCHWASSERSCHUTZ UND WASSERWIRTSCHAFT SACHSEN-ANHALT (2014) AUFTRAGNEHMER: biota – INSTITUT FÜR ÖKOLOGISCHE FORSCHUNG UND PLANUNG GMBH GESCHÄFTSFÜHRER: DR. RER. NAT. DR. AGR. DIETMAR MEHL SITZ: 18246 BÜTZOW, NEBELRING 15 DR. RER. NAT. VOLKER THIELE TELEFON: 038461 / 9167-0 UST.-ID.-NR. (VAT-NUMBER): DE 164789073 TELEFAX: 038461 / 9167-50 ODER -55 STEUERNUMMER (FA GÜSTROW): 086 / 106 / 02690 E-MAIL: [email protected] HANDELSREGISTER: AMTSGERICHT ROSTOCK HRB 5562 INTERNET: WWW.INSTITUT-BIOTA.DE B ANKVERBINDUNGEN: COMMERZBANK AG VOLKS- UND RAIFFEISENBANK GÜSTROW E.G. IBAN: DE79130400000114422900 IBAN: DE38140613080000779750 BIC: COBADEFFXXX BIC: GENODEF1GUE Gewässerentwicklungskonzept Milde/Biese Auftragnehmer: Auftraggeber: Dipl.-Geogr. Thomas Munkelberg Dipl.-Biol. Friedemann Gohr Dipl.-Ing. (FH) Daniela Krauß Dipl.-Ing. Martina Renner Dipl.-Geogr. Christian Gottelt Dipl.-Ing. Klaudia Lüdecke Dipl.-Ing. Manja Schott Dr. rer. nat. Dr. agr. Dietmar Mehl biota – Institut für ökologische Forschung LHW - Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Planung GmbH und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt Nebelring 15 Otto-von-Guericke-Str. 5 18246 Bützow 39104 Magdeburg Telefon: 038461/9167-0 Telefax: 038461/9167-55 E-Mail: [email protected] Internet: www.institut-biota.de _______________________________ Nachauftragnehmer: Dipl.-Ing. Holger Ellmann Dr. agr. Burkhard Schulze Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und Was- serwirtschaft - Ellmann & Schulze GbR Hauptstraße 31 16845 Sieversdorf Telefon: 033970/13954 Telefax: 033970/13955 E-Mail: [email protected] Internet: www.ellmann-schulze.de Vertragliche Grundlage: Vertrags-Nr. 12/N/388/MD/p2-se/bie.fI0#gek vom 25.03.2013 Bützow, den 25.08.2014 Dr. rer. nat. Dr. agr. Dietmar Mehl Geschäftsführer 1 Gewässerentwicklungskonzept Milde/Biese INHALTSVERZEICHNIS 0 Veranlassung und Aufgabenstellung ........................................................................... -

Lesefassung Der Satzung Zur Umlage Der Verbandsbeiträge Der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese Und Uchte
Lesefassung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte Die Lesefassung berücksichtigt: - die Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 17.11.2016; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 12/2016 vom 26.11.2016 und auf der Internetseite www.osterburg.de abrufbar - die 2. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 30.08.2018; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 11/2018 vom 29.09.2018 und auf der Internetseite www.osterburg.de abrufbar Die Lesefassung berücksichtigt nicht: - die 1. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 10.08.2017; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr.10 /2017 vom 26.08.2017, da diese 1. Änderungssatzung nur die Umlagesätze zur Umlage des Flächen-und Erschwernisbeitrages für das Kalenderjahr 2017 regelte und mit 2. Änderungssatzung außer Kraft gesetzt wurde Hinweise zur Lesefassung: Die vorliegende Form der Lesefassung ist kein amtlicher Text, sie dient der Information und erhebt keinen Anspruch auf Rechtswirksamkeit. Die amtliche Fassung der Satzung enthält lt. § 1 der Bekanntmachungssatzung der Hansestadt Osterburg (Altmark) vom 01.07.2014, nur die Papierausgabe des „Mitteilungs-und Amtsblattes für die Hansestadt Osterburg (Altmark)“. __________________________________________________________________ § 1 Allgemeines (1) Die Hansestadt Osterburg (Altmark) ist gemäß § 54 Abs. 3 WG LSA gesetzliches Mitglied in den Unterhaltungsverbänden Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte. (2) Die Gemeinden, die Mitglied der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte sind, haben auf Grundlage des § 28 Abs. -

Lesefassung Der Satzung Zur Umlage Der Verbandsbeiträge Der
Stand: 06/2021 Lesefassung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte Die Lesefassung berücksichtigt: - die Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 17.11.2016; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 12/2016 vom 26.11.2016 und auf der Internetseite www.osterburg.de abrufbar - die 2. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 30.08.2018; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 11/2018 vom 29.09.2018 und auf der Internetseite www.osterburg.de abrufbar - die 4. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 31.03.2020; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. 6/2020 vom 30.05.2020 und auf der Internetseite www.osterburg.de abrufbar - die 5. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 25.05.2021; bekannt gemacht durch Veröffentlichung auf der Internetseite https://www.osterburg.de/verwaltung-politik/amtliche-bekanntmachungen/ Rubrik Finanzen, Steuern und Abgaben (bereitgestellt am 11.06.2021) Die Lesefassung berücksichtigt nicht: - die 1. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 10.08.2017; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr.10 /2017 vom 26.08.2017, da diese 1. Änderungssatzung nur die Umlagesätze zur Umlage des Flächen-und Erschwernisbeitrages für das Kalenderjahr 2017 regelte und mit 2. Änderungssatzung außer Kraft gesetzt wurde - die 3. Änderungssatzung der Satzung zur Umlage der Verbandsbeiträge der Unterhaltungsverbände Seege/Aland, Milde/Biese und Uchte vom 03.09.2019; bekannt gemacht durch Veröffentlichung im Amtsblatt Nr. -

2. Landschaftsraum
2. Landschaftsraum Zusammenfassung Charakteristik der Landschaftseinheiten Böden im LK SDL Gewässer im LK SDL UNESCO-Biosphärenreservat Mittelelbe Schutzgebiete Natura 2000 – FFH Schutzgebiete Natura 2000 - Vogelschutzgebiete Großschutzgebiete Naturschutzgebiete Landschaftsschutzgebiete Landschaftsplanung im Landkreis Stendal SWOT-Analyse Landschaftsraum - Zusammenfassung - Der Landkreis Stendal wird überwiegend durch landwirtschaftlich geprägte Offenlandschaften der Altmarkplatten und Flussniederungen geprägt. - Wesentliche Fließgewässer sind dabei die Elbe und die Havel im östlichen Bereich des Landkreises. - Der Boden charakterisiert sich durch einen kleinteiligen Wechsel von sandigen und lehmigen Substrattypen und schwankt in seiner Fruchtbarkeit. - der Anteil streng geschützter Gebiete des Naturschutzes liegt im Landkreis bei 4,3 %; dieser Werte entspricht dem Bundesdurchschnitt - Insgesamt sind im Landkreis Stendal etwa 38 % der Kreisfläche von Ausweisungen im Rahmen von Natura 2000, Schutzgebieten nach Landesrecht sowie des gesamten Gebietes des Biosphärenreservates betroffen - das Biosphärenreservat ‚Mittelelbe‘ ist wegen seiner gewollten Bedeutung als Modellregion von Weltrang besonders zu erwähnen. Es umfasst eine Fläche von 49.114 ha und ist eines der von der UNESCO zertifizierten, größten Biosphärenreservate Europas. Der Großteil der Fläche dient dabei als Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsraum für den Menschen. 2. Landschaftsraum 2 Charakteristik der Landschaftseinheiten - Über den Landkreis Stendal erstrecken sich 9 unterschiedliche -

Milde-Biese-Aland Quellenkritische Überlegungen Zu Den Namen Eines Altmärkischen Flusssystems Michael Belitz
Milde-Biese-Aland Quellenkritische Überlegungen zu den Namen eines altmärkischen Flusssystems Michael Belitz 1. Einleitung Bei der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Herkunft und der Bedeu- tung von Gewässernamen ist der Forscher stets auf historische Zeugnisse ange- wiesen. Die frühesten, schriftlich fixierten und damit fassbaren Belege für Gewässernamen gehen dabei oftmals auf mittelalterliche Textzeugen – Chro- niken, Annalen, Urkunden – zurück. Vor allem für die kleineren, den antiken Autoren noch nicht bekannten Gewässer trifft dies zu. Bei der Erwähnung von Naturereignissen, der Beschreibung von Regionen und Grenzen ebenso wie in Schenkungsurkunden, in denen sie häufig als Bestandteil von Ortsna- men zu finden sind, finden Gewässernamen häufig ihre erste Erwähnung. Bei der Beschäftigung mit diesen Dokumenten ist es daher notwendig, sich bewusst zu machen, dass diese hinsichtlich ihrer Überlieferung und ihres Inhalts kritisch zu prüfen sind. Auch wenn es um die etymologische Deutung von Gewässernamen geht, ist dies von Bedeutung, um bei der Beschäftigung mit der Herkunft und Bedeutung der Namen von sicheren und zeitlich korrekt eingeordneten Belegen auszugehen. Auf Grundlage des Deutschen Gewässernamenbuchs, das eine „[…] Dar- stellung der Ergebnisse der auf die deutschsprachige Hydronymie bezogenen etymologischen Forschungen“ (Greule 2014: 7) anstrebt, soll anhand eines ausgewählten Flusssystems eine kritische Überprüfung der Belegstellen und damit einhergehend auch ihrer Verwendung in der Fachliteratur stattfinden. Als Beispiel für diese Betrachtungen aus einer vor allem geschichtswissen- schaftlichen Perspektive wurde das altmärkische Flusssystem Milde-Biese- Aland gewählt, welches zunächst in seiner geographischen Lage beschrieben wird. Anschließend soll jede Belegstelle kritisch geprüft werden: Welche Besonderheiten weist die Überlieferungslage des Dokumentes auf, in welchem Namenkundliche Informationen / NI 105/106 (2015), S. -

Umweltbericht Zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck
Umweltbericht zum Flächennutzungsplan Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck Stand: 23.02.2021 AUFTRAGGEBER AUFTRAGNEHMER VERBANDSGEMEINDE ARNEBURG-GOLDBECK BRUCKBAUER & HENNEN GMBH FB Gemeindeentwicklung/ Bürgerdienste Schillerstraße 45 An der Zuckerfabrik 1 14913 Jüterbog 39596 Goldbeck TEL.: 03372 433233, FAX: 03372 433245 TEL.: 039321 51840, FAX: 039321 51818 MAIL: [email protected] MAIL: [email protected] www.bruckbauer-hennen.de www.arneburg-goldbeck.de Vorentwurf (inkl. Begründung, Umweltbericht und Plan) verfasst von Stadt und Land Planungsgesellschaft mbH, Hohenberg-Krusemark UMWELTBERICHT ZUM FNP - VERBGEM ARNEBURG-GOLDBECK _____________________________________________________________________________________________________ Inhalt 1 Einleitung ......................................................................................................................................... 4 2 Inhalt und Ziele der Aufstellung des Flächennutzungsplanes ......................................................... 6 2.1 Inhalt, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben ........... 6 2.1.1 Siedlungsflächen (Wohnbauflächen und gemischte Bauflächen) ................................... 9 2.1.2 Gewerbliche Bauflächen ................................................................................................ 10 2.1.3 Sonderbauflächen ......................................................................................................... 10 2.2 Lage und Kurzcharakteristik der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck -

Das Naturschutzgebiet Aland-Elbe- Niederung – Ausweisung Eines NSG Zur Umsetzung Der Ziele Von NATURA 2000
Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt 47. Jahrgang • 2010 • Sonderheft Das Naturschutzgebiet Aland-Elbe- Niederung – Ausweisung eines NSG zur Umsetzung der Ziele von NATURA 2000 1 Einführung der wildlebenden Vogelarten) sowie Art .4, Abs .4 der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom Christiane Röper 21 . Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens- räume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen) . Die EU verabschiedete am 21 .Mai 1992 die Richtlinie Bei den Vogelschutzgebieten ist zu beachten, dass zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie deren Erklärung zum besonderen Schutzgebiet den der wildlebenden Tiere und Pflanzen, die sogenann- Regimewechsel gemäß Art .7 der FFH-Richtlinie aus- te Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) . löst und damit überhaupt erst die Anwendung der Die Mitgliedsstaaten sind seitdem verpflichtet, ein Ausnahmeregelungen gemäß Art . 6, Abs . 4 der FFH- europaweites Netz von besonderen Schutzgebie- Richtlinie ermöglicht . Bis dahin gilt in Vogelschutz- ten zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zur gebieten ein generelles Verschlechterungsverbot . Förderung einer nachhaltigen Entwicklung aufzu- Gemäß Art . 4, Abs . 4 der FFH-Richtlinie legt der bauen . In dieses Natura 2000 genannte Netz sind Mitgliedsstaat bei der Ausweisung der besonderen auch die auf der Grundlage der seit 1979 geltenden Schutzgebiete die Prioritäten für die Wahrung oder EU-Vogelschutzrichtlinie gemeldeten Europäischen Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungs- Vogelschutzgebiete (EU SPA) integriert . zustandes der Lebensraumtypen und Arten sowie Die reichhaltige Naturausstattung Sachsen-Anhalts für die Kohärenz des Netzes Natura 2000 fest . Bei ermöglichte die Auswahl von 265 FFH-Gebieten der Erarbeitung einer Schutzgebietsverordnung zur und 32 Vogelschutzgebieten (EU SPA) . Damit ent- Umsetzung der Anforderungen von Natura 2000 fallen aktuell 179 729.