Diplomarbeit
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Licht Ins Dunkel“
O R F – J a h r e s b e r i c h t 2 0 1 3 Gemäß § 7 ORF-Gesetz März 2014 Inhalt INHALT 1. Einleitung ....................................................................................................................................... 7 1.1 Grundlagen........................................................................................................................... 7 1.2 Das Berichtsjahr 2013 ......................................................................................................... 8 2. Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags.................................................................. 15 2.1 Radio ................................................................................................................................... 15 2.1.1 Österreich 1 ............................................................................................................................ 16 2.1.2 Hitradio Ö3 ............................................................................................................................. 21 2.1.3 FM4 ........................................................................................................................................ 24 2.1.4 ORF-Regionalradios allgemein ............................................................................................... 26 2.1.5 Radio Burgenland ................................................................................................................... 27 2.1.6 Radio Kärnten ........................................................................................................................ -

The Secret of the Musikverein and Other Shoebox Concert Halls
Proceedings of the Institute of Acoustics THE SECRET OF THE MUSIKVEREIN AND OTHER SHOEBOX CONCERT HALLS T Lokki Aalto University School of Science, Department of Computer Science, Finland J Pätynen Aalto University School of Science, Department of Computer Science, Finland S Tervo Aalto University School of Science, Department of Computer Science, Finland A Kuusinen Aalto University School of Science, Department of Computer Science, Finland H Tahvanainen Aalto University School of Science, Department of Computer Science, Finland A Haapaniemi Aalto University School of Science, Department of Computer Science, Finland 1 INTRODUCTION AND MOTIVATION The Musikvereinssaal in Vienna is indisputably one of the most admired concert halls in the world. Even those who prefer defined and clear sound to overwhelming enveloping reverberation praise the acoustics of the Musikverein. Researchers have studied the acoustics of this golden hall, mostly by the objective measures, but still the superior acoustics remains unexplained. General consensus among acousticians seems to be that numerous strong early lateral reflections, high ceiling, and bright en- veloping reverberation are the keys to the success. Here, we aim to explain the acoustics of shoebox concert halls, including the Musikverein, with the measurements of spatial impulse responses. More- over, we propose to shift the research focus in concert hall acoustics from traditional energy decay based parameters towards aspects on how acoustics can support music and make it more enjoyable. Although the Musikverein provides strong sensations for any listeners not all people like its overwhelm- ing reverberation in blind listening. We have recently conducted a large listening test 8 that included preference judgements between six concert halls on three different seats with two different signals. -

Grosser Saal Klangwolke Brucknerhaus Präsentiert Von Der Linz Ag Linz
ZWISCHEN CREDO Vollendeter Genuss TRADITION BEKENNTNIS braucht ein & GLAUBE perfektes MODERNE Zusammenspiel RELIGION Als führendes Energie- und Infrastrukturunternehmen im oberösterreichischen Zentralraum sind wir ein starker Partner für Wirtschaft, Kunst und Kultur und die Menschen in der Region. Die LINZ AG wünscht allen Besucherinnen und Besuchern beste Unterhaltung. bezahlte Anzeige LINZ AG_Brucknerfest 190x245.indd 1 02.05.18 10:32 6 Vorworte 12 Saison 2018/19 16 Abos 2018/19 22 Das Große Abonnement 32 Sonntagsmatineen 44 Internationale Orchester 50 Bruckner Orchester Linz 56 Kost-Proben 60 Das besondere Konzert 66 Oratorien 128 Hier & Jetzt 72 Chorkonzerte 134 Moderierte Foyer-Konzerte INHALTS- 78 Liederabende 138 Musikalischer Adventkalender 84 Streichquartette 146 BrucknerBeats 90 Kammermusik 150 Russische Dienstage 96 Stars von morgen 154 Musik der Völker 102 Klavierrecitals 160 Jazz VERZEICHNIS 108 Orgelkonzerte 168 Jazzbrunch 114 Orgelmusik zur Teatime 172 Gemischter Satz 118 WortKlang 176 Kinder.Jugend 124 Ars Antiqua Austria 196 Serenaden 204 Kooperationen 216 Kalendarium 236 Saalpläne 242 Karten & Service 4 5 Linz hat sich schon längst als interessanter heimischen, aber auch internationalen Künst- Der Veröffentlichung des neuen Saisonpro- Musik wird heutzutage bevorzugt über diverse und innovativer Kulturstandort auch auf in- lerinnen und Künstlern es ermöglichen, ihr gramms des Brucknerhauses Linz sehen Medien, vom Radio bis zum Internet, gehört. ternationaler Ebene Anerkennung verschafft. Potenzial abzurufen und sich zu entfalten. Für unzählige Kulturinteressierte jedes Jahr er- Dennoch hat die klassische Form des Konzerts Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war alle Kulturinteressierten jeglichen Alters bietet wartungsvoll entgegen. Heuer dürfte die nichts von ihrer Attraktivität eingebüßt. Denn bislang auf jeden Fall die Errichtung des Bruck- das ausgewogene und abwechslungsreiche Spannung besonders groß sein, weil es die das Live-Erlebnis bleibt einzigartig – dank der nerhauses Linz. -

Art & History of Vienna
Art & History of Vienna Satoko Friedl Outline History Architecture Museums Music Eat & Drink Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 2 History Architecture Museums Music Eat & Drink Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 3 "It all started with a big bang…" Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 4 Prehistoric Vienna . Sporadic archeological finds from Paleolithic age . Evidence of continuous settlements from Neolithic age (~5000 BC) Venus of Willendorf (~25000 BC, Naturhistorisches Museum) Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 5 Vindobona: The Roman Fortress . Founded ~20 AD (after today‘s Austria was conquered) . "Standard" layout Roman military camp (castrum) surrounded by civilian city . Several excavation sites and archeological finds Reconstruction of Vindobona Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 6 Roman Excavations in Vienna (1) Roman floor heating (Excavations in Römermuseum, Hoher Markt) Roman stones from the thermae (Sterngasse/Herzlstiege) Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 7 Roman Excavations in Vienna (2) Roman and medieval houses (Michaelerplatz) Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 8 Location of the Roman Fortress (1) . Upper edge was washed away by a flood in 3rd century Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 9 Location of the Roman Fortress (2) Street called "Tiefer Danube Graben" canal (deep moat) Rotenturm- strasse Place called "Graben" (moat) St. Stephen‘s Cathedral Tiefer Graben(modern city center) Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 10 Old Friends… Is it worth the long travel? Obelix, shall we go to Vindobona? Satoko Friedl: Art & History of Vienna 26 September 2011 11 The Dark Ages . -

Programmvorschau · Preview Juni / June 2020
PROGRAMMVORSCHAU / PREVIEW 6/2020 STAND / LAST UPDATE: 16.1.2020 PROGRAMMVORSCHAU · PREVIEW JUNI / JUNE 2020 Oper, Operette, Musical · Opera, Operetta, Musical Staatsoper Volksoper Ronacher Tickets: www.wiener-staatsoper.at, Tickets: www.volksoper.at, „Cats“, Musical von A.L.Webber / www.culturall.com www.culturall.com Di, Mi 18.30, Do, Fr 19.30, Information Tel. +43 1 514 44 2250 Information Tel. +43 1 514 44 3670 Sa 15.00 & 19.30, So 14.00 / 1.6. Le nozze di Figaro von 1.6. Zar und Zimmermann von Tue, Wed 6.30 pm, Thu, Fri 7.30 pm, W. A. Mozart A. Lortzing Sat 3.00 & 7.30 pm, Sun 2.00 pm 3.6. Solistenkonzert: Ildar Abdrazakov, 2.6. Kiss me, Kate, Musical von C. Porter (ausser / except 11.6.) Rolando Villazón 3.6. Louie‘s Cage Percussion: Characters Tickets: www.wien-ticket.at 4.6. Lucia di Lammermoor von 4.6. Die Csárdásfürstin von E. Kálmán Kreditkarte/creditcard: Tel. +43 1 58885 G. Donizetti 5.6. Ballettpremiere: Appassionato – www.musicalvienna.at 5.6. Le nozze di Figaro Bach und Vivaldi (Nebyla / Peci / 6.6. Ballett: Sylvia (Legris nach Mérante Winter) u.a. – Delibes) 6.6. Zar und Zimmermann Theater an der Wien 7.6. Lucia di Lammermoor 7.6. Ballett: Appassionato – Bach und 6., Linke Wienzeile 6 9.6. Aida von G. Verdi Vivaldi 28., 30.6. um 19.00, 29.6. um 11.00 10.6. Ballett: Sylvia 8.6. Kiss me, Kate „Neun x Leben“ , Jugendoper, 11.6. Lucia di Lammermoor 9.6. Ballett: Coppélia (Lacotte – Delibes) Musiktheater zu Beethoven 12.6. -

Itinerary for Spring 2018 Vienna FSP.Pdf
VIENNA MUSIC FSP ’18, Itinerary Guest Lectures: Dennis Russel Davis, Conductor, “Arts in Europe” and the rehearsal with Student Orchestra of Bruckner Universitäte, Linz, Austria; Miguel Kertsman, Composer, “Composition and Education”; Deridre Brenner, Pianist and Dartmouth Alum “Career in Vienna”; Dr. Morten Solvik, Musicologist, “Mahler Symphony No. 1” Orchesta/Ensembles: Berlin Philharmonics, Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Cleveland Orchestra, Philadelphia Orchestra, Budapest Festival Orchestra, Berlin State Opera Orchestra, Berlin Baroque Soloists, Vienna Philharmonics, Vienna Symphonic, Tonkunstler Orchestra, Alban Berg Ensemble, Wave Percussion Quartet, Hagen Quartet Notable Conductors and Soloists: Martha Argerich, Yujia Wang, Danilli Trifonov, Igor Levit, Maestro Daniel Barenboim, Dennis Russel Davis, Daniele Gatti, Yannick Nézet-Séguin, Ivan Fischer, Percussionist Christoph Sietzen Concert Halls, Opera Houses, Jazz Club, Small Venues, Churches: Wiener Musikverein, Konzerthaus, Staatsoper, Volksoper, Theatre an der Wien, Karlskirche, Mosaïque Wien, Porgy and Bess, Haus der Musik, Haus of Beethoven, Kunst Bedivere, Linz’s New Music Theatre, Bruckner Univierstäte, Ars Electronica Center, St. Florian Abbey, Prague’s Estates Theatre and Brno’s Basilica of the Assumption of Our Lady Composers: Haydn, Mozart, Bach, Beethoven, Schuman, Schubert, Chopin, Edgard, Brahms, Berlioz, Bruckner, Tchaikovsky, Sibelius, Debussy, Mahler, Verdi, Puccini, Richard Struss, Johann Struss, Wagner, Janáček, Dvorak, Schonberg, -

Art & History of Vienna
Art & History of Vienna Markus Friedl (HEPHY Vienna) Outline History Architecture Museums Music Eat & Drink Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 2 Outline History Architecture Museums Music Eat & Drink Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 3 "It all started with a big bang…" Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 4 Prehistoric Vienna . Sporadic archeological finds from Paleolithic age . Evidence of continuous settlements from Neolithic age (~5000 BC) Venus of Willendorf (~27500 BC, Naturhistorisches Museum) Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 5 Vindobona: The Roman Fortress . Founded ~20 AD (after today‘s Austria was conquered) . "Standard" layout Roman military camp (castrum) surrounded by civilian city . Several excavation sites and archeological finds Reconstruction of Vindobona Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 6 Roman Excavations in Vienna (1) Roman floor heating (Excavations in Römermuseum, Hoher Markt) Roman stones from the thermae (Sterngasse/Herzlstiege) Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 7 Roman Excavations in Vienna (2) Roman and medieval houses (Michaelerplatz) Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 8 Location of the Roman Fortress (1) . Upper edge was washed away by a flood in 3rd century Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 9 Location of the Roman Fortress (2) Street called "Tiefer Danube Graben" canal (deep moat) Rotenturm- strasse Place called "Graben" (moat) St. Stephen‘s Cathedral Tiefer Graben(modern city center) Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 10 The First Vienna Conference… Markus Friedl: Art & History of Vienna 18 February 2019 11 The Dark Ages . -

18 July, 2021 the International Summer Academy Offers
INTERNATIONAL SUMMER ACADEMY IN LILIENFELD, AUSTRIA The International Summer Academy offers courses and lectures held by 4 – 18 July, 2021 internationally renowned artists and teachers. The participants can present their works, as prepared during the courses, to a public audience. This years’ Summer Academy will take place for the 40th time. The opening will be celebrated on July 4th, 2021. In celebration of the 40th Summer Academy, the opening event with the performance of Ludwig van Beethoven’s opera Fidelio will be particularly festive. The members of Amadeus Brass Quintet will also be celebrating their 15th year of teaching at the SAL with a brilliant 20 musicians brass orchestra concert in the 2nd week. As a place of inspiration, the SAL once again offers vocal and instrumental courses taught by recognized experts and pedagogues. Students and teachers perform together in Holy masses, in lecturer and participants concerts. These performances and the academic depth achieved by the exchange of ideas have a high educational value. They encourage artistic and human connections between many countries of the world. The director Karen De Pastel, the lecturers and the organizational team is looking forward to welcoming you in Lilienfeld! 1 The participation in the master courses is open to all students, musicians and music lovers. There is no age limitation for active participation. Forming REGISTRATION FEE instrumental and vocal ensembles is encouraged. Violinists who play viola as The registration fee is part of the course fee: a second instrument are free to choose one of the two instruments for o ACTIVE PARTICIPANTS EUR 60,- performance in ensemble groups. -

Historic Centre of Vienna
WHC Nomination Documentation File Name: 1033.pdf UNESCO Region: EUROPE AND THE NORTH AMERICA __________________________________________________________________________________________________ SITE NAME: Historic Centre of Vienna DATE OF INSCRIPTION: 16th December 2001 STATE PARTY: AUSTRIA CRITERIA: C (ii)(iv)(vi) DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: Excerpt from the Report of the 25th Session of the World Heritage Committee The Committee inscribed the Historic Centre of Vienna on the World Heritage List under criteria (ii), (iv), and (vi): Criterion (ii): The urban and architectural qualities of the Historic Centre of Vienna bear outstanding witness to a continuing interchange of values throughout the second millennium. Criterion (iv): Three key periods of European cultural and political development - the Middle Ages, the Baroque period, and the Gründerzeit - are exceptionally well illustrated by the urban and architectural heritage of the Historic Centre of Vienna. Criterion (vi): Since the 16th century Vienna has been universally acknowledged to be the musical capital of Europe. While taking note of the efforts already made for the protection of the historic town of Vienna, the Committee recommended that the State Party undertake the necessary measures to review the height and volume of the proposed new development near the Stadtpark, east of the Ringstrasse, so as not to impair the visual integrity of the historic town. Furthermore, the Committee recommended that special attention be given to continuous monitoring and control of any changes to the morphology of the historic building stock. BRIEF DESCRIPTIONS Vienna developed from early Celtic and Roman settlements into a Medieval and Baroque city, the capital of the Austro- Hungarian Empire. It played an essential role as a leading European music centre, from the great age of Viennese Classicism through the early part of the 20th century. -

View and Download La Belle Époque Art Timeline
Timeline of the History of La Belle Époque: The Arts 1870 The Musikverein, home to the Vienna Philharmonic, is inaugurated in Vienna on January 6. The Metropolitan Museum of Art in New York is established on April 13, without a single work of art in its collection, without any staff, and without a gallery space. The museum would open to the public two years later, on February 20, 1872. Richard Wagner premieres his opera Die Walküre in Munich on June 26. Opening reception in the picture gallery at the Metropolitan Museum of Art, 681 Fifth Avenue; February 20, 1872. Wood engraving published in Frank Leslie’s Weekly, March 9, 1872. 1871 Giuseppe Verdi’s opera Aida premieres in Cairo, Egypt on December 24. Lewis Carroll publishes Through the Looking Glass, a sequel to his book Alice’s Adventures in Wonderland (1865). James McNeill Whistler paints Arrangement in Grey and Black No. 1, commonly known as “Whistler’s Mother”. John Tenniel – Tweedledee and Tweedledum, illustration in Chapter 4 of Lewis Carroll’s Through the Looking Glass and What Alice Found There, 1871. Source: Modern Library Classics 1872 Claude Monet paints Impression, Sunrise, credited with inspiring the name of the Impressionist movement. Jules Verne publishes Around the World in Eighty Days. Claude Monet – Impression, Sunrise (Impression, soleil levant), 1872. Oil on canvas. Musée Marmottan Monet, Paris. 1873 Société Anonyme Coopérative des Artistes Peintres, Sculpteurs, Graveurs (Co-operative and Anonymous Association of Painters, Sculptors, and Engravers) (subsequently the Impressionists) is organized by Monet, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, and Alfred Sisley in response to frustration over the Paris Salon. -

31. Altwiener Ostermarkt 27
31. Altwiener Ostermarkt 27. März bis 13. April 2020 — Wien 1., Freyung täglich von 10.00 bis 19.30 Uhr www.altwiener-markt.at Traditional Viennese Mercatino di Pasqua Easter Market Il Mercatino di Pasqua apre le sue porte. Merchants from Austria and surrounding Al centro del mercato si può ammirare una countries offer numerous beautiful easter “montagna“ di uova, la più grande in Europa, decorations – more than 40.000 easter eggs dipinte con una gran varietà di segni e fatte di in many variations and sizes, easter candles, tanti materiali diversi. palm leaves, flowers, ceramics, toys and unique handcraft. Articoli artigianali, vari cesti die paglia, fiori, giocattoli e naturalmente le specialità delle Also, easter-snacks from Austrian provin- varie province attirano tanta gente. In più un ces, puppet-performances, workshops and a programma di musica, marionette, lavori a traditional music program on our stage will be mano per bambini vi invitano a passare qualche presented. ora piacevole in questo luogo. You can find our market in the 1st district – Fatevi catturare anche voi dal fascino di questo close to Schottenkirche – at Freyung. Mercatino di Pasqua in piazza Freyung, una Impressum: delle piazze più belle di Vienna. Veranstalter: Altwiener Märkte Betriebs GmbH Vorschau auf unsere nächste STADTwerkSTATT, Verein für aktive Stadtkultur Veranstaltung 1010 Wien, Dominikanerbastei 8 Für den Inhalt verantwortlich: Alexandra Holzer 34. Altwiener Christkindlmarkt Grafik: Typeflow e.U. auf der Freyung Druck: Gröbnerdruck 7400 Oberwart . November -
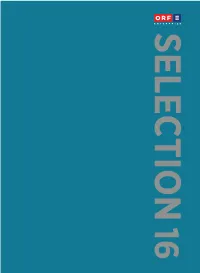
20 16 Selection 16
SELECTION 16 SELECTION 16 SELECTION 2016 SELECTION 2016 4K Ultra High Definition 4K UNIVERSUM · AVAILABLE NOW High Definition HD COMING SOON · IN PRODUCTION English Voice-Over EV FUTURE PROJECTS · HISTORY English Subtitles ES FACTUAL · SOCIAL ISSUES AND RELIGION French Voice-Over FV WORLD JOURNAL · CURRENT AFFAIRS French Subtitles FS NEWTON · WILDLIFE AND NATURE Italian Voice-Over IV PEOPLE AND PLACES · Spanish Voice-Over SV LEISURE AND LIFESTYLE Portuguese Voice-Over PV FICTION · TV-MOVIES · TV-SERIES 2-D Technology 2D FORMATS 3-D Technology 3D KIDS Surround Sound 5.1 MUSIC German Subtitles (Untertitel) UT INDEX Awards 1 ORF Headquarters ORF-Enterprise GmbH & Co KG Content Sales International Wuerzburggasse 30 1136 Vienna, Austria BEATRICE MARION COX-RIESENFELDER CAMUS-OBERDORFER Phone: +43 (1) 87878 – 13030 Managing Director Head of Content Sales International Fax: +43 (1) 87878 – 12757 E-Mail: [email protected] contentsales.ORF.at ASIA ITALY Pikfilm SDN BHD Filmedia s.r.l. No. 30, Lorong Bukit Pantai Via Ripamonti 89 59000 Kuala Lumpur, Malaysia 20141 Milano, Italy ARMIN LUTTENBERGER MONIKA KOSSITS E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] Sales Director TV Sales Manager TV www.pikfilm.com.my www.filmedia.com AUSTRALIA AND NEW ZEALAND LATIN AMERICA DEVISED Coproduction and Distribution Magnatel Ltda Rio de Janeiro Llull 47, 5–7 Contact: Magnatel GmbH 08005 Barcelona, Spain Grabenstrasse 25 JOHANNES STANEK ALEXANDRA HOPF E-Mail: [email protected] 76534 Baden-Baden, Germany Sales Manager TV Sales Manager TV