Passiflora Spp. – Passionsblumen (Passifloraceae )
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

HUNTIA a Journal of Botanical History
HUNTIA A Journal of Botanical History VOLUME 15 NUMBER 2 2015 Hunt Institute for Botanical Documentation Carnegie Mellon University Pittsburgh The Hunt Institute for Botanical Documentation, a research division of Carnegie Mellon University, specializes in the history of botany and all aspects of plant science and serves the international scientific community through research and documentation. To this end, the Institute acquires and maintains authoritative collections of books, plant images, manuscripts, portraits and data files, and provides publications and other modes of information service. The Institute meets the reference needs of botanists, biologists, historians, conservationists, librarians, bibliographers and the public at large, especially those concerned with any aspect of the North American flora. Huntia publishes articles on all aspects of the history of botany, including exploration, art, literature, biography, iconography and bibliography. The journal is published irregularly in one or more numbers per volume of approximately 200 pages by the Hunt Institute for Botanical Documentation. External contributions to Huntia are welcomed. Page charges have been eliminated. All manuscripts are subject to external peer review. Before submitting manuscripts for consideration, please review the “Guidelines for Contributors” on our Web site. Direct editorial correspondence to the Editor. Send books for announcement or review to the Book Reviews and Announcements Editor. Subscription rates per volume for 2015 (includes shipping): U.S. $65.00; international $75.00. Send orders for subscriptions and back issues to the Institute. All issues are available as PDFs on our Web site, with the current issue added when that volume is completed. Hunt Institute Associates may elect to receive Huntia as a benefit of membership; contact the Institute for more information. -

Scientia Amazonia, V. 7, N.2, CB1-CB9, 2018 Descrição Da
Scientia Amazonia, v. 7, n.2, CB1-CB9, 2018 Revista on-line http://www.scientia-amazonia.org ISSN:2238.1910 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS Descrição da composição cromossômica de Passiflora coccinea Aubl. (Passifloraceae) do campus da Universidade Federal do Amazonas, UFAM Carolina de Amorim Soares1, Yasmin Tavares Dantas1, Phamela Barbosa Coelho1, Rogério de Oliveira Neves2, Marcos Cézar Fernandes Pessoa2, Edson Junior do Carmo3, Natalia Dayane Moura Carvalho4 Resumo Passiflora é considerado um dos gêneros mais importante da família Passifloraceae. Algumas espécies de Passiflora já foram analisadas citogeneticamente, mas pouco é sabido sobre espécies que ocorrem na Amazônia. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi compilar dados citogenéticos do gênero Passiflora bem como determinar a composição cromossômica da espécie Passiflora coccinea proveniente do fragmento florestal da Universidade Federal do Amazonas. Para isto, os meristemas radiculares foram pré-tratados com solução antimitótica 8- hidroxiquiloneína e fixados com Carnoy. As preparações cromossômicas foram realizadas pela técnica de dissociação celular e submetidas à coloração convencional com Giemsa. A morfologia cromossômica foi determinada com base na razão entre os braços. No presente trabalho, o tempo de pré-tratamento mais adequado foi três horas, apresentando um maior número de células em metáfases mitóticas e melhor morfologia cromossômica em Passiflora coccinea. O número diploide foi igual a 72, sendo 26 cromossomos metacêntricos/submetacêntricos e 46 acrocêntricos (26 m/sm + 46a) e número fundamental de braços igual a 98. Assim, os resultados obtidos neste estudo revelaram uma composição cariotípica inédita para a espécie Passiflora coccinea, reforçando a importância no aumento de análises cromossômicas no gênero Passiflora, essenciais para a compreensão da organização do genoma deste grupo de plantas. -

RESOLUÇÃO No 445, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 Publicada No DOU Nº 2, Do Dia 03 De Janeiro De 2012
RESOLUÇÃO No 445, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011 Publicada no DOU Nº 2, do dia 03 de janeiro de 2012 Aprova a lista de espécies indicadoras dos estágios sucessionais de vegetação de restinga para o Estado do Piauí, de acordo com a Resolução no 417, de 23 de novembro de 2009. O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, no uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 8o, inciso I da Lei no 6.938, de 31 de agosto, de 1981 e tendo em vista o disposto no art. 4o, § 1o, da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006 e da Resolução CONAMA no 417, de 23 de novembro de 2009, resolve: Art. 1o As espécies indicadoras de vegetação primária e dos distintos estágios sucessionais secundários da vegetação de restinga na Mata Atlântica, aludidas no art. 4o da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, e no § 1o do art. 3o da Resolução CONAMA no 417, de 23 de novembro de 2009, para o Estado do Piauí, são as seguintes: I - Vegetação Herbácea e Subarbustiva de Restinga: a) Vegetação clímax Aeschynomene brasiliana, Aeschynomene histrix, Aeschynomene paniculata, Alternanthera brasiliana, Alternanthera littoralis, Alternanthera sessilis, Alternanthera tenella, Alysicarpus vaginalis, Aristida setifolia, Blutaparon portulacoides, Borreria verticillata, Bulbostylis scabra, Cassytha filiformis, Cenchrus ciliaris, Centrosema brasilianum, Ceratosanthes trifoliata, Chamaecrista ramosa, Cyperus aggregatus, Cyperus articulatus, Cyperus maritimus, Dalechampia pernambucensis, Diodella apiculata, Echinodorus grandiflorus, Echinodorus tenellus, Eleocharis interstincta, -

Microsatellite Marker Development by Partial Sequencing of the Sour
Araya et al. BMC Genomics (2017) 18:549 DOI 10.1186/s12864-017-3881-5 RESEARCH ARTICLE Open Access Microsatellite marker development by partial sequencing of the sour passion fruit genome (Passiflora edulis Sims) Susan Araya1, Alexandre M Martins2, Nilton T V Junqueira3, Ana Maria Costa3, Fábio G Faleiro3 and Márcio E Ferreira2,4* Abstract Background: The Passiflora genus comprises hundreds of wild and cultivated species of passion fruit used for food, industrial, ornamental and medicinal purposes. Efforts to develop genomic tools for genetic analysis of P. edulis, the most important commercial Passiflora species, are still incipient. In spite of many recognized applications of microsatellite markers in genetics and breeding, their availability for passion fruit research remains restricted. Microsatellite markers in P. edulis are usually limited in number, show reduced polymorphism, and are mostly based on compound or imperfect repeats. Furthermore, they are confined to only a few Passiflora species. We describe the use of NGS technology to partially assemble the P. edulis genome in order to develop hundreds of new microsatellite markers. Results: A total of 14.11 Gbp of Illumina paired-end sequence reads were analyzed to detect simple sequence repeat sites in the sour passion fruit genome. A sample of 1300 contigs containing perfect repeat microsatellite sequences was selected for PCR primer development. Panels of di- and tri-nucleotide repeat markers were then tested in P. edulis germplasm accessions for validation. DNA polymorphism was detected in 74% of the markers (PIC = 0.16 to 0.77; number of alleles/locus = 2 to 7). A core panel of highly polymorphic markers (PIC = 0.46 to 0.77) was used to cross-amplify PCR products in 79 species of Passiflora (including P. -

Meiotic Behavior in Wild and Domesticated Species of Passiflora
Revista Brasil. Bot., V.34, n.1, p.63-72, jan.-mar. 2011 Meiotic behavior in wild and domesticated species of Passiflora MARGARETE MAGALHÃES SOUZA1,3 and TELMA NAIR SANTANA PEREIRA2 (received: April 29, 2010; accepted: January 20, 2011) ABSTRACT – (Meiotic behavior in wild and domesticated species of Passiflora). The meiotic behavior of fourteen Passiflora taxa was analyzed. The species were grouped according to the n value (6, 9 and 12) for statistical studies. Some species presented tetravalent associations or univalent chromosomes in diakinesis, bivalent formation prevailing. The qui-square test revealed significant differences in the chiasma frequency among species forn = 9 and n = 6 groups. There was predominance of interstitial chiasmata in almost all studied species. The n = 12 group was the only one whose meiotic behavior was considered similar due to the quantity of chiasmata per cell, tendency of interstitial chiasma localization. Some species presented meiotic irregularities, such as laggard and precocious chromosomes in meiosis I. In telophase II the percentages of meiotic irregularities was low. Irregularities in the spindle orientation were presented in higher percentages in the end of meiosis II, and were also responsible for post-meiotic abnormal products. The irregularities observed during meiosis can have influence on the percentage of sterile pollen grains and success of interspecific crossings inPassiflora species. Key words - chiasmata, meiotic index, microsporogenesis, passion flower, post-meiotic products RESUMO – (Comportamento meiótico em espécies silvestres e domesticadas de Passiflora). O comportamento meiótico de 14 táxons foi analisado. As espécies foram agrupadas de acordo com o valor de n (6, 9 e 12) para estudos estatísticos. -

Universidade Federal Do Espírito Santo Centro De Ciências Agrárias E Engenharias Programa De Pós-Graduação Em Produção Vegetal
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PRODUÇÃO VEGETAL KATIUSS FERREIRA BORGES DIVERSIDADE DE Passifloraceae s.s. NO ESPÍRITO SANTO ALEGRE, ES 2016 KATIUSS FERREIRA BORGES DIVERSIDADE DE Passifloraceae s.s. NO ESPÍRITO SANTO Dissertação apresentada a Universidade Federal do Espírito Santo, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, para obtenção do título de Magister Scientiae. Orientadora: Profª. Drª. Marcia Flores da Silva Ferreira Coorientadores: Profª. Drª. Michaele Alvim Milward de Azevedo, Profª. Drª. Milene Miranda Praça Fontes e Prof. Dr. Adésio Ferreira. ALEGRE, ES AGOSTO – 2016 ii Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP) (Biblioteca Setorial de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Espírito Santo, ES, Brasil) Borges, Katiuss Ferreira, 1990- B732d Diversidade de Passifloraceae s.s no Espírito Santo / Katiuss Ferreira Borges. – 2016. 193 f. : il. Orientadora: Marcia Flores da Silva Ferreira. Coorientadora: Michaele Alvim Milward de Azevedo, Milene Miranda Praça Fontes, Adésio Ferreira. Dissertação (Mestrado em Produção Vegetal) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. 1. Maracujá. 2. Microssatélites. 3. Morfologia. 4. Taxonomia. I. Ferreira, Marcia Flores da Silva. II. Azevedo, Michaele Alvim Milward de. III. Fontes, Milena Miranda Praça. IV. Ferrreira, Adésio. V. Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de Ciências Agrárias e Engenharias. VI. Título. CDU: 63 iii KATIUSS FERREIRA BORGES DIVERSIDADE DE Passifloraceae s.s. NO ESPÍRITO SANTO Dissertação apresentada a Universidade Federal do Espírito Santo, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, para obtenção do título de Mestre em Produção Vegetal. -

Issue 8 Lo-Res
ONLINE JOURNAL ISSUE NO. 8 | JUNE 2016 sub sole sub umbra virens © Raphael Sloane THIS MONTH’S ISSUE Digital taxonomy - Passiflora fieldiana. Passiflora ‘Buzios’. Maypop jelly. Passiflora xrosea. Passion fruit soup and more.... Contents Issue 8 ONLINE JOURNAL sub sole sub umbra virens ISSUE 8 JUNE 2016 ISSN 2046-8180 04 In pursuit of jelly! By Michael Cook Trials and tribulations EDITOR, LAYOUT & PUBLISHER Myles Irvine ASSOciatE EDITORS Chuck Chan Luís Lopes 10 Digital taxonomy Shawn Mattison By Andrew Adair Kyle Rahrig Passiflora fieldiana Cover pictures: We thank photographer Raphael Sloane for his kindness in allowing to use his images on the Front and Back Covers and elsewhere. All are © Raphael Sloane. See more of his work at www.raphaelsloane.com. We invite submissions from all Passiflora enthusiasts, from cartoons, garden tales, recipes and growing tips to articles about 42 Passiflora photography new species and hybrids and reports of wild collecting trips. Please By Raphael Sloane contact the editor at [email protected] as above. Articles in Stunning images any language are welcome but will be translated and published in English only for reasons of space. We reserve the right to edit or refuse articles and ask contributors to note that we may be able to offer scientific peer review depending on the topic. Please note that contributors are not paid. Letters to the editor for publication are also welcome. Note that new species should first be submitted to the appropriate 52 Recreating Passiflora xrosea scientific botanical journals so that the validity of the name is B Chuck Chan and Paul Borchardt established, after which time we may carry an article about them. -

Universidade Federal De Juiz De Fora Instituto De Ciências Biológicas Programa De Pós-Graduação Em Ecologia
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA Andreza Magro Moraes PASSIFLORACEAE JUSS. SENSU STRICTO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO BRIGADEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL Juiz de Fora, MG Fevereiro, 2016 Andreza Magro Moraes PASSIFLORACEAE JUSS. SENSU STRICTO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO BRIGADEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Juiz de Fora, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ecologia Aplicada ao Manejo e Conservação de Recursos Naturais. Orientadora: Profa. Dra. Ana Paula Gelli de Faria Juiz de Fora, MG. Fevereiro, 2016 i Andreza Magro Moraes PASSIFLORACEAE JUSS. SENSU STRICTO NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO BRIGADEIRO, MINAS GERAIS, BRASIL Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Ecologia e Conservação de Recursos Naturais da Universidade Federal de Juiz de Fora, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ecologia Aplicada ao Manejo e Conservação de Recursos Naturais. Aprovado em: ____/____/____ ___________________________________________________ Profa. Dra. Ana Paula Gelli de Faria Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF (Orientadora) ____________________________________________________ Profa. Dra. Michaele Alvim Milward-de-Azevedo Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ ___________________________________________________ Prof. Dr. Luiz Menini Neto Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora - CES-JF ii Á minha família meu porto seguro E á bela Serra do Brigadeiro Dedico! iii AGRADECIMENTOS A Nossa Senhora e a Deus, pela força e guia. À CAPES pelo financiamento da bolsa. Ao PGECOL e UFJF, pela infraestrutura e auxílio financeiro. -

Universidade Do Estado Do Rio De Janeiro Centro Biomédico Instituto De Biologia Roberto Alcantara Gomes
Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro Biomédico Instituto de Biologia Roberto Alcantara Gomes Thiago de Azevedo Amorim Mecanismos que explicam os padrões de diversidade de plantas trepadeiras ao longo de distintas escalas geográficas Rio de Janeiro 2018 Thiago de Azevedo Amorim Mecanismos que explicam os padrões de diversidade de plantas trepadeiras ao longo de distintas escalas geográficas Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Área de concentração: Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Orientador: Prof. Dr. Bruno Henrique Pimentel Rosado Coorientador: Prof. Dr. André Felippe Nunes-Freitas Rio de Janeiro 2018 CATALOGAÇÃO NA FONTE UERJ / REDE SIRIUS / BIBLIOTECA CTC-A A524 Amorim, Thiago de Azevedo. Mecanismos que explicam os padrões de diversidade de plantas trepadeiras ao longo de distintas escalas geográficas / Thiago de Azevedo Amorim. – 2018. 145 f. : il. Orientador: Bruno Henrique Pimentel Rosado. Coorientador: André Felippe Nunes-Freitas. Tese (Doutorado em Ecologia e Evolução) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes. 1. Ecologia vegetal – Teses. 2. Trepadeiras – Influência do meio ambiente - Teses. I. Rosado, Bruno Henrique Pimentel. II. Nunes-Freitas, André Felippe. III. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Biologia Roberto Acântara Gomes. IV. Título. CDU 581.522.4 Rinaldo Magallon CRB/7-5016 – Responsável pela elaboração da ficha catalográfica. Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta tese, desde que citada a fonte. ______________________________ _______________________ Assinatura Data Thiago de Azevedo Amorim Mecanismos que explicam os padrões de diversidade de plantas trepadeiras ao longo de distintas escalas geográficas Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do título de Doutor, ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Evolução da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. -

PASSIFLORACEAE NA RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA, DESCOBERTO, MINAS GERAIS, BRASIL Nívea Maria Farinazzo1,2 & Fátima Regina Gonçalves Salimena1,3
PASSIFLORACEAE NA RESERVA BIOLÓGICA DA REPRESA DO GRAMA, DESCOBERTO, MINAS GERAIS, BRASIL Nívea Maria Farinazzo1,2 & Fátima Regina Gonçalves Salimena1,3 RESUMO (Passifloraceae na Reserva Biológica da Represa do Grama, Descoberto, Minas Gerais, Brasil) Este trabalho trata do levantamento das espécies de Passifloraceae na Reserva Biológica da Represa do Grama, Zona da Mata de Minas Gerais, município de Descoberto. São encontradas na Reserva seis espécies de Passiflora: P. alata, P. amethystina, P. edulis, P. haematostigma, P. kermesina e P. speciosa. São apresentados chave de identificação, descrições, ilustrações e comentários para todas as espécies. Palavras-chave: Taxonomia, Passiflora, floresta estacional. ABSTRACT (Passifloraceae in the Reserva Biológica da Represa do Grama, Descoberto, Minas Gerais, Brazil) A survey consisting of the taxonomic study of the Passifloraceae species in the Reserva Biológica da Represa do Grama, located at the Zona da Mata of Minas Gerais State, in the municipality of Descoberto. Six species of Passiflora were found: P. alata, P. amethystina, P. edulis, P. haematostigma, P. kermesina and P. speciosa. Identification key, descriptions, illustrations and comments for all species are presented. Key words: Taxonomy, Passiflora, stacional forest. INTRODUÇÃO Este trabalho apresenta as espécies de A família Passifloraceae é predominan- Passifloraceae encontradas na Reserva temente tropical reunindo cerca de 19 gêneros Biológica da Represa do Grama e tem como e 530 espécies, sendo Passiflora o gênero objetivo contribuir para o conhecimento taxonômico das Passifloraceae desta Unidade mais diverso, com aproximadamente 400 de Conservação, ampliando o conhecimento espécies descritas (Bernacci 2003; Killip 1938). da flora da Zona da Mata Mineira. No Brasil ocorrem quatro gêneros e cerca de Por representar um importante 130 espécies, a maioria incluída no gênero remanescente de Mata Atlântica nessa região, Passiflora (Bernacci 2003), subdividido em 23 a Reserva é considerada de alta importância subgêneros (Cervi 1997). -
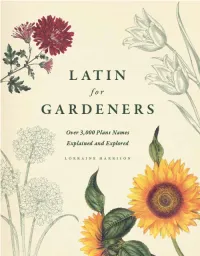
Latin for Gardeners: Over 3,000 Plant Names Explained and Explored
L ATIN for GARDENERS ACANTHUS bear’s breeches Lorraine Harrison is the author of several books, including Inspiring Sussex Gardeners, The Shaker Book of the Garden, How to Read Gardens, and A Potted History of Vegetables: A Kitchen Cornucopia. The University of Chicago Press, Chicago 60637 © 2012 Quid Publishing Conceived, designed and produced by Quid Publishing Level 4, Sheridan House 114 Western Road Hove BN3 1DD England Designed by Lindsey Johns All rights reserved. Published 2012. Printed in China 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5 ISBN-13: 978-0-226-00919-3 (cloth) ISBN-13: 978-0-226-00922-3 (e-book) Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Harrison, Lorraine. Latin for gardeners : over 3,000 plant names explained and explored / Lorraine Harrison. pages ; cm ISBN 978-0-226-00919-3 (cloth : alkaline paper) — ISBN (invalid) 978-0-226-00922-3 (e-book) 1. Latin language—Etymology—Names—Dictionaries. 2. Latin language—Technical Latin—Dictionaries. 3. Plants—Nomenclature—Dictionaries—Latin. 4. Plants—History. I. Title. PA2387.H37 2012 580.1’4—dc23 2012020837 ∞ This paper meets the requirements of ANSI/NISO Z39.48-1992 (Permanence of Paper). L ATIN for GARDENERS Over 3,000 Plant Names Explained and Explored LORRAINE HARRISON The University of Chicago Press Contents Preface 6 How to Use This Book 8 A Short History of Botanical Latin 9 Jasminum, Botanical Latin for Beginners 10 jasmine (p. 116) An Introduction to the A–Z Listings 13 THE A-Z LISTINGS OF LatIN PlaNT NAMES A from a- to azureus 14 B from babylonicus to byzantinus 37 C from cacaliifolius to cytisoides 45 D from dactyliferus to dyerianum 69 E from e- to eyriesii 79 F from fabaceus to futilis 85 G from gaditanus to gymnocarpus 94 H from haastii to hystrix 102 I from ibericus to ixocarpus 109 J from jacobaeus to juvenilis 115 K from kamtschaticus to kurdicus 117 L from labiatus to lysimachioides 118 Tropaeolum majus, M from macedonicus to myrtifolius 129 nasturtium (p. -
Passiflora Spp. – Passionsblumen (Passifloraceae) 251-262 © Bochumer Botanischer Verein E.V
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Jahrbuch des Bochumer Botanischen Vereins Jahr/Year: 2012 Band/Volume: 3 Autor(en)/Author(s): Dörken Veit Martin, Jagel Armin Artikel/Article: Passiflora spp. – Passionsblumen (Passifloraceae) 251-262 © Bochumer Botanischer Verein e.V. Jahrb. Bochumer Bot. Ver. 3 251-262 2012 Passiflora spp. – Passionsblumen (Passifloraceae) VEIT MARTIN DÖRKEN & ARMIN JAGEL 1 Einleitung Die "Passionsblume" wurde durch den "Studienkreis Entwicklungsgeschichte der Arznei- pflanzen" an der Julius-Maximilian-Universität Würzburg zur Arzneipflanze des Jahres 2011 gekürt. Gemeint ist Passiflora incarnata, die Fleischfarbene Passionsblume (Abb. 1), denn nur sie spielt als Arzneipflanze eine überregionale Rolle. Die Art wird in Deutschland so gut wie nicht als Garten- oder Zimmerpflanze angeboten. Es ist daher unklar, welcher Zweck mit dieser Wahl verfolgt wurde. Es erscheint jedenfalls sinnvoller, hierfür Arten auszuwählen, die in Deutschland heimisch oder wenigstens als Zierpflanze verbreitet sind, wie dies auch bei der Blume und dem Baum des Jahres geschieht und letztes Jahr auch auf den Efeu (Hedera helix) als Arzneipflanze des Jahres 2010 zutraf. Gleichwohl handelt es sich bei den Passionsblumen um eine außerordentlich attraktive Pflanzengruppe, die sich sowohl bei Botanikern als auch bei sonstigen Pflanzenfreunden großer Beliebtheit erfreut und zumindest auf Raritätenbörsen in vielen Arten und Sorten erhältlich ist. Darüber hinaus gehört auch die Passionsfrucht in diese Gruppe, die ausgepresst als “Maracuja“ in vielen Fruchtsäften geschmacklich dominiert. Die Wahl der Arzneipflanze des Jahres soll daher zum Anlass genommen werden, hier einen Überblick über die in vielerlei Hinsicht spektakuläre Gattung Passiflora zu geben. Abb. 1: Fleischfarbene Passionsblume (Passiflora Abb.