„De Avium Natura“ Von Conrad Gessner (1516–1565)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Summits of Modern Man: Mountaineering After the Enlightenment (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013)
Bibliography Peter H. Hansen, The Summits of Modern Man: Mountaineering after the Enlightenment (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013) This bibliography consists of works cited in The Summits of Modern Man along with a few references to citations that were cut during editing. It does not include archival sources, which are cited in the notes. A bibliography of works consulted (printed or archival) would be even longer and more cumbersome. The print and ebook editions of The Summits of Modern Man do not include a bibliography in accordance with Harvard University Press conventions. Instead, this online bibliography provides links to online resources. For books, Worldcat opens the collections of thousands of libraries and Harvard HOLLIS records often provide richer bibliographical detail. For articles, entries include Digital Object Identifiers (doi) or stable links to online editions when available. Some older journals or newspapers have excellent, freely-available online archives (for examples, see Journal de Genève, Gazette de Lausanne, or La Stampa, and Gallica for French newspapers or ANNO for Austrian newspapers). Many publications still require personal or institutional subscriptions to databases such as LexisNexis or Factiva for access to back issues, and those were essential resources. Similarly, many newspapers or books otherwise in the public domain can be found in subscription databases. This bibliography avoids links to such databases except when unavoidable (such as JSTOR or the publishers of many scholarly journals). Where possible, entries include links to full-text in freely-accessible resources such as Europeana, Gallica, Google Books, Hathi Trust, Internet Archive, World Digital Library, or similar digital libraries and archives. -

The Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research on Weissfluhjoch Near Davos at 8700 Feet Above Sea Level Petitmermet, P.; Miggli, Paul; Bucher, Edwin
NRC Publications Archive Archives des publications du CNRC The Swiss Federal Institute for snow and avalanche research on Weissfluhjoch near Davos at 8700 feet above sea level Petitmermet, P.; Miggli, Paul; Bucher, Edwin For the publisher’s version, please access the DOI link below./ Pour consulter la version de l’éditeur, utilisez le lien DOI ci-dessous. Publisher’s version / Version de l'éditeur: https://doi.org/10.4224/20331395 Technical Translation (National Research Council of Canada), 1948-02-24 NRC Publications Record / Notice d'Archives des publications de CNRC: https://nrc-publications.canada.ca/eng/view/object/?id=c8b2084c-1537-4c37-aa61-649c9bd60343 https://publications-cnrc.canada.ca/fra/voir/objet/?id=c8b2084c-1537-4c37-aa61-649c9bd60343 Access and use of this website and the material on it are subject to the Terms and Conditions set forth at https://nrc-publications.canada.ca/eng/copyright READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY BEFORE USING THIS WEBSITE. L’accès à ce site Web et l’utilisation de son contenu sont assujettis aux conditions présentées dans le site https://publications-cnrc.canada.ca/fra/droits LISEZ CES CONDITIONS ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER CE SITE WEB. Questions? Contact the NRC Publications Archive team at [email protected]. If you wish to email the authors directly, please see the first page of the publication for their contact information. Vous avez des questions? Nous pouvons vous aider. Pour communiquer directement avec un auteur, consultez la première page de la revue dans laquelle son article a été publié afin de trouver ses coordonnées. -

Sobre La Recepción En Latín Del Séfer Ha-Šorašim
SEFARAD, vol. 76:2, julio-diciembre 2016, págs. 313-331 ISSN: 0037-0894, doi: 10.3989/sefarad.016.011 “Thou bearest not the root, but the root thee.” On the Reception of the Sefer ha-Shorashim in Latin Saverio Campanini* Università di Bologna «NO SUSTENTAS TÚ A LA RAÍZ, SINO LA RAÍZ A TI». SOBRE LA RECEPCIÓN EN LATÍN DEL SÉFER HA-ŠORAŠIM. Este artículo se ocupa de los principales capítulos de la recepción del Sefer ha-šorašim de David Quimḥi en el mundo cristiano durante el Renacimiento. Un testimonio menos conocido de este interés, que combina el examen crítico con la apro- piación, es la traducción latina integral compuesta por, o para, el cardenal Egidio de Viterbo, probablemente durante la segunda década del siglo XVI, y conservada en dos manuscritos. En este artículo se ofrece, junto a una rápida presentación de la situación de la lexicografía hebrea al principio del Renacimiento y de su profunda transforma- ción debida a la problemática adopción del modelo de Quimḥí, una visión sintética de los diferentes enfoques de las varias versiones del diccionario de Quimḥí en el mundo cristiano: de la simple adaptación al moldeo, bastante complicado, de un diccionario bi- lingüe de hebreo bíblico, al fenómeno paradójico de la traducción de un léxico mono- lingüe en un idioma diferente. En este último, la pérdida semántica es evidente: lo que sigue siendo de interés prioritario es el provecho exegético esperado de la investigación sobre esta adaptación, y no menos importante, el avance de nuestro conocimiento de la comprensión humanista de la Biblia en una época de cambios paradigmáticos radicales. -

Caspar Wolf and His Personal Public Commitment to Edit Conrad Gessner's Unfinished History of Plants
Gesnerus 75 (2018) 40–94 Caspar Wolf and his personal public commitment to edit Conrad Gessner’s unfinished history of plants (Part I: Essay) Holger Funk Summary After completion of his History of animals, Gessner began an equally ambi- tious History of plants, which, however, he could not complete due to his premature death in consequence of a fatal epidemic. Immediately after Gessner’s death, Caspar Wolf (c. 1532–1601), Gessner’s former pupil, publicly announced his intention to edit the botanical legacy of his mentor. Wolf’s announcement, entitled “Promise” (Pollicitatio), is of prime importance con- cerning the unfinished plant history and has influenced many researchers’ views. However, it has often been forgotten that Wolf had written the announcement also for his own domestic purposes and that caution is there- fore required. The present study, complemented by the first full translation of Wolf’s text, is intended to reinforce the need for such caution. It is sug- gested that it was not only Wolf’s failings that led to the final failure of the project, but also that Gessner himself may have failed to establish a body of text substantial enough to satisfy his own aspirations.* Keywords: Caspar Wolf, Conrad Gessner, botanical legacy, History of plants, Historia stirpium, Historia plantarum * I am grateful to Florike Egmond (Rome) and Urs B. Leu (Zurich), who supported my endeavours and in particular to Vivian Nutton (London) and Peter Day (London), who reviewed draft versions. Holger Funk, Kapellenstr. 3a, D-33102 Paderborn ([email protected]). 40 Gesnerus 75 (2018) Downloaded from Brill.com10/06/2021 04:38:55PM via free access The situation In early 1566, shortly after Conrad Gessner’s death, his pupil Caspar Wolf publicly appealed to Johannes Crato von Krafftheim (1519–1585), Gessner’s close friend, with the urgent request to assist him in the publication of the unfinished history of plants of the deceased. -

150 Years of Chemistry at the University of Zurich
175th ANNIVERSARY OF THE UNIVERSITY OF ZURICH 75 doi:10.2533/chimia.2008.75 CHIMIA 2008, 62, No. 3 Chimia 62 (2008) 75–102 © Schweizerische Chemische Gesellschaft ISSN 0009–4293 150 Years of Chemistry at the University of Zurich# Conrad Hans Eugster* Abstract: This article was published in Chimia 1983, 37, to commemorate the 150-year anniversary of Chemistry at the University of Zurich. This excellent historical account displays a depth of information and research that makes it very worthwhile reproducing here. It presents an account of Chemistry at the University of Zurich up to 1983 and has not been changed or updated in any way except translation into English from the original German. Keywords: Chemical Institutes UZH · Karrer, P. · Werner, A. 1. Introduction Laws passed in 28th September 1832, creat- cist, but had been awarded his doctorate in ed and promoted by liberal political forces, chemistry in 1825 with Gmelin in Heidel- Medicine and the sciences were important long years of planning for the establishment berg. He subsequently assisted Mitscherlich subjects in the town of Zurich long before of a University finally came to fruition. On in Berlin and then completed his habilita- the University was founded. Names like 29th April 1833 the University was cer- tion at the University of Heidelberg in 1830 Konrad Gessner, Josias Simmler, Johan- emoniously inaugurated with 159 matricu- with his work on bromine which gained nes von Muralt, Johann Jakob Scheuchzer, lated students. The first vice-chancellor was wide attention.[2] In Zurich he quickly at- Johannes Gessner or Salomon Schinz were Lorenz Oken, Professor for ‘General Natu- tracted many students. -

The Grammar of Justification: the Doctrines of Peter Martyr Vermigli and John Henry Newman and Their Ecumenical Implications
Middlesex University Research Repository An open access repository of Middlesex University research http://eprints.mdx.ac.uk Castaldo, Christopher A. (2015) The grammar of justification: the doctrines of Peter Martyr Vermigli and John Henry Newman and their ecumenical implications. PhD thesis, Middlesex University / London School of Theology. [Thesis] Final accepted version (with author’s formatting) This version is available at: https://eprints.mdx.ac.uk/15772/ Copyright: Middlesex University Research Repository makes the University’s research available electronically. Copyright and moral rights to this work are retained by the author and/or other copyright owners unless otherwise stated. The work is supplied on the understanding that any use for commercial gain is strictly forbidden. A copy may be downloaded for personal, non-commercial, research or study without prior permission and without charge. Works, including theses and research projects, may not be reproduced in any format or medium, or extensive quotations taken from them, or their content changed in any way, without first obtaining permission in writing from the copyright holder(s). They may not be sold or exploited commercially in any format or medium without the prior written permission of the copyright holder(s). Full bibliographic details must be given when referring to, or quoting from full items including the author’s name, the title of the work, publication details where relevant (place, publisher, date), pag- ination, and for theses or dissertations the awarding institution, the degree type awarded, and the date of the award. If you believe that any material held in the repository infringes copyright law, please contact the Repository Team at Middlesex University via the following email address: [email protected] The item will be removed from the repository while any claim is being investigated. -

Marginalien Konrad Gessners Als Historische Quelle : Huldrych M
Marginalien Konrad Gessners als historische Quelle : Huldrych M. Koelbing in gemeinsamer Gessner-Freundschaft zum 70. Geburtstag Autor(en): Leu, Urs B. Objekttyp: Article Zeitschrift: Gesnerus : Swiss Journal of the history of medicine and sciences Band (Jahr): 50 (1993) Heft 1-2 PDF erstellt am: 08.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-520768 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Marginalien Konrad Gessners als historische Quelle Huldrych M. Koelbing in gemeinsamer Gessner-Freundschaft zum 70. Geburtstag Urs B. Leu SüMMABY Conrad Gessner f 7576-/565j possessed an impresstve Ziferary o/ Ziundreds o/ feoofes. yd Zot o/ t/iese feoofes disfinguis/i t/iemseZres fcjy t/ieir Ziand-teritten notes made fcy Gessner. -

Escalades Dans Les Alpes 1860-1869 D'edward Whymper, Une Œuvre À La
Diplôme national de master Domaine - sciences humaines et sociales Mention - sciences de l’information et des bibliothèques 2013 Spécialité - cultures de l’écrit et de l’image Juin / aster 1 aster Escalades dans les Alpes 1860-1869 d’Edward Whymper, une œuvre à la croisée de l’art et de la science émoire deM émoire M Anne Turpin-Hutter Sous la direction de Monsieur Christian Sorrel Professeur d’Histoire contemporaine – Université Lumière Lyon 2 REMERCIEMENTS Je tiens tout d’abord à remercier Monsieur Christian Sorrel qui m’a encadré et conseillé pendant ce travail. Je remercie Monsieur Christian Burdet des Éditions Alpage pour sa sympathie et sa disponibilité. Les informations qu’il m’a apportées ont été d’une grande aide pour la finalisation de ce mémoire. Merci également au Club Alpin Français de Lyon, et tout particulièrement à Bernadette Pangaud, pour la mise à disposition de leur fond documentaire très précieux sur Whymper et l’alpinisme en général. Je remercie également mes amies Albane et Emma, fidèles relectrices et rigoureuses correctrices, sans qui ce mémoire ne serait pas aussi achevé. Merci enfin à la montagne, pour l’inspiration et l’apaisement qu’elle me procure depuis toujours. TURPIN-HUTTER Anne | Master 1 Cultures de l’Écrit et de l’Image | Mémoire | Juin 2013 3 Droits d’auteur réservés. RÉSUMÉ Dans la perspective historique de l’émergence de l’alpinisme dans la seconde moitié du XIXe siècle, le premier récit d’Edward Whymper, Escalades dans les Alpes 1860-1869, adopte un style littéraire et artistique précurseur. L’illustration par les gravures affiche la volonté d’exprimer la sensibilité esthétique qu’inspirent les montagnes, devenues, pour l’époque, un terrain d’explorations scientifiques et humaines. -

Conrad Gessner Et L'europe Des Thermes
Proceedings Chapter Conrad Gessner et l'Europe des thermes DANZI, Massimo Abstract Profil d' histoire européenne des eaux curatives entre haut Moyen Age et Renaissance Reference DANZI, Massimo. Conrad Gessner et l'Europe des thermes. In: Leu, U. & Opitz, P. Conrad Gessner (1516-1565) : die Renaissance der Wissenschaften / the renaissance of learning. Berlin/Boston : De Gruyter, 2019. p. 253-272 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:125185 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 Conrad Gessner (1516-1565) - Die Renaissance der Wissenschaften/ The Renaissance of Learning Herausgegeben von/Edited by Urs. B. Leu und/and Peter Opitz DE GRUYTER OLDENBOURG lnhaltsverzeichnis/Contents Urs B. Leu und Peter Opitz Vorwort-V 1 Bibliographien und Enzylopadistik/Bibliographies and Encyclopedias Fiammetta Sabba Testimonies of Jewish Literature and Culture in the Bibliographie Work by Conrad Gessner-3 Baudouin Van den Abeele Conrad Gessner ais Leser mittelalterlicher Enzyklopadien -15 Koichi Yukishima Gessner's Bibliotheca universalis and the Aldine Press -29 2 Botanik/Botany Urs Eggli Conrad Gessner and the Early History of the Prickly Pear Cactus (Opuntia ficus-indica) -43 Anne Erlemann Gessner ais Botaniker und Krauterbuchautor - 67 Beat A. Wartmann Conrad Gessners Orchideen in der Historia Plantarum - 83 3 Erdwissenschaften/Earth Sciences Simona Boscani Leoni Conrad Gessner and a Newly Discovered Enthusiasm for Mountains in the Renaissance-119 VIII - lnhaltsverzeichnis/Contents lnhaltsverzeichnis/Contents -

Book Chapter Reference
Book Chapter Gessner balnéologue DANZI, Massimo Abstract La tradition thermale, telle qu'elle nous est connue à travers les textes de la Renaissance, trouve en Conrad Gessner (Zurich 1516-1565) son premier texte scientifique suisse. Cette contribution colloque le traité "De Germaniae et Helvetiae thermis" (paru à Venise en 1553) dans le contexte du discours thermal renaissant suisse, italien et allemand. Reference DANZI, Massimo. Gessner balnéologue. In: Leu U.; Ruoss M. Conrad Gessner 1516-2016. Zurich : Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2016. Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:84155 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 Gessner balnéologue Massimo Danzi Conrad Gessner n’est pas particulièrement connu pour son traité sur les ther- mes, qu’il n’a publié qu’une seule fois en 1553 et qui, par rapport à ses autres œuvres, est passé relativement inaperçu dans les monographies le concernant. Le texte du De Germaniae et Helvetiae thermis avec la description des lieux et des eaux curatives illustre, en grande partie, le savoir médical que l’humaniste zurichois exerça jusqu’à devenir, en 1554, « Oberstadtarzt » de la ville de Zurich. Mais tandis que ledit savoir a été relativement bien exploré sur la base de la riche correspondance que Gessner entretint avec ses collègues médecins ainsi que de ses œuvres de médecine pratique, en particulier le Thesaurus de remedi- is secretis publié en 1552 [fig. 46a],1 le traité sur les thermes, paru à Venise l’année suivante dans une grande collection de textes thermaux, n’a pas, dès le début, attiré la même attention. -

Guillaume Postel
Guillaume Postel Few scholars illustrate the conflicting currents of thought which characterised the late Renaissance as clearly as Guillaume Postel, and few carried them to such extremes. On the one hand he was fascinated by esotericism and oddly credulous where apocryphal and spurious texts were concerned. He held firm beliefs in the role of the prophet and the imminence of the millennium preceding the end of the world − beliefs whose roots can be traced back to the Middle Ages and which were deeply affected by the enthusiasm attending the Reformation. He was convinced that France was destined to play a providential part in reforming the Church, and that he himself had a divine mission. This was the stuff of some of the great ‘heretics’ of the time – Giordano Bruno, Francesco Pucci and Tommaso Campanella. Postel’s visionary behaviour led to his expulsion from the Society of Jesus, his incarceration by the Roman Inquisition, and, finally, to his confinement in a lunatic asylum in Paris. On the other hand Postel was a pioneer. He launched the study of Arabic in Europe - as a teacher he had insights into how the language should be tackled which were far ahead of his time – and he was one of the first practitioners of Samaritan and Syriac. He produced some of the earliest works on comparative linguistics. The manuscripts he collected and edited contributed to furthering biblical studies and to creating a critical attitude to the received texts ultimately due to undermine the very roots of the Christian faith. This collection of Postel’s works was assembled over more than a decade and completed shortly before the fifth centenary of his birth. -
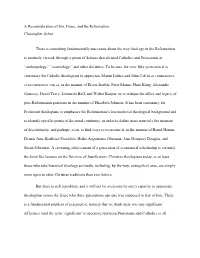
A Reconsideration of Sin, Grace, and the Reformation Christopher Ocker
A Reconsideration of Sin, Grace, and the Reformation Christopher Ocker There is something fundamentally inaccurate about the way theology in the Reformation is routinely viewed: through a prism of debates that divided Catholics and Protestants at “anthropology,” “soteriology,” and other doctrines. To be sure, for over fifty years now it is customary for Catholic theologians to appreciate Martin Luther and John Calvin as constructive, even corrective voices, in the manner of Erwin Iserloh, Peter Manns, Hans Küng, Alexandre Ganoczy, David Tracy, Leonardo Boff, and Walter Kaspar; or to critique the effect and legacy of post-Reformation positions in the manner of Elizabeth Johnson. It has been customary for Protestant theologians to emphasize the Reformation’s late medieval theological background and to identify specific points of doctrinal continuity, in order to define more narrowly the moment of discontinuity, and perhaps, even, to find ways to overcome it, in the manner of Bernd Hamm, Dennis Janz, Karlfried Froehlich, Heiko Augustinus Oberman, Jane Dempsey Douglas, and Susan Schreiner. A crowning achievement of a generation of ecumenical scholarship is certainly the Joint Declaration on the Doctrine of Justification. Christian theologians today, or at least those who take historical theology seriously, including, by the way, evangelical ones, are simply more open to other Christian traditions than ever before. But there is still a problem, and it will not be overcome by one’s capacity to appreciate theologians across the fence who three generations ago one was supposed to fear or hate. There is a fundamental problem of perspective, namely that we think there was any significant difference (and the term ‘significant’ is operative) between Protestants and Catholics at all.