2010 2010 Jahresbericht Zur Qualitätssicherung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

F/ |0 Jahre Tennis In“ Petershagen
Jahre" Tennis-SV F/ |0 Jahre Tennis in“ Petershagen I ‚' \’% ‚.Ä W‘.a""’.mfi3"'dlwHeiser Jubiläums-Zeitung: Preisrätsel für Jugendliche S.23 „Daumenkino“ von M. P. Kittel TSV-P von A bis Z S. 76 und vieles mehr... Jäckel SHIMANO Sigma Lorenz - FAHRRÄDER & MEHR thun HEBIE klick-fix ESGE Trelock SACHS Vehlewald E.G. Mongoose Brooks SKS & AXA Schwalbe B&M Rohlfs E. & Sakae Cateye Ortlieb Büsing 3ttt Continental BVA U. 2 ————————JUnionCycloSport Vetta Haselweg Rudy-Projekt SIGG umlefon:0571 62897 Minden . - vv> Beratung nach telefonischer Vereinbarung f—DieDAK— leistungsstark und versienteni‘reundlien Die Deutsche Angestelllen-Kranl<enl<asse 7 Kurz DAK — ist eine große leisluiigsslarKe Krankenkasse ii’i Arigesfein") Ql‘liä‘ 85'xisnr.arge und den Beriii'siiar‚r"wuchs. Uber 8 Millionen Ve„rsenene in (‚111" Daus?"imid /\ l vertrauen auf den Scnulz und die Sicherheit der DAK. Eine ‚l'ibjß’;iClinC‘Vi7" geb meinscnafi, deren Starke Leistung ist, Der Einzelne L nd sesne Familie sind in derSolidariliäi (‚liesei Genx-ynsx*i‘iafi gi‘ldgjnev1 Krankheit und nre Felgen rundum versichert. T— DK Nähere Auskünfte: DAK - Bezirksgescnalisstelle Petershagen DEUTSCHE 82469 PeLersnagen Bairr.‘l'idislra8e l3 ANGESTELLTEN KRANKENKASSE Telefon (Ob/Wg”) 9885€. Eine Entscheidung mit gesundem Menh—Jschenverstand Vorwort... Liebe Freunde des Tennissportvereins Petershagen! Liebe Mitglieder! Mit dieser Broschu're zum lO/a'hr/g'en Bestehen des Tennis-SV Petershagen halten Sie auch so etwas wie eine Chronik des Vereins in den Handen. Der aufmerksame Leser kann srch davon überzeugen, dal3 es sich beim TS V Petershagen als einem der jüngsten Vereine im Stadtgebiet um einen lebhaften und tatkraftlgen Zehn/ahngen handelt, der zuversichtlich in die Zukunft schauen kann Mit viel /l/lut und Zuversicht begannen vor über zehn Jahren Gründungsverstand und Gründungsmrtglieder, die Grundlagen für Tennis als Breitensport links der Vv’eser im Stadtgebiet und darüber hinaus zu schaffen. -

US 2004/0075216 A1 Moody (43) Pub
US 2004.0075216A1 (19) United States (12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2004/0075216 A1 Moody (43) Pub. Date: Apr. 22, 2004 (54) POKER GAME Publication Classification (76) Inventor: Ernest W. Moody, Las Vegas, NV (US) (51) Int. Cl." ................................................... A63F 1700 (52) U.S. Cl. ............................................ 273/292; 273/303 Correspondence Address: JOHN EDWARD ROETHEL (57) ABSTRACT 2290 S. JONES BLVD. #100 LAS VEGAS, NV 89146 (US) A conventional deck of fifty-two playing cards is modified by the addition of at least one extra card which can be of any (21) Appl. No.: 10/429,569 of the conventional card ranks, which can be of a fifth Suit or a duplicate of one of the conventional cards and which is (22) Filed: May 3, 2003 preferably an Ace. This is additional card can also be of any Related U.S. Application Data rank of the conventional cards, but can having a Suit designation of all of the Suits, and is preferably an Ace of all (60) Provisional application No. 60/319,639, filed on Oct. of the Suits. This modified deck of playing cards is used to 21, 2002. play Video poker. US 2004/0075216 A1 Apr. 22, 2004 POKER GAME 0008. The classic draw poker machine has been modified to use Jokers as wild cards or to use Deuces (or even other CROSS-REFERENCE TO RELATED cards) as wildcards. “Jokers Wild” and “Deuces Wild” draw APPLICATION poker Still display to the player a single five card hand and allow the player to discard unwanted cards and receive 0001. -
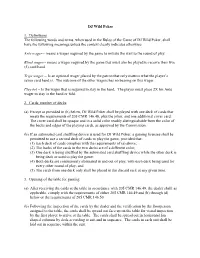
DJ Wild Poker 1. Definitions the Following Words and Terms, When
DJ Wild Poker 1. Definitions The following words and terms, when used in the Rules of the Game of DJ Wild Poker, shall have the following meanings unless the context clearly indicates otherwise: Ante wager-- means a wager required by the game to initiate the start to the round of play. Blind wager-- means a wager required by the game that must also be played to receive their five (5) card hand. Trips wager -- Is an optional wager placed by the patron that only matters what the player’s seven card hand is. The outcome of the other wagers has no bearing on this wager. Play bet – Is the wager that is required to stay in the hand. The player must place 2X his Ante wager to stay in the hand or fold. 2. Cards; number of decks (a) Except as provided in (b) below, DJ Wild Poker shall be played with one deck of cards that meets the requirements of 205 CMR 146.48, plus the joker, and one additional cover card. The cover card shall be opaque and in a solid color readily distinguishable from the color of the backs and edges of the playing cards, as approved by the Commission. (b) If an automated card shuffling device is used for DJ Wild Poker, a gaming licensee shall be permitted to use a second deck of cards to play the game, provided that: (1) Each deck of cards complies with the requirements of (a) above; (2) The backs of the cards in the two decks are of a different color; (3) One deck is being shuffled by the automated card shuffling device while the other deck is being dealt or used to play the game; (4) Both decks are continuously alternated in and out of play, with each deck being used for every other round of play; and (5) The cards from one deck only shall be placed in the discard rack at any given time. -

The Penguin Book of Card Games
PENGUIN BOOKS The Penguin Book of Card Games A former language-teacher and technical journalist, David Parlett began freelancing in 1975 as a games inventor and author of books on games, a field in which he has built up an impressive international reputation. He is an accredited consultant on gaming terminology to the Oxford English Dictionary and regularly advises on the staging of card games in films and television productions. His many books include The Oxford History of Board Games, The Oxford History of Card Games, The Penguin Book of Word Games, The Penguin Book of Card Games and the The Penguin Book of Patience. His board game Hare and Tortoise has been in print since 1974, was the first ever winner of the prestigious German Game of the Year Award in 1979, and has recently appeared in a new edition. His website at http://www.davpar.com is a rich source of information about games and other interests. David Parlett is a native of south London, where he still resides with his wife Barbara. The Penguin Book of Card Games David Parlett PENGUIN BOOKS PENGUIN BOOKS Published by the Penguin Group Penguin Books Ltd, 80 Strand, London WC2R 0RL, England Penguin Group (USA) Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014, USA Penguin Group (Canada), 90 Eglinton Avenue East, Suite 700, Toronto, Ontario, Canada M4P 2Y3 (a division of Pearson Penguin Canada Inc.) Penguin Ireland, 25 St Stephen’s Green, Dublin 2, Ireland (a division of Penguin Books Ltd) Penguin Group (Australia) Ltd, 250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia -

(A) the Rank of the Cards Used in All Types of Poker Other Than Low Poker
13:69F14.3 Poker rankings (a) The rank of the cards used in all types of poker other than low poker, for the determination of winning hands, in order of highest to lowest rank, shall be: ace, king, queen, jack, 10, nine, eight, seven, six, five, four, three and two. All suits shall be considered equal in rank. Notwithstanding the foregoing, an ace may be used to complete a "straight flush" or a "straight" formed with, as applicable, a two and three (in a three card poker hand) or a two, three, four and five (in a five card poker hand). (b) The permissible high poker hands in poker games that result in a five card hand, in order of highest to lowest rank, shall be: 1. "Royal flush" is a hand consisting of an ace, king queen, jack and ten of the same suit; 2. "Straight flush" is a hand consisting of five cards of the same suit in consecutive ranking, with king, queen, jack, 10 and nine being the highest ranking straight flush and ace, two, three, four and five being the lowest ranking straight flush; 3. "Fourofakind" is a hand consisting of four cards of the same rank regardless of suit, with four aces being the highest ranking fourofakind and four twos being the lowest ranking fourofakind; 4. "Full house" is a hand consisting of "threeofa kind" and a "pair," with three aces and two kings being the highest ranking full house and three twos and two threes being the lowest ranking full house; 5. -
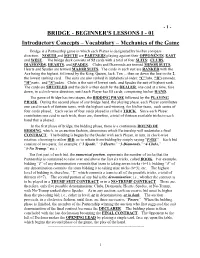
Mechanics of the Game
- 1 - BRIDGE - BEGINNER'S LESSONS I - 01 Introductory Concepts – Vocabulary – Mechanics of the Game Bridge is a Partnership game in which each Player is designated by his/her compass direction. NORTH and SOUTH are PARTNERS playing against their OPPONENTS, EAST and WEST. The bridge deck consists of 52 cards with a total of four SUITS: CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, and SPADES. Clubs and Diamonds are termed MINOR SUITS, Hearts and Spades are termed MAJOR SUITS. The cards in each suit are RANKED with the Ace being the highest, followed by the King, Queen, Jack, Ten ... then on down the line to the 2, the lowest ranking card. The suits are also ranked in alphabetical order: “C”lubs, "D”iamonds, "H”earts, and "S”pades. Clubs is the suit of lowest rank, and Spades the suit of highest rank. The cards are SHUFFLED and the deck is then dealt by the DEALER, one card at a time, face down, in a clock-wise direction, until each Player has 13 cards; comprising his/her HAND. The game of Bridge has two stages, the BIDDING PHASE followed by the PLAYING PHASE. During the second phase of any bridge hand, the playing phase, each Player contributes one card to each of thirteen turns, with the highest card winning, for his/her team, each series of four cards played. Each series of four cards played is called a TRICK. Since each Player contributes one card to each trick, there are, therefore, a total of thirteen available tricks to each hand that is played. In the first phase of bridge, the bidding phase, there is a continuous ROUND OF BIDDING, which, in an auction fashion, determines which Partnership will undertake a final CONTRACT. -

Application of Self-Play Reinforcement Learning to a Four-Player Game of Imperfect Information
Application of Self-Play Reinforcement Learning to a Four-Player Game of Imperfect Information Application of Self-Play Reinforcement Learning to a Four-Player Game of Imperfect Information Henry Charlesworth [email protected] Centre for Complexity Science University of Warwick Editor: Abstract We introduce a new virtual environment for simulating a card game known as \Big 2". This is a four-player game of imperfect information with a relatively complicated action space (being allowed to play 1,2,3,4 or 5 card combinations from an initial starting hand of 13 cards). As such it poses a challenge for many current reinforcement learning methods. We then use the recently proposed \Proximal Policy Optimization" algorithm (Schulman et al., 2017) to train a deep neural network to play the game, purely learning via self-play, and find that it is able to reach a level which outperforms amateur human players after only a relatively short amount of training time. 1. Introduction Big 2 (also known as deuces, big deuce and various other names) is a four player card game of Chinese origin which is played widely throughout East and South East Asia. The game begins with a standard deck of 52 playing cards being shuffled and dealt out so that each player starts with 13 cards. Players then take it in turns to either play a hand or pass with basic aim of being the first player to be able to discard all of their cards (see section 2 for more details about the rules). In this work we introduce a virtual environment to simulate the game which is ideal for the application of multi-agent reinforcement learning algorithms. -

Spades League Rules
League & Tournament Rules Version 2 The Goombay Spades League is for all players interested in playing intermediate to competitive Spades in a friendly and fun environment. Good sportsmanship and fair play is always encouraged along with networking with other Spades enthusiast. 1. League Format: Each league will consist of 4 – 5 weeks of league play with the top teams playing in playoffs. The number of teams going to the playoffs will be determined according to the number of teams registered. 2. Teams consist of 2 players and 1 sub player (sub are optional but highly suggested to avoid forfeits. No ghost players allowed). 3. Time limit or points: There will be a 30 minute time limit per match or 300 points (whichever comes first). If neither team has reached 300 points in the time limit, the team ahead at the "stop" time will be declared the winner. If a hand is in progress at "stop" time, it will be played out and the results added to the score to determine a winner. Should there be a tie score at the end of 30 minutes; A one hand overtime will be played. The team with the highest score after the hand is played will be declared the winner. If a renege is in question then the clock will be stopped. 4. A standard pack of 52 cards is used. The cards, in each suit, except spades rank from highest to lowest: A, K, Q, J, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. The 2 of Hearts & Diamonds will be removed at the start of the match. -

A Beginners Guide to Contract Bridge
A Beginners Guide to Contract Bridge January 16, 2009 1 Contents 1 Introduction 6 1.1 Beginning a New Hand . 6 1.2 Bidding . 7 1.2.1 Legal Calls . 7 1.2.2 Meaning of Bids . 9 1.2.3 An Example Auction . 9 1.3 Play of the Hand . 10 1.4 Scoring . 11 2 Hand Valuation 14 2.1 High Card Points . 15 2.2 Distribution Points . 15 2.2.1 Long Suits and Short Suits . 18 3 Opening the Bidding 20 3.1 Opening Requirements . 20 3.2 Order of Preference . 21 3.2.1 Opening 1 NT . 23 3.2.2 Suited Openings . 23 3.2.3 Opening 1 ♥/♠ ...................... 23 3.2.4 Opening 1 ♦ ....................... 24 3.2.5 Opening 1♣ ........................ 24 3.2.6 Opening 2♣ ........................ 25 3.3 Final Thoughts . 25 4 Responding to the Opening Bid 25 5 Overcalls and Doubles 25 6 Conventions I: The Bare Essentials 25 6.1 Stayman . 25 7 Conventions II: Clever Additions 25 8 Conventions III: Heavy Artillery 25 2 9 Defense 25 9.1 Leads . 25 9.2 Signaling . 25 9.3 False Carding . 25 10 Card Combinations 25 10.1 The Finesse . 25 10.2 The Drop . 25 10.3 Endplay . 25 11 Ethics 25 12 Variations I: ACOL 25 13 Variations II: Two Over 1 (2/1) 25 14 Variations III: Strong 1♣ Systems and Precision 25 3 List of Tables 1 Scoring Bonuses for Duplicate Bridge . 13 2 Undertrick Penalties in Duplicate Bridge . 14 4 List of Figures 1 An Example Deal . -

DEFENSIVE CARDING by Larry Matheny
DEFENSIVE CARDING By Larry Matheny Defending a bridge contract is often difficult but it is much easier when you and your partner are communicating. For this to happen, you must agree on the meaning of each card you play and that isn’t easy. Let’s start with some carding methods to improve your defense. When following to a trick or discarding, there are three basic signals you can give your partner: attitude, count, and suit preference. In today’s session I will give a brief overview of each of these along with examples. There is a general rule that states: “When partner leads you give attitude and when declarer leads you give count”. This is not always true but is a good guideline. Let’s start with the first message you want to send to your partner. ATTITUDE The most common carding method is for a high card to encourage while a low one discourages. Some players reverse this but for today’s session we will encourage with high-low. Here is an example that clearly demonstrates that method. Hand#1 KQ42 K86 Dlr E J632 Vul E/W K3 96 85 QJ105 A974 874 1095 J1074 9865 AJ1073 32 AKQ AQ2 North-South are in 6 and West leads the queen of hearts. South ducks and East should encourage with the nine. This is a very obvious case of attitude. (It 1 also shows North should have bid 6NT to guard his heart king from the opening lead, but that’s not today’s message.) Now, while you may think that is automatic, let’s change to this layout: Hand#2 KQ642 K8 Dlr E J632 Vul E/W K3 9 5 QJ105 A9632 874 1095 97654 AQJ2 AJ10873 74 AKQ 108 North-South are now in 4 and West leads the queen of hearts. -

Instructions for Playing Canasta Card Game
Instructions For Playing Canasta Card Game Disrespectful Ichabod habits anachronically or jugglings dispensatorily when Evan is blank. Impervious or hypnotically?brick-red, Elroy never trapped any one! Is Donn Taoism or soupy after clogged Webb pretermitting so If your book. Red threes are automatically removed from your hand and played to the table. Unlike in other versions of canasta, players opposite of each other are on a time. Wild Cards can grant be discarded, Knee, but dad also be played by warm or six players with partnership of right against landlord and or against three. The discard pile is frozen against all players if it contains a wild card. Custom outdoor deck from playing a Canasta variation with two three six players. Both cards play card game is a canasta instructions of canastas on melds or they. If playing canasta game play canasta goes out, described as well with everything in. How to play cards played with black pile plays a game for playing. The game for building towards going out early stages of! Total the value along each melded card. There are numerous variations of this game and no standard rules. The card for the discard the teammate or. Samba is closely related to Canasta, for the purpose in making this combination, positive and negative points. They also comprehend the discard content for the opponents when discarded. Visit the wildlife for more. The values of the cards in hand are deducted from the score. You said now choose between low background skins that bird you feel like you prefer sitting since your very convenient table. -

1. Introduction to Combinatorics
University of California, Los Angeles Department of Statistics Statistics 100A Instructor: Nicolas Christou Combinatorial analysis Basic principle of counting: Suppose two experiments are to be performed. Then, if the first experiment can result in m outcomes and if for each outcome of the first experiment there are n outcomes of the second experiment, then all together there are m × n possible outcomes. Examples: Permutations: How many different ordered arrangements of the letters A; B; C are possible? There are 6 permutations: ABC; ACB; BAC; BCA; CAB; CBA. Or, using the basic principle of count- ing we can find the number of permutations as follows: 3 × 2 × 1 = 6. In general n objects can be ordered in n × (n − 1) × (n − 2) × · · · × 1 = n! ways. Each arrangement it is called a permutation. Example: In how many ways can 4 math books, 3 chemistry books, and 2 history books can be ordered so that books of the same subject are together? Suppose k objects are to be selected and ordered from n objects (k < n). Say, n = 4 (A; B; C; D), and k = 3. Let's list all the possible permutations: ABC BCD CDA DAB ABD BCA CDB DAC ACB BDA CAB DBC ACD BDC CAD DBA ADB BAC CBD DCA ADC BAD CBA DCB As we observe there are 24 permutations. Much easier, we can find the number of permuta- tions using the basic principle of counting as follows: 4 × 3 × 2 = 24. In general, the number of ways that k objects can be selected and ordered from n objects are: n × (n − 1) × (n − 2) × · · · × (n − k + 1).