Glockenatlas Glockenatlas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
Karte Der Wahlkreise Für Die Wahl Zum 19. Deutschen Bundestag
Karte der Wahlkreise für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag gemäß Anlage zu § 2 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes, die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Mai 2016 (BGBl. I S. 1062) geändert worden ist Nordfriesland Flensburg 1 Schleswig- Flensburg 2 5 4 Kiel 9 Rendsburg- Plön Rostock 15 Vorpommern- Eckernförde 6 Dithmarschen Rügen Ostholstein Grenze der Bundesrepublik Deutschland und der Länder Neu- 14 münster Grenze Kreise/Kreisfreie Städte 3 16 Segeberg Steinburg 8 Lübeck Nordwestmecklenburg Rostock Wahlkreisgrenze 11 17 Wahlkreisgrenze 29 Stormarn (auch Kreisgrenze) 7 Vorpommern- Cuxhaven Pinneberg Greifswald Schwerin Wittmund Herzogtum Wilhelms- Lauenburg 26 haven Bremer- 18-23 13 Stade Hamburg Mecklenburgische Saalekreis Kreisname haven 12 24 10 Seenplatte Aurich Halle (Saale) Kreisfreie Stadt Friesland 30 Emden Ludwigslust- Wesermarsch Rotenburg Parchim (Wümme) 36 Uckermark Harburg Lüneburg 72 Wahlkreisnummer Leer Ammerland Osterholz 57 27 Oldenburg (Oldenburg) Prignitz Bremen Gebietsstand der Verwaltungsgrenzen: 29.02.2016 55 35 37 54 Delmen- Lüchow- Ostprignitz- 28 horst 34 Ruppin Heidekreis Dannenberg Oldenburg Uelzen Oberhavel 25 Verden 56 58 Barnim 32 Cloppenburg 44 66 Märkisch- Diepholz Stendal Oderland Vechta 33 Celle Altmarkkreis Emsland Gifhorn Salzwedel Havelland 59 Nienburg 31 75-86 Osnabrück (Weser) Grafschaft 51 Berlin Bentheim 38 Region 43 45 Hannover Potsdam Brandenburg Frankfurt a.d.Havel 63 Wolfsburg (Oder) 134 61 41-42 Oder- Minden- 40 Spree Lübbecke Peine Braun- Börde Jerichower 60 Osnabrück Schaumburg -
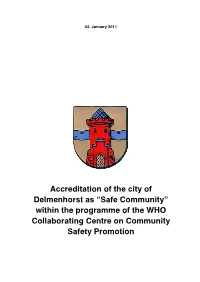
Accreditation of the City of Delmenhorst As “Safe Community” Within the Programme of the WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion
24. January 2011 Accreditation of the city of Delmenhorst as “Safe Community” within the programme of the WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Impressum Accreditation of the city of Delmenhorst as “Safe Community” of the WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion Editor: The registered association Infantile Health (GiK e.V.), Delmenhorst City of Delmenhorst Editorial staff: Dr. Johann Böhmann, Dr. Birgit Warwas-Pulina, Andreas Kampe, Stella Buick Contact: Dr. Johann Böhmann, head physician of the paediatric clinic of Delmenhorst, Wildeshauser Str. 92, 27753 Delmenhorst Peter Betten, coordinator of the round table “Injury prevention”, city of Delmenhorst, Service 3 Delmenhorst, January 2011 II Preface Road traffic or household injuries, violence against women, children or dissidents cause damage to each individual and to the community, which cannot be accepted. Therefore prevention is very important in the community of Delmenhorst. The city of Delmenhorst has undertaken the task of avoiding injuries caused by accidents and violence by means of systematic precaution as far as possible. A successful prevention is the precondition for a cross-departmental and systematical approach. The prevention must not only include the reaction to the current occurrences, but must also include a comprehensive and systematic long-term, active strategy. With the report on hand “accreditation of the city of Delmenhorst as safe community” the community of Delmenhorst applies for the acceptance to the international network of the “Safe Communities”. The stakeholders in Delmenhorst would like to learn from the experiences of other countries and they want to provide the international community with their knowledge regarding prevention. Patrick de La Lanne Mayor of the city of Delmenhorst III Content 1 Introduction......................................................................................................... -
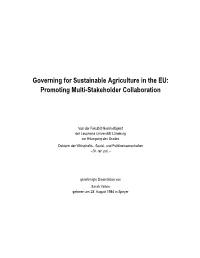
Governing for Sustainable Agriculture in the EU: Promoting Multi-Stakeholder Collaboration
Governing for Sustainable Agriculture in the EU: Promoting Multi-Stakeholder Collaboration Von der Fakultät Nachhaltigkeit der Leuphana Universität Lüneburg zur Erlangung des Grades Doktorin der Wirtschafts-, Sozial- und Politikwissenschaften - Dr. rer. pol. - genehmigte Dissertation von Sarah Velten geboren am 28. August 1984 in Speyer Eingereicht am: 28. Januar 2019 Mündliche Verteidigung (Disputation) am: 27. März 2019 Erstbetreuer und –gutachter: Prof. Dr. Jens Newig Zweitgutachterin: Prof. Dr. Julia Leventon Drittgutachterin: Prof. Dr. Dr. Martina Schäfer Die einzelnen Beiträge des kumulativen Dissertationsvorhabens sind oder werden ggf. inkl. des Rahmen- papiers wie folgt veröffentlicht: Leventon, J., Schaal, T., Velten, S., Dänhardt, J., Fischer, J., Abson, D.J., Newig, J., 2017. Collaboration or fragmentation? Biodiversity management through the common agricultural policy. Land Use Policy 64, 1– 12. Leventon, J., Schaal, T., Velten, S., Fischer, J., Newig, J., 2019. Landscape Scale Biodiversity Governance: Scenarios for reshaping spaces of governance. Environmental Policy and Governance 46 (1), 1-15. Velten, S., Leventon, J., Jager, N.W., Newig, J., 2015. What is sustainable agriculture? - A systematic re- view. Sustainability 7 (6), 7833–7865. Velten, S., Schaal, T., Leventon, J., Hanspach, J., Newig, J., Fischer, J, 2018. Rethinking biodiversity gov- ernance in European agricultural landscapes: Acceptability of alternative governance scenarios. Land Use Policy 77, 84-93. Velten, S., Jager, N., Newig, J., forthcoming. Success -

Praxisbörse Fakultät I 10
Kontakt Career Service Melanie Kruse Fon 04441.15 321 E-Mail [email protected] In Zusammenarbeit mit den Praktikumsbeauftragten der Fakultät I Praxisbörse Fakultät I 10. April 2019 I 13.00 bis 16.00 Uhr Ausstellerkatalog Foto Titeseite: pixabay.com Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis Seite Seite Aussteller und Angebote im Überblick Aussteller und Angebote im Überblick Landkreis Vechta Bremerhaven Arbeitsagentur Vechta 4 Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Bremerhaven 29 Akademie Überlingen N. Glasmeyer GmbH 5 Landkreis Cloppenburg Andreaswerk Vechta e. V. 6 Sozialdienst kath. Frauen e.V. 30 BDKJ, Landesverband Oldenburg 7 STEP gGmbH Drobs Cloppenburg 31 Diakonisches Werk Oldenburger Münsterland 8 VITA Akademie GmbH 32 Ev. Kinderdorf Johannesstift e.V. 9 Landkreis Delmenhorst Freiwilligenbörse „Ehrensache“ - Ehrenamtsarbeit 10 Ambulanter Justizsozialdienst Niedersachsen 65 Freiwilligenbörse „Ehrensache“ - Wohnberatung 11 BBS II Kerschensteiner Schule Delmenhorst 33 Kreisvolkshochschule Vechta 64 Diakonisches Werk Delmenhorst/Oldenburg-Land e.V. 34 Landkreis Vechta 12 Plan A gGmbH 35 Landkreis Vechta Jugendamt 13 Stadt Delmenhorst 36 Lohner Jugendtreff e. V. 14 Landkreis Diepholz Malteser Hilfsdienst e. V. 15 Arbeiter-Samariter-Bund Diepholz 37 St. Anna Stiftung Dinklage 16 Lebenshilfe Syke 38 St. Hedwig-Stiftung Vechta 17 Orientierung Leben Entwicklung e.V. 39 Stiftung Maria Rast 18 VNB e.V. 40 VIFF e.V. Das Vechtaer Institut für Forschungsförderung 19 Emsland VSL e.V. 20 Jugendbildungsstätte Marstall Clemenswerth 41 Wohngruppe -

Wahlergebnis 2019
Wahlen BVN 2019 - Ergebnisliste Präsidium Präsidium Neuwahl Innung Bau-Innung Osnabrück Stadt Präsident Staub, Christian und Land Bau- u. Zimmerer-Innung Vizepräsident Hoffmeister, Karl Hildesheim-Alfeld Straßenbauer-Innung Vizepräsident Ohland, Edgar Lüneburg Vizepräsident Wiebe, Karsten Baugewerken-Innung Celle Innung des Bauhandwerks Vizepräsident Schwarze, Dieter Süd-Ost-Niedersachsen Bezirksbeisitzer Bezirk Neuwahl Innung Baugewerbe-Innung Leer- Ostfriesland de Vries, Heiko Rheiderland Innung des Bauhandw. Region Braunschweig Wendland, Stephan Braunschw.-Braunschw.-Peine Innung des Bauhandwerks Hannover Richert, Klaus-Gernot Hannover Hildesheim Langheim, Lutz Zimmerer-Innung Northeim Zimmerer-Innung Gifhorn- Lüneburg Kaiser, Christian Wittingen-Wolfsburg Baugewerken-Innung Oldenburg Ranke, Rolf Delmenhorst/Oldenburg-Land Bau-Innung Osnabrück Stadt Osnabrück Otterbach, Christian und Land Zimmerer-Innung Rotenburg Stade Cordes, Ulf (Wümme) Fachgruppenleiter Fachgruppe Neuwahl Innung Bau-Innung Hochbau Frölich, Christian Südniedersachsen Bau-u. Zimmerer-Innung Zimmerer Hoffmeister, Karl Hildesheim-Alfeld Straßenbauer-Innung Straßenbau Ohland, Edgar Lüneburg Ausbau und Fassade Germerott, Wolfgang Stukkateur-Innung Hannover Bau-Innung Feuerungsbau Ehbrecht jun., Alois Südniedersachsen Fliesen- u. Natursteinleger Fliesen Dipp, Rolf Innung Braunschweig Estrich- u. Bodenleger- Estrich Perlmann, Frank-Alexander Innung Celle Betonstein Jagemann, Bernward Einzelmitglied Brunnenbau Kessing, Martin Maurer-Innung Vechta WKSB Semrau, Christian -

Kindergärten / Spielkreise Der Ev.-Luth. Kirche Oldenburg
Kindergärten / Spielkreise der Ev.-Luth. Kirche Oldenburg 19 Kirchenkreis WESERMARSCH Kirchenkreis FRIESLAND-WILHELMSHAVEN 46 Kindergarten Altenesch 56 Kindergarten Jaderberg 47 Kindergarten Bardewisch 57 Kindergarten Nordenham 01 Kindergarten Altengroden 48 Kinderspielkreis Berne 58 Kindergarten Ovelgönne 02 Kindergarten Bant I 49 Kindergarten Blexen 59 Kindergarten Stollhamm 03 Kindergarten Bant II FRIESLAND-WILHELMSHAVEN 50 Kindergarten Brake 60 Kindergarten Strückhausen 04 Kindergarten Bockhorn 51 Kindergarten Burhave 61 Kindergarten Tossens 05 Kindergarten F‘groden, Regenbogen 52 Kindergarten Dedesdorf 62 Kindergarten Lemwerder 06 Kindergarten Heppens 53 Kindergarten Ueterlande 63 Kindergarten Moorriem 07 Kindergarten Jever, Lindenallee 54 Kindergarten Elsfl eth 64 Kindergarten Waddens 08 Kindergarten Jever, Ammerländer Weg 55 Kindergarten Großenmeer 09 Kindergarten Jever, Klein Grashaus 10 Kindergarten Neuende 18 11 Kindergarten Neuengroden, Thomaskirche 12 Kindergarten Sande 7 13 Kindergarten Heidmühle 8 9 5 61 51 14 Kindergarten Roffhausen 1 15 Kindergarten Varel 11 64 16 Kindergarten Dangastermoor 17 Kindergarten Obenstrohe 13 10 6 18 Kindergarten Voslapp 14 21 2 WESERMARSCH 19 Kindergarten Wangerooge 3 20 59 20 Christus-Kindergarten Wilhelmshaven 49 21 Kindergarten Wilhelmshaven, Inselviertel 12 57 22 Kindergarten Zetel 53 52 Kirchenkreis OLDENBURG STADT 65 Kindergarten Bloherfelder Straße 22 66 Kindergarten Edewechter Landstraße 16 67 Kindergarten Nikolaikirchweg 15 68 Kindergarten Heidkamp 4 17 69 Kindergarten Metjendorf 70 Kindergarten Ofen 71 Kindergarten Ofenerdiek, Langenweg 72 Kindergarten Ofenerdiek, Am Alexanderhaus 73 Kindergarten Bürgerstraße 74 Kindergarten Etzhorn 75 Kindergarten Donarstraße 56 60 58 76 Kindergarten Großer Kuhlenweg 55 50 77 Kindergarten Hartenkamp 78 Kindergarten von-Berger-Straße 79 Kindergarten Blumenstraße 80 Kindergarten Eupener Straße 81 Kindergarten Schützenweg 36 82 Kindergarten Schulweg 34 83 Kindergarten Ekkardstraße 84 Kindergarten Heimeck AMMERLAND 85 Kindergarten Helmsweg 86 Kindergarten St. -

Wahlergebnisse 2016 Präsidium Bezirksbeisitzer
Wahlergebnisse 2016 Präsidium Präsidium Neuwahl Innung __________ Präsident Staub, Christian Baugewerbe-Innung Osnabrück Vizepräsident Hoffmeister, Karl Bau- u. Zimmerer-Innung Hildesheim-Alfeld Vizepräsident Ohland, Edgar Straßenbauer-Innung Lüneburg Vizepräsident Lorenz, Rainer Innung des Bauhandwerks Hannover Vizepräsident Schwarze, Dieter Innung des Bauhandwerks Süd-Ost-Niedersachsen Bezirksbeisitzer Bezirk Neuwahl Innung __________ Ostfriesland de Vries, Heiko Baugewerbe-Innung Leer-Rheiderland Braunschweig Wendland, Stephan Innung des Bauhandwerks Region Braunschweig-Braunschweig-Peine Hannover Kaiser, Jens Zimmerer-Innung Hannover Hildesheim Langheim, Lutz Zimmerer-Innung Northeim Lüneburg Kaiser, Christian Zimmerer-Innung Gifhorn-Wittingen-Wolfsburg Oldenburg Ranke, Rolf Baugewerken-Innung Delmenhorst/Oldenburg-Land Osnabrück Ehrenbrink, Heinrich Baugewerbe-Innung Osnabrück Stade Cordes, Ulf Zimmerer-Innung Rotenburg (Wümme) 1 Wahlergebnisse 2016 Fachgruppenleiter Fachgruppe Neuwahl Innung______________ Hochbau Richert, Innung des Bauhandwerks Hannover Klaus-Gernot Zimmerer Hoffmeister, Karl Bau- u. Zimmerer-Innung Hildesheim-Alfeld Straßenbau Ohland, Edgar Straßenbauer-Innung Lüneburg Ausbau und Germerott, Stukkateur-Innung Hannover Fassade Wolfgang Feuerungsbau Ehbrecht, Alois Bau-Innung Südniedersachsen Fliesen Dipp, Rolf Fliesen- u. Natursteinleger Innung Braunschweig Estrich Perlmann, Estrich- und Bodenleger-Innung Celle Frank-Alexander Betonstein Jagemann, Einzelmitglied Bernward Brunnenbau Escolar, Rudolf Baugewerken-Innung -

Final Berichtsheft JWH Mit Umschlagsseiten
Gründungskreistag am 30. Juni 2018 in Spohle Inhaltsverzeichnis Seite 1. Tagesordnung 2 2. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten 3 3. Der Weg zum Fußballkreis Jade-Weser-Hunte 6 - Von den ersten Gesprächen bis zur Fusion 7 - Absichtserklärung zum Zusammenschluss der Fußballkreise 13 - Fusionsvertrag 14 4. Der Fußballkreis Jade-Weser-Hunte stellt sich vor 16 - Der neue Fußballkreis und seine Regionen 17 - Zahlen und Entwicklungstendenzen aus dem heimischen Fußball 20 5. Historie zu den bisherigen Fußballkreisen 24 - Ammerland 25 - Friesland 34 - Oldenburg-Stadt 43 - Wesermarsch 53 - Wilhelmshaven 62 6. Wahlvorschlagsliste NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte 71 - Wahlvorschlag geschäftsführender Vorstand 72 - Wahlvorschlag Vorsitzende der Ausschüsse 73 - Wahlvorschlag Mitarbeiter 74 7. Haushalt 2019 NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte 78 - 1 - 1. Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 2. Grußworte der Gäste 3. Wahl eines Versammlungsleiters 4. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten 5. Wahl des 1. Vorsitzenden 6. Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder, der Mitglieder der Ausschüsse, Sportgerichte und der Rechnungsprüfer 7. Genehmigung des Haushaltsplans 2019 8. Anträge 9. Verschiedenes - 2 - 2. Feststellung der stimmberechtigten Delegierten Stimmrecht: Gemäß § 48 der Verbandssatzung hat jeder Verein einen stimmberechtigten Delegierten. Jeder Delegierte erhält neben einer Grundstimme für jede spielende Mannschaft nach dem Stand vom 01.01.2018 eine weitere Stimme. Spielgemeinschaften werden dem erstgenannten federführenden Verein zugerechnet. -

Aach Aach, Stadt Aachen, Stadt Aalen, Stadt Aarbergen Aasbüttel
Die im Folgenden aufgeführten Gemeinden (oder entsprechenden kommunalen Verwaltungen) sind mit dem jeweiligen teilnehmenden Land (Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) als die Liste der in Betracht kommenden Einrichtungen vereinbart worden und können sich für das WiFi4EU-Programm bewerben. „Gemeindeverbände“, sofern sie für jedes Land festgelegt und nachstehend aufgeführt sind, können sich im Namen ihrer Mitgliedsgemeinden registrieren, müssen den endgültigen Antrag jedoch für jede Gemeinde in ihrer Registrierung einzeln online einreichen. Jeder Gutschein wird an eine einzelne Gemeinde als Antragsteller vergeben. Während der gesamten Laufzeit der Initiative kann jede Gemeinde nur einen einzigen Gutschein einsetzen. Daher dürfen Gemeinden, die im Rahmen einer Aufforderung für einen Gutschein ausgewählt wurden, bei weiteren Aufforderungen nicht mehr mitmachen, wohingegen sich Gemeinden, die einen Antrag gestellt, aber keinen Gutschein erhalten haben, in einer späteren Runde wieder bewerben können. Gemeinden (oder entsprechende kommunale Verwaltungen) Aach Adelshofen (Fürstenfeldbruck) Aach, Stadt Adelshofen (Ansbach, Landkreis) Aachen, Stadt Adelsried Aalen, Stadt Adelzhausen Aarbergen Adenau, Stadt Aasbüttel Adenbach Abenberg, St Adenbüttel Abensberg, St Adendorf Abentheuer Adlkofen Absberg, M Admannshagen-Bargeshagen Abstatt Adorf/Vogtl., Stadt Abtsbessingen Aebtissinwisch Abtsgmünd Aerzen, Flecken Abtsteinach Affalterbach Abtswind, M Affing Abtweiler Affinghausen Achberg Affler Achern, Stadt Agathenburg Achim, Stadt -

Kontakt Bewilligungsstellen Der LWK Niedersachsen
Zuständige dezentrale Bewilligungsstelle der Landwirtschaftskammer Niedersachsen für die Bearbeitung der Anträge auf Förderung „Mehrjähriger Wildpflanzenanbau“ Registriernummer /Landkreise Adresse Kontakt 402 Emden Landwirtschaftskammer Telefon 452 Aurich Niedersachsen 04941 921-274 457 Leer Bewilligungsstelle Fax 462 Wittmund Aurich 04941 921228 Weddigenstraße 1 a E-Mail 26582 Aurich bwst.aurich@lwk- niedersachsen.de 101 Braunschweig Landwirtschaftskammer Telefon 151 Gifhorn Niedersachsen 0531 28997-600 153 Goslar Bewilligungsstelle Fax 154 Helmstedt Braunschweig 0531 2899799600 157 Peine Helene Künne-Allee 5 E-Mail 102 Salzgitter 38122 Braunschweig bwst.braunschweig@lwk- 158 Wolfenbüttel niedersachsen.de 103 Wolfsburg 352 Cuxhaven Landwirtschaftskammer Telefon 356 Osterholz Niedersachsen 04761 9942-220 357 Rotenburg Bewilligungsstelle Fax 359 Stade Bremervörde 04761 994299200 011 Bremen (Stadt) Albrecht-Thaer Str. 6 A E-Mail 012 Bremerhaven (Stadt) 27432 Bremervörde bwst.bremervoerde@lwk- niedersachsen.de 152 Göttingen Landwirtschaftskammer Telefon 155 Northeim Niedersachsen 05551 6004-225 156 Osterode am Harz Bewilligungsstelle Fax 159 Göttingen (neu) Northeim 05551 6004228 254 Hildesheim Wallstraße 44 E-Mail 37154 Northeim bwst.northeim@lwk- niedersachsen.de 201 Hannover (Stadt) Landwirtschaftskammer Telefon 252 Hameln Niedersachsen 0511 3665-1405 253 Hannover (Land) Bewilligungsstelle Fax 255 Holzminden Hannover 0511 36651561 257 Schaumburg Postanschrift E-Mail Wunstorfer Landstraße 7a bwst.hannover@lwk- 30453 Hannover niedersachsen.de -

Zum Download Der Liste Der Anerkannten Betreuungsvereine
anerkannte Betreuungsvereine in Niedersachsen Kontakt Standort Institut für Persönliche Hilfen e.V. www.iph-braunschweig.de Braunschweig www.die-betreuungsvereine.de Albert-Schweitzer Familienwerk e.V. - Betreuungsverein für den Bereich der Stadt Göttingen https://familienwerk.info/ (Homepage des Trägers) Göttingen Stadt www.die-betreuungsvereine.de Albert-Schweitzer Familienwerk e.V. - Betreuungsverein für den Bereich des Landkreises Göttingen https://familienwerk.info/ (Homepage des Trägers) Göttingen Landkreis www.die-betreuungsvereine.de Albert-Schweitzer Familienwerk e.V. - Betreuungsverein für den Bereich des Landkreises Northeim https://familienwerk.info/ (Homepage des Trägers) Northeim Peiner Betreuungsverein e.V. www.peiner-btv.de Peine Wolfsburger Betreuungsverein e.V. www.wob-bv.de Wolfsburg Betreuungsverein Salzgitter e.V. www.btv-sz.de Salzgitter Institut für transkulturelle Betreuung (Betreuungsverein) e. V. - Außenstelle Braunschweig www.itb-ev.de Braunschweig Gifhorner Betreuungsverein e.V. www.gifhorner-btv.de Gifhorn Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Region Harz e.V. www.awo-region-harz.de Goslar, Langelsheim, Münchehof Persönliche Hilfen e.V. www.phv-diepholz.de Diepholz Betreuungsverein Hameln-Pyrmont e.V. www.btv-hameln.de Hameln Betreuungsverein der Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. www.awo-hannover.de/unsere-angebote/beratung-betreuung/gesetzliche-betreuung/ Hannover Sozialdienst katholischer Frauen e.V. www.skf-hannover.de Hannover Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. www.awo-hannover.de/unsere-angebote/beratung-betreuung/gesetzliche-betreuung/ Hannover Institut für transkulturelle Betreuung www.itb-ev.de Hannover Betreuungsverein Hildesheim e.V. www.betreuungsverein-hildesheim.de Hildesheim Betreuungsverein Nienburg e.V. www.betreuungsverein-nienburg.de Nienburg Betreuungsverein Schaumburg e.V. www.betreuungsverein-schaumburg.de Schaumburg Freundeskreis Betreuungsverein e.V. www.freundeskreis-betreuungsverein.de Wunsdorf Lebenshilfe Betreuungsverein Wunstorf e.V. -

List of Supervised Entities
List of supervised entities Cut-off date for significance decisions: 1 July 2017 Number of significant supervised entities: 120 A. List of significant supervised entities Belgium 1 Investeringsmaatschappij Argenta nv Size (total assets EUR 30 - 50 bn) Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Belgium Argenta Spaarbank NV Belgium 2 AXA Bank Belgium SA Size (total assets EUR 30-50 bn) AXA Bank Europe SCF France 3 Banque Degroof Petercam SA Significant cross-border assets Banque Degroof Petercam France S.A. France Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. Luxembourg Bank Degroof Petercam Spain, S.A. Spain 4 Belfius Banque S.A. Size (total assets EUR 150-300 bn) 5 Dexia NV Size (total assets EUR 150-300 bn) Dexia Crédit Local France Dexia Kommunalbank Deutschland AG Germany Dexia Crediop S.p.A. Italy 6 KBC Group N.V. Size (total assets EUR 150-300 bn) KBC Bank N.V. Belgium CBC Banque SA Belgium KBC Bank Ireland plc Ireland Československá obchodná banka, a.s. Slovakia ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Slovakia 7 The Bank of New York Mellon S.A. Size (total assets EUR 30-50 bn) Germany 8 Aareal Bank AG Size (total assets EUR 50-75 bn) 9 Bayerische Landesbank Size (total assets EUR 150-300 bn) Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Germany 10 COMMERZBANK Aktiengesellschaft Size (total assets EUR 500-1,000 bn) European Bank for Financial Services GmbH (ebase) Germany comdirect bank AG Germany Commerzbank Finance & Covered Bond S.A. Luxembourg mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Slovakia (branch) 11 DekaBank Deutsche Girozentrale Size (total assets EUR 100-125 bn) DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.