Empfindungsfähigkeit Und Moralischer Status Eine Kritik Der Pathozentrischen Ethik
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Haecceitism, Chance
HAECCEITISM, CHANCE, AND COUNTERFACTUALS Boris Kment Abstract. Anti-haecceitists believe that all facts about specific individuals—such as the fact that Fred exists, or that Katie is tall—globally supervene on purely qualitative facts. Haecceitists deny that. The issue is not only of interest in itself, but receives additional importance from its intimate connection to the question of whether all fundamental facts are qualitative or whether they include facts about which specific individuals there are and how qualitative properties and relations are distributed over them. Those who think that all fundamental facts are qualitative are arguably committed to anti-haecceitism. The goal of this paper is to point out some problems for anti-haecceitism (and therefore for the thesis that all fundamental facts are qualitative). The article focuses on two common assumptions about possible worlds: (i) Sets of possible worlds are the bearers of objective physical chance. (ii) Counterfactual conditionals can be defined by appeal to a relation of closeness between possible worlds. The essay tries to show that absurd consequences ensue if either of these assumptions is combined with anti-haecceitism. Then it considers a natural response by the anti-haecceitist, which is to deny that worlds play the role described in (i) and (ii). Instead, the reply continues, we can introduce a new set of entities that are defined in terms of worlds and that behave the way worlds do on the haecceitist position. That allows the anti-haecceitist to formulate anti-haecceitist friendly versions of (i) and (ii) by replacing the appeal to possible worlds with reference to the newly introduced entities. -

Dialectic at a Moving Standstill: the Neurotic Midadventures Of
Macalester Journal of Philosophy Volume 13 Article 6 Issue 1 Spring 2004 5-1-2004 Dialectic at a Moving Standstill: The eurN otic Midadventures of Philosphy of Mind Dan Ganin Macalester College Follow this and additional works at: http://digitalcommons.macalester.edu/philo Recommended Citation Ganin, Dan (2004) "Dialectic at a Moving Standstill: The eN urotic Midadventures of Philosphy of Mind," Macalester Journal of Philosophy: Vol. 13: Iss. 1, Article 6. Available at: http://digitalcommons.macalester.edu/philo/vol13/iss1/6 This Article is brought to you for free and open access by the Philosophy Department at DigitalCommons@Macalester College. It has been accepted for inclusion in Macalester Journal of Philosophy by an authorized administrator of DigitalCommons@Macalester College. For more information, please contact [email protected]. Dialectic at a Moving Standstill: The Neurotic Misadventures of Philosophy of Mind Dan Ganin Introduction Relatively recently, numerous philosophers of mind have espoused the epistemic intractability and impenetrability of both the mind-body problem and the problem of consciousness. While past and present attempts to theoretically resolve and circumvent these metaphysical questions have assumed many forms and postulated numerous conceptual paradigms (substance dualism, property dualism, eliminative materi alism, functionalism, mind- body identity theory, logical behaviorism, idealism, etc.), the fundamental problem of epistemic inexplicability has not substantially dissipated since the rationalist ruminations of Descartes and Leibniz. The nascent articulatio n of the epistemological insolvability of the mind-body problem that has so gravely and garishly confronted contemporary theorists of mind can, in fact, be found in the philosophical work of these two notable modernist thinkers. -

Neurophilosophy and Its Discontents How Do We Understand Consciousness Without Becoming Complicit in That Understanding?
Neurophilosophy and Its Discontents How Do We Understand Consciousness Without Becoming Complicit in that Understanding? BY GABRIELLE BENETTE JACKSON dependent on empathy or imagination. Though presumably it would not capture everything, its goal would be to describe, at least in part, the subjective character of hat is consciousness? “It is being awake,” “being responsive,” “acting,” “being experience in a form comprehensible to beings incapable of having those experi- Waware,” “being self-aware,” “paying attention,” “perceiving,” “feeling emo- ences. […] It should be possible to devise a method of expressing in objective terms tions,” “feeling feelings,” “having thoughts,” “thinking about thoughts,” “it is like much more than we can at present, and with much greater precision.” The proposal, this!” simply put, was to develop a language to describe subjectivity in non-subjective Who is conscious? “We humans, surely!” Well, maybe not all the time. “Animals!” terms. And although it is definitely not the case that all theorists pushing past the Debatable. “Computers?” No—at least, not yet. “Other machines?” Only in fiction. problem of consciousness consider themselves to be implementing Nagel’s plan, it “Plants?” Absolutely not, right? does help to understand a particular set of accumulated answers. Two fundamental Nearly twenty-five years ago, we lived through “the project of the decade of the approaches have been neurophilosophy and neurophenomenology, each emphasizing brain,” a governmental initiative set forth by President one aspect of Nagel’s suggestion—either the objective part George H. W. Bush.1 Presidential Proclamation 6158 (viz. neurophilosophy) or the phenomenology part (viz. begins, “The human brain, a three-pound mass of inter- neurophenomenology). -

Churchland Source: the Journal of Philosophy, Vol
Journal of Philosophy, Inc. Reduction, Qualia, and the Direct Introspection of Brain States Author(s): Paul M. Churchland Source: The Journal of Philosophy, Vol. 82, No. 1 (Jan., 1985), pp. 8-28 Published by: Journal of Philosophy, Inc. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2026509 Accessed: 07-08-2015 19:14 UTC Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Journal of Philosophy, Inc. is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to The Journal of Philosophy. http://www.jstor.org This content downloaded from 142.58.129.109 on Fri, 07 Aug 2015 19:14:45 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions 8 THE JOURNAL OF PHILOSOPHY structureof this idiom, moreover-its embeddingof a subordinate sentence-would have been clearly dictatedby its primitiveuse in assessing children's acquisition of observationsentences. Analogi- cal extension of the idiom to other than observation sentences would follow inevitably,and the developmentof parallel idioms for other propositional attitudeswould then come naturally too, notwithstanding their opacity from a logical point of view. Naturalness is one thing, transparencyanother; familiarityone, clarityanother. W. V. QtJINE Harvard University REDUCTION, QUALIA, AND THE DIRECT INTROSPECTION OF BRAIN STATES* DO the phenomenological or qualitative featuresof our sen- sations constitutea permanentbarrier to thereductive aspi- rations of any materialisticneuroscience? I here argue that theydo not. -

In Defence of Folk Psychology
FRANK JACKSON & PHILIP PETTIT IN DEFENCE OF FOLK PSYCHOLOGY (Received 14 October, 1988) It turned out that there was no phlogiston, no caloric fluid, and no luminiferous ether. Might it turn out that there are no beliefs and desires? Patricia and Paul Churchland say yes. ~ We say no. In part one we give our positive argument for the existence of beliefs and desires, and in part two we offer a diagnosis of what has misled the Church- lands into holding that it might very well turn out that there are no beliefs and desires. 1. THE EXISTENCE OF BELIEFS AND DESIRES 1.1. Our Strategy Eliminativists do not insist that it is certain as of now that there are no beliefs and desires. They insist that it might very well turn out that there are no beliefs and desires. Thus, in order to engage with their position, we need to provide a case for beliefs and desires which, in addition to being a strong one given what we now know, is one which is peculiarly unlikely to be undermined by future progress in neuroscience. Our first step towards providing such a case is to observe that the question of the existence of beliefs and desires as conceived in folk psychology can be divided into two questions. There exist beliefs and desires if there exist creatures with states truly describable as states of believing that such-and-such or desiring that so-and-so. Our question, then, can be divided into two questions. First, what is it for a state to be truly describable as a belief or as a desire; what, that is, needs to be the case according to our folk conception of belief and desire for a state to be a belief or a desire? And, second, is what needs to be the case in fact the case? Accordingly , if we accepted a certain, simple behaviourist account of, say, our folk Philosophical Studies 59:31--54, 1990. -

Mind and Language Seminar: Theories of Content
Mind and Language Seminar: Theories of Content Ned Block and David Chalmers Meetings • Main meeting: Tuesdays 4-7pm over Zoom [4-6pm in weeks without a visitor] • Student meeting: Mondays 5-6pm hybrid • Starting Feb 22 [only weeks with a visitor] • Enrolled students and NYU philosophy graduate students only. • Feb 2: Background: Theories of Content • Feb 9: Background: Causal/Teleological Theories • Feb 16: Background: Interpretivism • Feb 23: Nick Shea • March 2: Robbie Williams • March 9: Frances Egan • March 16: Adam Pautz • March 23: Veronica Gómez Sánchez • March 30: Background: Phenomenal Intentionality • April 6: Imogen Dickie • April 13: Angela Mendelovici • April 20: Background: Conceptual-Role Semantics • April 27: Christopher Peacocke • May 4: David Chalmers Assessment • Draft paper due April 19 • Term paper due May 17 Attendance Policy • Monday meetings: Enrolled students and NYU philosophy graduate students only. • Tuesday meetings: NYU and NYC Consortium students and faculty only • Very limited exceptions • Email us to sign up on email list if you haven’t already. Introductions Short History of the 20th Century • 1900-1970: Reduce philosophical questions to issues about language and meaning. • 1970s: Theories of meaning (philosophy of language as first philosophy) • 1980s: Theories of mental content (philosophy of mind as first philosophy). • 1990s: Brick wall. Theories of Content • What is content? • What is a theory of content? Content • Content (in the broadest sense?) is intentionality or aboutness • Something has content when it is about something. Contents • Content = truth-conditions • Content = satisfaction-conditions • Content = propositions • Content = objects of intentional states • Content = … What Has Content? • What sort of thing has content? What Has Content? • What sort of thing has content? • language (esp. -

The Knowledge Argument Against Physicalism
Handout 8 The Knowledge Argument against Physicalism 1. Some Terminology Physicalism – all information is physical information (Another possible formulation: all facts are physical facts) Physical information - The information given by science (note: Jackson doesn’t regard this as a definition, since it’s somewhat vague) A Qualia Freak – Someone who thinks that there are features of bodily sensations and perceptual experiences that no amount of physical information includes. These features are called “qualia”: the hurtfulness of pain, the itchiniess of itches, how it feels to be jealous, taste a lemon, etc. 2. The Knowledge Argument for Qualia Fred – Fred can make all the color discriminations we make plus more. Show him a batch of ripe tomatoes and he’ll sort them into two piles which he says are as different to him in terms of color appearance as yellow is from blue. He calls these calls “red1” and “red2.” 1. We can gain all the physical information about Fred that we like and we still won’t know certain information about Fred: what kind of experience Fred has when he says red1 and red2. 2. Not all information is physical information (This can be dramatized by imagining that Fred donates his body to science and they are able to transplant his optical system into somebody else. After the operation this person will know more about Fred than was known before). Mary – Mary is a brilliant scientist who has spent her whole life in a black and white room. She is an expert on color vision and neurophysiology and knows all the physical information one could possibly know about color vision. -

The Puzzle of Conscious Experience (Chalmers)
The Puzzle of Conscious Experience David J. Chalmers * From David Chalmers, "The Puzzle of Conscious Experience," Scientific American, 273 (1995), pp. 80-6. Reprinted by permission of the author. Conscious experience is at once the most familiar thing in the world and the most mysterious. There is nothing we know about more directly than consciousness, but it is extraordinarily hard to reconcile it with everything else we know. Why does it exist? What does it do? How could it possibly arise from neural processes in the brain? These questions are among the most intriguing in all of science. From an objective viewpoint, the brain is relatively comprehensible. When you look at this page, there is a whir of processing: photons strike your retina, electrical signals are passed up your optic nerve and between different areas of your brain, and eventually you might respond with a smile, a perplexed frown or a remark. But there is also a subjective aspect. When you look at the page, you are conscious of it, directly experiencing the images and words as part of your private, mental life. You have vivid impressions of colored flowers and vibrant sky. At the same time, you may be feeling some emotions and forming some thoughts. Together such experiences make up consciousness: the subjective, inner life of the mind. For many years consciousness was shunned by researchers studying the brain and the mind. The prevailing view was that science, which depends on objectivity, could not accommodate something as subjective as consciousness. The behaviorist movement in psychology, dominant earlier in this century, concentrated on external behavior and disallowed any talk of internal mental processes. -

An Anthology of Philosophical Studies
Introduction AN ANTHOLOGY OF PHILOSOPHICAL STUDIES Edited by PATRICIA HANNA ADRIANNE L. MCEVOY PENELOPE VOUTSINA ATINER 2006 1 An Anthology of Philosophical Studies 2 Introduction Athens Institute for Education and Research 2006 An Anthology of Philosophical Studies Edited by Patricia Hanna Adrianne L. McEvoy Penelope Voutsina 3 An Anthology of Philosophical Studies PUBLISHED BY ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH 14 Solomou Street, 10683 Athens, Greece Tel. +30 210 36.34.210 Fax +30 210.36.34.209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of the Athens Institute for Education and Research. First Published: 2006 ISBN: 978-960-6672-11-8 Typeset, printed and binding by Theta Co. 4 Introduction Table of Contents List of Contributors i Introduction 1 Voutsina, P. PART I EPISTEMOLOGY 1. Imagination in Descartes’ Skepticism 7 Scholl, A. 2. Descartes on Sensations and Ideas of Sensations 17 Cunning, D. 3. The Myth of Hume’s Compatibilism 33 Morris, E.W. 4. From Contextualism to Skepticism 43 Wilburn, R. 5. The Puzzle of Self-Knowledge 51 Voutsina, P. 6. Unconfined Rationality: A Normative yet Realistic Model of 59 Inference Morado, R. and Savion, L. PART II METAPHYSICS AND PHILOSOPHY OF SCIENCE 7. Language as Community Property: What’s Wrong with 75 Chomsky’s Individualism? Hanna, P. 8. What do Concepts Consist of? The Role of Geometric and 93 Proprioceptive Information in Categorization Dellantonio, S. and Pastore, L. -
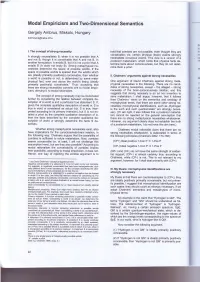
Modal Empiricism and Two-Dimensional Semantics
=" Modal Empiricismand Two-DimensionalSemantics GergelyAmbrus, Miskolc, Hungary h45í2amb@he|ka.iif.hu l. The concept ofstrong necessity hold that zombies are not possible,even thoughtthey are li:, conceivab|e;víz. certain physica| (brain) events strong|y ]l"1 A strongly necessitates B, when it is not possible that A necessitateconscious events. This view is a version of a and not B, though it is conceivable that A and not B. In posteriorimaterialism, which holds that physical facts de- ..t anotherÍormu|ation: A entai|sB' but it is not priori a fuhatA terminefacts about consciousness.but thev do not deter- entails B (A does not imply B). Strong metaphysicatne- mine them a priori. cessities determine the space oÍ possib|e wor|ds. |f the T'1 space of possible worlds is sparser then the worlds which are (ideallyprimarily positively) conceivable, then whether ll. Chalmers' arguments against strong necessities a world is possible or not, is determinedby some meta- & physical fact, over and above the world's being (ideally One argument of David Chalmers against strong meta- primarily positively) conceivable.' Thus: accepting that physical necessities is the following.There are no candi- - - there are strong necessities commits one to modal empir- dates of strong necessities,except the alleged strong :l icsm;denying it, to modalrationalism. necessity of the brain-consciousnessrelation; and this 1: suggests that strong necessity is an ad froc inventionto a The concept oÍstrong necessity may be i||uminated save materialism.I shall argue, however, that it follows {. further by consideringthe relation between complete de- trom Chalmers, views on the semantics and ontology oÍ iui scriptionof a world w and a particulartrue statementS. -

Erica Fretwell SENSORY EXPERIMENTS Sensory Experiments PSYCHOPHYSICS, RACE, and the AESTHETICS of FEELING
S E N S O R Y E X P E R I M E N T S Psychophysics, RACE, and the Aesthetics of feeling Erica Fretwell SENSORY EXPERIMENTS Sensory Experiments PSYCHOPHYSICS, RACE, AND THE AESTHETICS OF FEELING Erica Fretwell Duke University Press Durham and London 2020 © 2020 Duke University Press All rights reserved Printed in the United States of Amer i ca on acid- free paper ∞ Designed by Amy Ruth Buchanan Typeset in Arno and Avenir by Westchester Publishing Services Library of Congress Cataloging- in- Publication Data Names: Fretwell, Erica, [date] author. Title: Sensory experiments : psychophysics, race, and the aesthetics of feeling / Erica Fretwell. Description: Durham : Duke University Press, 2020. | Includes bibliographical references and index. Identifiers:lccn 2019054741 (print) | lccn 2019054742 (ebook) | isbn 9781478009863 (hardcover) | isbn 9781478010937 (paperback) | isbn 9781478012450 (ebook) Subjects: lcsh: Psychophysics. | Senses and sensation— Social aspects. | Racism—United States—Psychological aspects. | Racism—United States—History—19th century. | Science—Social aspects—United States—History—19th century. Classification:lcc bf237 .f74 2020 (print) | lcc bf237 (ebook) | ddc 152.10973/09034—dc23 lc record available at https://lccn.loc.gov/2019054741 lc ebook record available at https://lccn.loc.gov/2019054742 Duke University Press gratefully acknowl- edges the University at Albany, SUNY, which provided funds toward the publication of this book. IN MEMORY OF STEVEN FRETWELL CONTENTS Acknowl edgments ix Introduction: NEW SENSATION 1 -

Qualia, the Heart of the Mind-Body Problem and Epistemology's
Augsburg Honors Review Volume 12 Article 4 2019 Qualia, the Heart of the Mind-Body Problem and Epistemology’s Quagmire Allison Mangan Augsburg University Follow this and additional works at: https://idun.augsburg.edu/honors_review Part of the Epistemology Commons Recommended Citation Mangan, Allison (2019) "Qualia, the Heart of the Mind-Body Problem and Epistemology’s Quagmire," Augsburg Honors Review: Vol. 12 , Article 4. Available at: https://idun.augsburg.edu/honors_review/vol12/iss1/4 This Article is brought to you for free and open access by the Undergraduate at Idun. It has been accepted for inclusion in Augsburg Honors Review by an authorized editor of Idun. For more information, please contact [email protected]. Allison Mangan Qualia, the Heart of the Mind-Body Problem and Epistemology’s Quagmire Alio Maga, Augbug Univesty ualia are layered and complex, the basic philosophic understanding a labyrinth of a concept, of qualia today. We will see how Q rife with debate as to their consciousness is necessary for qualia, existence, state, and what they mean and why this makes defning qualia for our understanding of knowledge, a challenge. Next, we will go over the relationship with the world, and explanatory gap of qualia. From there, ourselves. Toughtful exploration into we will see how qualia relate to the mind- the complexities of what qualia are body problem, and the early exploration and how they relate to the mind-body of this problem through Descartes, problem will be wrestled with though Locke, and Berkeley. Additionally, we research applied within this paper. will go over the main schools of thought Qualia can be found in philosophical that surround the mind-body problem: debates surrounding epistemology materialism, idealism, and dualism.