3. Van Wezel.Indd 105 11.06.2004 13:12:16 Uhr 106
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
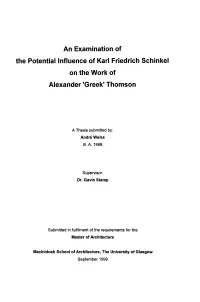
An Examination of the Potential Influence of Karl Friedrich Schinkel on the Work of Alexander 'Greek' Thomson
An Examination of the Potential Influence of Karl Friedrich Schinkel on the Work of Alexander 'Greek' Thomson A Thesis submitted by: Andre Weiss B. A. 1998 Supervisor: Dr. Gavin Stamp Submitted in fulfilment of the requirements for the Master of Architecture Mackintosh School of Architecture, The University of Glasgow September 1999 ProQuest N um ber: 13833922 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 13833922 Published by ProQuest LLC(2019). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 4 8 1 0 6 - 1346 Contents List of Illustrations ...................................................................................................... 3 Introduction .................................................................................................................9 1. The Previous Claims of an InfluentialRelationship ............................................18 2. An Exploration of the Individual Backgrounds of Thomson and Schinkel .............................................................................................................38 -

On the Ruins of Babel: Architectural Metaphor in German Thought
On the Ruins of Babel Series editor: Peter Uwe Hohendahl, Cornell University Signale: Modern German Letters, Cultures, and Thought publishes new English- language books in literary studies, criticism, cultural studies, and intellectual history pertaining to the German-speaking world, as well as translations of im- portant German-language works. Signale construes “modern” in the broad- est terms: the series covers topics ranging from the early modern period to the present. Signale books are published under a joint imprint of Cornell University Press and Cornell University Library in electronic and print formats. Please see http://signale.cornell.edu/. On the Ruins of Babel Architectural Metaphor in German Thought Daniel L. Purdy A Signale Book Cornell University Press and Cornell University Library Ithaca, New York Cornell University Press and Cornell University Library gratefully acknowledge the support of The Andrew W. Mellon Foundation for the publication of this volume. Copyright © 2011 by Cornell University All rights reserved. Except for brief quotations in a review, this book, or parts thereof, must not be reproduced in any form without permission in writing from the publisher. For information, address Cornell University Press, Sage House, 512 East State Street, Ithaca, New York 14850. First published 2011 by Cornell University Press and Cornell University Library Printed in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Purdy, Daniel L. On the ruins of Babel : architectural metaphor in German thought / Daniel L. Purdy. p. cm. — (Signale : modern German letters, cultures, and thought) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-8014-7676-1 (pbk. : alk. paper) 1. -

Winckelmann, Greek Masterpieces, and Architectural Sculpture
Winckelmann, Greek masterpieces, and architectural sculpture. Prolegomena to a history of classical archaeology in museums Book or Report Section Accepted Version Smith, A. C. (2017) Winckelmann, Greek masterpieces, and architectural sculpture. Prolegomena to a history of classical archaeology in museums. In: Lichtenberger, A. and Raja, R. (eds.) The Diversity of Classical Archaeology. Studies in Classical Archaeology, 1. Brepols. ISBN 9782503574936 Available at http://centaur.reading.ac.uk/70169/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Published version at: http://www.brepols.net/Pages/ShowProduct.aspx?prod_id=IS-9782503574936-1 Publisher: Brepols All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online Winckelmann, Greek Masterpieces, and Architectural Sculpture Prolegomena to a History of Classical Archaeology in Museums∗ Amy C. Smith ‘Much that we might imagine as ideal was natural for them [the ancient Greeks].’1 ♣ Just as Johann Joachim Winckelmann mourned the loss of antiquity, so have subsequent generations mourned his passing at the age of fifty, in 1768, as he was planning his first journey to Greece. His deification through — not least — the placement of his profile head, as if carved out of a gemstone, on the title page of the first volume of his Geschichte der Kunst des Alterthums (‘History of Ancient Art’) in 1776 (the second edition, published posthumously) made him the poster boy for the study of classical art history and its related branches, Altertumswissenschaft or classical studies, history of art, and classical 2 archaeology. -

The To-Bingen Conspiracy
NORDISK MUSEOLOGI 1994•1, S. 31-46 THE TO-BINGEN CONSPIRACY Beat Wjtss In March of1913, a fragmentary manuscript, a folio written on both sides in the handwriting of Georg Friedrich Wilhelm Hegel, was auctioned offin Berlin. Four years later, after a publication by Franz Rosenzweig, it became known as the «Oldest System-Program ofGerman Idealism.1>1 One hears the murmuring ofa genius in this little text, which has been attributed to Schelling, Holder/in, or Hegel three friends who studied together in TU.bingen. This <<fetish» ofresearch on idealism2 continues to feed the scholarly debate over the fragments authorship and the obscurities ofits origin and content. 3 Some new ideas about the purpose ofthe early public art museums may emerge from the study ofthe document. It is possible to discern a connecting line ofthought, a com mon concept ofpurpose, between Holderlin's idea of 'eternal return' and Mies van der Rohe's Neue Nationalgalerie in Berlin, as well as between Hegel's historicism, Schinkel's Altes Museum and James Sterling's Staatsgalerie in Stuttgart. For each of the three friends, the System ing the French Revolution in a transcen Program would seem to be the seed of ding light. The System-Program begins later works. In fervent language, the thesis with the announcement of a "revolt .... demands the merging of art and philoso through reason itself." 5 After this great phy, myth and science. The manuscript revolution, which would have done away must have originated in the Winter of with ignorance, superstition, and prosely 1796-97, perhaps as an "agitation pro tizers, the new age would stand under the gram" to be read alound to a circle of col sign of beauty, for within beauty all con leagues.4 cepts of reason are united: At this time, Hegel and Holderlin were employed as preceptors in Frankfurt, I am convinced now that the highest act of reason, which allowed them to pick up their dis the one in which all other ideas are united, is an cussions where they had left off in aesthetic act and that truth and goodness become Ttibingen. -

Redalyc.Modos De Habitar a História Ou Filosofia, Cultura E Arquitetura Na
Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas ISSN: 1068-2341 [email protected] Arizona State University Estados Unidos Lemos Britto, Fabiano de Modos de habitar a história ou filosofia, cultura e arquitetura na fundação do Altes Museum de Berlim Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas, vol. 19, enero, 2011, pp. 1-25 Arizona State University Arizona, Estados Unidos Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=275019735002 Como citar este artigo Número completo Sistema de Informação Científica Mais artigos Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Home da revista no Redalyc Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto arquivos analíticos de políticas educativas Revista acadêmica, avaliada por pares, independente, de acesso aberto, e multilíngüe Arizona State University Volume 19 Número 2 20 de janeiro 2011 ISSN 1068-2341 Modos de habitar a história ou filosofia, cultura e arquitetura na fundação do Altes Museum de Berlim Fabiano Lemos PUC-Rio Brazil Citação: Lemos, F. (2011) Modos de habitar a história ou filosofia, cultura e arquitetura na fundação do Altes Museum de Berlim. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, 19 (2). Recuperado [data] http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/781 Resumo: Desde a aurora do que hoje entendemos como modernidade o homem se espanta com sua finitude. O burguês dos séculos XVIII e XIX precisou elaborar intrincados mecanismos de preservação de passado e de vinculação com ele. No círculo dos philosophes, o conceito de tempo passa a se duplicar na idéia de origem, que, para eles, se tornou opaca. -

Art History at the Art School: Revisiting the Institutional Origins of the Discipline Based on the Case of Nineteenth-Century Greece
Art history at the art school: Revisiting the institutional origins of the discipline based on the case of nineteenth-century Greece Eleonora Vratskidou Scholarly courses at the art school: a blind spot of research The elaboration of a theoretical discourse on art has been a main concern of art academies since their creation in the sixteenth century. This concern was nurtured by the need to regulate artistic production through the establishment of specific norms and values, and, at the same time, it was intricately linked to the promotion of the artist’s status and the legitimization of the artistic profession. The articulation of theoretical discourse in the academies took place mainly in the framework of conferences among peers – by and for an elite of peers – where multiple alternating voices could engage in fruitful debate. However, towards the end of the eighteenth and during the early nineteenth century the plurivocal structure of the conferences was, in many cases, gradually replaced by actual courses offered by a unique professor. Along with practical training, courses of history, archaeology, art history, art theory and aesthetics were systematically incorporated into the academic curricula in the context of larger pedagogical and institutional reforms. This is the period in which Ancient Régime artistic structures were reformed, while new art schools were created, and the academic system of art education expanded in the recently founded nation-states of Europe and the Americas. A series of questions arise from this development. Whereas courses in art theory and aesthetics could be seen as a further pursuing of old concerns, courses in art history were less expected. -

1 Storage in Early Modern Art Museums: the Value of Objects
CODART TWINTIG Warsaw, 21-23 May 2017 – Lecture 22 May Storage in Early Modern Art Museums: The Value of Objects Behind the Scenes Dr. Robert Skwirblies, Researcher at the Technical University, Berlin Full text As Martina Griesser stated in 2012, the history of museum storage has still to be written.1 She presumes that this history began in the late 19th century – when appropriate storage rooms were designed and built for the first time. That stands to be proven: actually, the first modern museums, founded in the decades around 1800, did have some structures that can be called storage rooms. In the following minutes, I would like to show you how this question arose in the first place, and how curators reacted to it. Some written sources and plans show us traces of the early storage design. Traces, I say, because we do not know exactly what the first storage rooms looked like. I have not found any details concerning storage rooms in museums in Paris or London. I have found some hints for museums in Italian cities and in Berlin, but no precise plans or technical details. What we can say is: The question of storing works of art in order to protect them from damage, destruction, or deprivation arose often and all over. At the same time, the storage of objects behind the display space was avoided or at least only temporary. In the early history of museums, storage rooms seem to have not been planned as such. Indeed, storing works of art was contrary to the very reason museums were founded: bringing hidden collections and treasures to light, making them visible to a public (which itself was in the state of being formed as the modern society, the citizens) and exhibiting them for the purposes of education, enjoyment, and the objects’ own good. -

Die ›Ästhetische Kirche‹ : Zur Entstehung Des Museums Am
ANNETTE GILBERT 45 Die ›ästhetische Kirche‹. Zur Entstehung des Museums am Schnittpunkt von Kunstautonomie und -religion [W]ährend selbst das religiöse Gefühl, was wirklich noch vorhanden ist, mehr oder min- der in den Parteienkampf hinabgerissen wurde[,] […] ist für eine sehr große Anzahl von Menschen aus der gebildeten Klasse, die Kunst und das Schöne das letzte ihnen übrig gebliebene Kleinod des Göttlichen […]. Friedrich Schlegel Seinen Besuch der Dresdner Schlossgalerie im Jahre 1768 beschrieb Goethe in Dichtung und Wahrheit rückblickend als außergewöhn- liches Erlebnis, das die Kunstgalerie zum Heiligtum werden ließ: Die Stunde, wo die Galerie eröffnet werden sollte, mit Un- geduld erwartet, erschien. Ich trat in dieses Heiligtum und meine Verwunderung überstieg jeden Begriff, den ich mir ge- macht hatte. Dieser in sich selbst wiederkehrende Saal, in welchem Pracht und Reinlichkeit bei der größten Stille herrschten, […] die mehr von Schauenden betretenen als von Arbeitenden benutzten Räume gaben mir ein Gefühl der Feierlichkeit, einzig in seiner Art, das umso mehr der Emp- findung ähnelte, womit man ein Gotteshaus betritt, als der Schmuck so manchen Tempels, der Gegenstand so mancher Anbetung hier abermals, nur zu heiligen Kunstzwecken auf- gestellt, erschien.1 1 Johann Wolfgang von Goethe: Dichtung und Wahrheit. In: Ders.: Werke. Ham- burger Ausgabe. Bd. 9. München 1981, S. 320. Die ›ästhetische Kirche‹ 46 Bis in die Gegenwart ist eine solch religiös gefärbte Sprache zur Be- schreibung ästhetischer Erfahrung in Kunsträumen weit verbreitet – die häufig wiederholte Rede vom Museum als Tempel, als »ästhe- tische Kirche«2 und als »Kathedrale«3 der Gegenwart zeugt davon. In vielen Fällen mag diese religiös überhöhte Rede von der Kunst und dem Kunsterlebnis lediglich der Unterstreichung oder Be- hauptung der besonderen Bedeutsamkeit der Kunst dienen – um 1800 aber hatte die Analogie zwischen Kunst und Religion, zwi- schen Kunstmuseum und Kirche besonderes Gewicht. -

Beauty and Instability in Eighteenth
Transformations of the Beautiful: Beauty and Instability in Eighteenth- and Early Nineteenth-Century German Literature Arthur K. Salvo Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2015 © 2015 Arthur K. Salvo All rights reserved ABSTRACT Transformations of the Beautiful: Beauty and Instability in Eighteenth- and Early Nineteenth-Century German Literature Arthur K. Salvo Transformations of the Beautiful reexamines a problem that emerges during the mid- eighteenth century: the devaluation of the aesthetic category of the beautiful. In opposition to accounts that identify this problem with the rediscovery of the sublime, this dissertation emphasizes the crucial yet underexamined role that historicization played in the destabilization of beauty’s normative status in German aesthetic discourse. Additionally, I demonstrate that literary discourse became a key mode through which the beautiful’s problematic status was negotiated. Assembling literary texts from 1759-1817 that thematize beautiful objects or phenomena in terms of their historicity or instability, and transform them, I argue that these moments constitute discrete instances in which literature responds to the precarious position of beauty in modernity. With recourse to texts by Winckelmann, Schiller, Jean Paul, Ernst August Friedrich Klingemann and Eichendorff, I focus on the specific literary techniques employed by different genres— description, elegy, and narrative fiction—and how they reconfigure the relationship between the modern subject and the beautiful. In so doing I demonstrate how literary texts intervene in aesthetic discourse to reevaluate and generate alternative conceptions of the beautiful. Table of Contents Introduction 1 Chapter 1. -
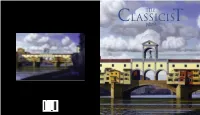
Classicist No-9
THE CLASSICIST NO-9 THE CLASSICIST o Institute of Classical Architecture & Art n 9: 2010-2011 20 West 44th Street, Suite 310, New York, NY 10036-6603 - telephone (212) 730-9646 facsimile (212) 730-9649 [email protected] WWW.CLASSICIST.ORG the classicist at large 4 Canon and Invention: The Fortuna of Vitruvius’ Asiatic Ionic Base Editor e s s a y 7 Richard John Schinkel’s Entwürfe zu städtischen Wohngebäuden: Designer Living all’antica in the New Bourgeois City Tom Maciag Dyad Communications design office Jean-François Lejeune Philadelphia, Pennsylvania Managing Editor f r o m t h e o f f i c e s 28 Henrika Dyck Taylor Printer e s s a y 49 Crystal World Printing Manufactured in China Paul Cret and Louis Kahn: Beaux-Arts Planning at the Yale Center for British Art ©2011 Institute of Classical Architecture & Art Sam Roche All rights reserved ISBN 978-0-9642601-3-9 ISSN 1076-2922 from the academies 60 Education and the Practice of Architecture Front and Back Covers David Ligare, Ponte Vecchio/ Torre Nova, 1996, Oil on Canvas, 40 x 58 inches. Private Collection, San Francisco, CA. ©D. Ligare. Michael Lykoudis This painting was created for a solo exhibition at The Prince of Wales’s Institute of Architecture in London in 1996. David Ligare described his intentions in the following terms: “The old bridge has been painted countless times by artists who have Notre Dame/Georgia Tech/Miami/Judson/Yale/College of Charleston/The ICAA utilized every style and manner of painting imaginable. I was not interested in making yet another ‘new’ view of it. -

Gilly-Weinbrenner-Schinkel: Baukunst Auf Papier Zwischen Gotik Und
ünf bedeutende Konvolute von Architekturzeichnungen und –reproduktionen aus den Beständen der Göttinger Universitätskunstsammlung und der Niedersächsischen Staats- und Universitäts- bibliothekF Göttingen werden in der Ausstellung „Gilly – Weinbrenner – Schinkel“ erstmals gemeinsam gezeigt. Eine besondere Entdeckung bieten dabei Friedrich Gillys Entwürfe für ein Theater in Stettin: Es sind die frühesten überhaupt bekannten, überdies brillant in Szene gesetzten Zeichnungen des früh verstorbenen Lehrers von Karl Friedrich Schinkel. Weitere Einblicke in die Architektenpraxis um 1800 vermittelt eine Mappe mit Zeichnungen für ein Theater in Königsberg, die vermutlich Carl Ferdinand Langhans nach Entwürfen Gillys angefertigt hat. Von der Mittelalter-Faszination die- ser Zeit zeugt Friedrich Fricks ebenfalls nach Vorlagen Gillys gedruckte Aquatinta-Serie „Schloss Marienburg in Preußen“. Für einen pragmatischen, aber nicht minder bemerkenswerten Umgang mit mittelalterlicher Bausubstanz stehen Friedrich Weinbrenners Entwürfe für den Umbau der Göttinger Paulinerkirche zur Universitätsbibliothek. Und schließlich belegen Karl Friedrich Schin- kels druckgraphisch reproduzierten Entwürfe für einen Königspalast auf der Akropolis in Athen, wie lange man im 19. Jahrhundert an einer schöpferischen Erneuerung des griechischen Altertums arbeitete. Die im Katalog erfassten Zeichnungen und Drucke laden dazu ein, Umbrüche und Leitmotive in der Architekturdarstellung um und nach 1800 nachzuvollziehen. Fünf einleitende Aufsätze eröffnen zusätzliche Forschungsperspektiven. -

Pegasus Berliner Beiträge Zum Nachleben Der Antike Heft 8 · 2006
pegasus Berliner Beiträge zum Nachleben der Antike Heft 8 · 2006 Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Humboldt-Universität zu Berlin www.census.de /pegasus.htm Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Humboldt-Universität zu Berlin Herausgeber: Horst Bredekamp, Arnold Nesselrath Redaktion: Charlotte Schreiter, Anne Leicht, Frederike Steinhoff Kunstgeschichtliches Seminar Unter den Linden 6 10099 Berlin © 2006 Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the Renaissance Layout und Satz: Jürgen Brinckmann, Berlin Druck: Gulde Druck GmbH, Tübingen ISSN 1436-3461 die romantische transformation der antike im alten museum berlins henning wrede Diese Studie versucht, die gewichtigsten Eigenschaften des Alten Museums zur Zeit seiner Eröffnung, 1830, zu erkennen, um sie in Zukunft auf der Muse- umsinsel und in anderen Sammlungen in ihrer nachwirkenden Konsistenz und Veränderung zu verfolgen. Sicherlich mit der gegenwärtigen Wiederherstellung und Modernisierung der Museumsinsel, aber auch mit einer verstärkten grundsätzlichen Hinwen- dung ist zu begründen, dass das Alte Museum im letzten Jahrzehnt breit unter- sucht worden ist. Ich erinnere nur an die große Darstellung seiner Planung und Konzeption durch Christoph Martin Vogtherr, an Jörg Tremplers Mono- graphie über das Wandbildprogramm von Karl Friedrich Schinkel und an die Wiedergewinnung der Statuenausstattung