Bulletin Der Deutschen Slavistik 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Volume 10 (2020)
ACADEMIC JOURNAL OF MODERN PHILOLOGY ACADEMIC JOURNAL MODERN PHILOLOGY OF Table of Contents e-ISSN 2353–3218 ISSN 2299–7164 Vol. 10 (2020) Andrei A. Avram, Substrate and Adstrate Influence on (Ki)Nubi: Evidence from Early Records .......7 Małgorzata Baran-Łucarz, Anna Klimas, Developing 21st Century Skills in a Foreign Language Classroom: EFL Student Teachers’ Beliefs and Self-Awareness..........................23 Magdalena Bator, Marta Sylwanowicz, Noun Phrase Modification in Middle English Culinary and Medical Recipes..................................................................39 Anna Budziak, T.S. Eliot’s Anti-Elitist View of Education ..........................................57 Academic Piotr P. Chruszczewski, O procesach tłumaczenia tekstu literackiego – część druga. Na przykładzie „Emeryta” Brunona Schulza [1892–1942] (opis ćwiczenia) . 65 Natalia Chrzanowska, Bilingualism in Malta: Preferences and Attitudes of Maltese University Students ...........................................................................91 Michał Dzikon, Berlińskie studia Stanisława Przybyszewskiego...................................111 Matteo Iacovella, The “Po-ethical Turn” in Post-War Austrian Literature Through Ilse Journal Aichinger’s Texts .............................................................................125 John M. Jeep, Reinhard Fuchs: Stabreimende Wortpaare in der Überlieferung unter Einbeziehung rechtssprachlicher Aspekte ......................................................137 Ewa Kębłowska-Ławniczak, From Roots to Routes: Women -

Sad Satan's Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric Milieus
Sad Satan’s Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric Milieus Karolina Maria Hess My whole life is summarized in this grand alternative: all or nothing. I chose all! Stanisław Przybyszewski (1889) Along the winded road of his life, Stanisław Przybyszewski (1868–1927) be- came a living legend; a legend he co-created himself, and of which he also be- came a victim. Widely known for his literary prose and poems rich in psycho- logical insight, his Satanic sympathies, remarkable self-confidence as a person and an artist, but also for numerous scandals and his alcoholism, Przybysze- wski was a colorful contribution to the European fin-de siècle. His intensive collaboration with artists from all over Europe made him recognizable outside of Poland, and his return to the country was welcomed as the coming of a prophet. As an author who in his works often referred to mysteries, occultism, and images of Satan, he has been noticed as an important figure in the scholar- ship of Western Esotericism.1 “Sad Satan” was how Przybyszewski was called by his contemporaries, among others – Tadeusz Boy Żeleński;2 the nickname is used often in Polish literary studies, and is not as controversial as it may seem. The term “Satan’s children” usually refers to the circle of artists around Przybyszewski that was formed in Poland, named after his book Satanskinder.3 In the title of this article it is used in a broader meaning, referring to the reception of Przybyszewski’s ideas. Even though he wasn’t personally involved as a member in any group of initiatory character, we need to refer to esoteric milieus of his time in order to understand Przybyszewski’s way of balancing on the blurry line between theorizing about and practicing occultism. -

KSM 4-2008.Indb
Krakowskie Studia Międzynarodowe SPIS TREŚCI Erhard Cziomer: Wprowadzenie: Nowe uwarunkowania i wyzwania partnerstwa polsko-niemieckiego w Europie pod koniec pierwszej dekady XXI wieku I. Ogólne uwarunkowania i przesłanki roli oraz pozycji międzynarodowej UE 27 Justyna Zajqc: Uwarunkowania ról międzynarodowych Unii Europejskiej 41 Magdalena Bainczyk: Aspekty prawne ewolucji polityki zagranicznej UE - od Traktatu konstytucyjnego do Traktatu lizbońskiego 57 Weronika Priesmeyer-Tkocz, Eckarł D. Strałenschulte: Immer im kreis und kein schritt zurück: Die EU zwischen externer Demokratieförderung und interner Konsolidierung 71 Ryszard M. Czarny: Kontrowersje wokół Gazociągu Północnego - implikaqe dla państw regionu Morza Bałtyckiego 85 Marek Czajkowski: Miejsce UE w polityce zagranicznej Federaq'i Rosyjskiej - uwarunkowania, założenia, pola konfliktu i obszary współpracy II. Polska i Niemcy wobec funkcjonowania i węzłowych problemów rozwoju UE 107 Helmut Wagner: Die polnische und deutsche Debatte über den vertrag von Lissabon. Dissonanzen und Übereinstimmungen 123 Janusz J. Węc: Nowa pozycja Sejmu i Senatu w polityce europejskiej po wejściu w życie Traktatu lizbońskiego 143 Bogdan Koszel: Aspiracje mocarstwowe zjednoczonych Niemiec w XXI wieku 159 Erhard Cziomer: Europejski wymiar polityki Niemiec wobec Rosji i Ukrainy oraz jej implikacje dla Polski 179 Adam Szymański: Polska wobec dalszego poszerzania Unii Europejskiej 195 Anna Paterek: Niemcy wobec procesu dalszego poszerzania UE 213 Ryszard Zięba: Rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa -

Noty O Autorach
Noty o Autorach Bożena Anna Badura – dr nauk hum., ukończyła germanistykę w Akade- mii im. Jana Długosza w Częstochowie i na Uniwersytecie w Rzeszowie. W latach 2009–2010 pracowała jako Teaching Assistant w University of Virginia (USA). W roku 2013 uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie w Mannheim. Aktualnie jest wykładowcą i członkiem komisji egzaminacyj- nej DSH na Uniwersytecie Duisburg-Essen oraz prowadzi wykłady z litera- tury w Volkshochschule Essen. Regularnie pisze recenzje dla „Literatur- kritk.de”. Od 2014 r. prowadzi w Essen wieczory autorskie „Das Debüt im Livrés“. Zainteresowania badawcze: literatura XIX i XX w., germanistyka interkulturowa, teoria narracji. Wybór publikacji: Normalisierter Wahn- sinn? Aspekte des Wahnsinns im Roman des frühen 19. Jahrhunderts, Psycho- sozial-Verlag, Gießen 2015; Superbia. Hochmut und Stolz in Kultur und Lite- ratur, red. B.A. Badura, T.F. Kreuzer, Psychosozial-Verlag, Gießen 2014 (w tomie artykuł Der Duft der postmodernen Gesellschaft. Hochmut und Na- rzissmus in Patrick Süskinds Roman „Das Parfum”, s. 113–141). Adres mai- lowy: [email protected]. ORCID: 0000-0002-4875-689X. Joanna Małgorzata Banachowicz – dr nauk hum., absolwentka germani- styki i romanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, pracownik naukowo- dydaktyczny w Instytucie Filologii Germańskiej UWr. Stopień doktora uzy- skała na podstawie rozprawy Konstruktionen der jüdischen Identität im Werk von Doron Rabinovici. Doświadczenie we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, liczne staże naukowe i pobyty badawcze m.in. w Austrii (Uniwersytet Wiedeński), Niemczech (Uniwersytet Monachijski) oraz na Węgrzech. Laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Autorka monografii Auf Trümmern des Mythos. Posthistorische Vision der Ewigen Stadt in „Siebzig verweht“ von Ernst Jünger (Wrocław 2012), a także wielu artykułów naukowych z zakre- su współczesnej literatury niemieckojęzycznej oraz tłumaczeń literackich, w tym przekładu na język polski tomu opowiadań Dorona Rabinovici Pa- pirnik (Wrocław 2014). -

Sad Satan's Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric Milieus
Sad Satan’s Children: Stanisław Przybyszewski and Esoteric Milieus Karolina Maria Hess My whole life is summarized in this grand alternative: all or nothing. I chose all! Stanisław Przybyszewski (1889) Along the winded road of his life, Stanisław Przybyszewski (1868–1927) be- came a living legend; a legend he co-created himself, and of which he also be- came a victim. Widely known for his literary prose and poems rich in psycho- logical insight, his Satanic sympathies, remarkable self-confidence as a person and an artist, but also for numerous scandals and his alcoholism, Przybysze- wski was a colorful contribution to the European fin-de siècle. His intensive collaboration with artists from all over Europe made him recognizable outside of Poland, and his return to the country was welcomed as the coming of a prophet. As an author who in his works often referred to mysteries, occultism, and images of Satan, he has been noticed as an important figure in the scholar- ship of Western Esotericism.1 “Sad Satan” was how Przybyszewski was called by his contemporaries, among others – Tadeusz Boy Żeleński;2 the nickname is used often in Polish literary studies, and is not as controversial as it may seem. The term “Satan’s children” usually refers to the circle of artists around Przybyszewski that was formed in Poland, named after his book Satanskinder.3 In the title of this article it is used in a broader meaning, referring to the reception of Przybyszewski’s ideas. Even though he wasn’t personally involved as a member in any group of initiatory character, we need to refer to esoteric milieus of his time in order to understand Przybyszewski’s way of balancing on the blurry line between theorizing about and practicing occultism. -

Von Den Gleichnissen
Reading Kafka’s Mind: Categories, Schemas, Metaphors by Michael Eugene Huffmaster A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in German in the Graduate Division of the University of California, Berkeley Committee in charge: Professor Claire Kramsch, Chair Professor Niklaus Largier Professor Anton Kaes Professor Eve Sweetser Fall 2010 Reading Kafka’s Mind: Categories, Schemas, Metaphors © 2010 by Michael Eugene Huffmaster Contents Dedication iii Acknowledgments iv 1 Kafka’s Art and the Fundamentals of Human Cognition 1 Generic versus Specific Conceptual Structure 2 Categories 4 Image Schemas 6 Metaphor 13 UNDERSTANDING IS HEARING 18 2 “Von den Gleichnissen” 22 A Generic Concept 23 A Generic Text 27 A Generic Proposition 31 Image Schemas and Their Transformations 35 Generic and Primary Metaphors 38 Gleichnisse in Literature and Life 43 3 Das Urteil 49 Speech as Action and Its Consequent Susceptibility to Failure 49 Austin’s Anxiety about Speech as Action 51 Failed Speech Acts in Reported Thought 54 Failed Speech Acts in Reported Speech 58 Failed Speech Acts in Direct Speech 62 The Father’s Judgment 71 The Father’s Sentence 74 The PATH of Speech Acts 80 4 The Zürau Aphorisms 83 Image Schemas in the Zürau Aphorisms 83 The PATH in the Zürau Aphorisms 88 Highlighting Generic Structure to Critique Conventional Thinking 103 The PATH of the Zürau Aphorisms 106 5 Ein Bericht für eine Akademie 109 The PATH of Rotpeter’s Transformation 109 The Beginning of Rotpeter’s PATH 111 The PATH -

Wintersemester 2005/06
UNIVERSITÄT WIEN PHILOLOGISCH-KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT INSTITUT FÜR SLAWISTIK INSTITUTSBERICHT FÜR DAS AKADEMISCHE JAHR 2005/2006 (Berichtszeitraum: 01.10.2005 bis 30.09.2006) zusammengestellt von Bernhard HARTMANN, M. A. im Auftrag von Univ.-Prof. Dr. Stefan Michael NEWERKLA Institutsvorstand 17. 6. 2007 Inhalt 1. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter........................................................................................... 3 2. Lehre....................................................................................................................................... 5 2.1. HörerInnenstatistik (erstellt von Dr. Andreas LEBEN) .................................................... 5 2.1.1. HörerInnen WS 2005 ............................................................................................... 5 2.1.2. HörerInnen SS 2006................................................................................................. 6 2.2. Lehrveranstaltungen........................................................................................................ 8 2.2.1. Wintersemester 2005................................................................................................ 8 2.3.1. Sommersemester 2006 ........................................................................................... 12 3. Forschung............................................................................................................................. 18 3.1. Monographien .............................................................................................................. -

Bibliographie Bibliographie
Bibliographie Bibliographie Es werden alle Titel aufgeführt, aus denen im Text zitiert bzw. auf die verwiesen worden ist. Die Anordnung der Titel folgt dem alphabetischen Wortlaut, aber ohne Berücksichtigung der Artikel. Um die Erschließung von Spezialliteratur zu erleichtern, werden bei Aufsatzsammlungen Einzelbeiträge in der Bibliographie eigens aufgeführt, wenn sie im Text Erwähnung finden. Auf die leicht zugänglichen Reclam-Bände ist durch Angabe der Reihentitel eigens verwiesen worden. Folgende Siglen werden verwendet: Expr. Expressionismus. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1910–1920. Hrsg. Tho- mas Anz u. Michael Stark. Stuttgart 1982 Jhw. Jahrhundertwende. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1890–1910. Hrsg. Ernst Ruprecht u. Dieter Bänsch. Stuttgart 1981 LMN Literarische Manifeste des Naturalismus 1880–1892. Hrsg. Erich Ruprecht. Stuttgart 1962 Manif. Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909–1938). Hrsg. Wolfgang Asholt u. Walter Fähnders. Stuttgart, Weimar 1995; 2. Aufl. 2005 Mod. Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstverständnis der Literatur um die Jahrhun- dertwende. Hrsg. Gotthart Wunberg. Frankfurt/M. 1971 (2. Aufl. Freiburg/Br. 1998) Nat. Naturalismus. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1880–1900. Hrsg. Man- fred Brauneck u. Christine Müller. Stuttgart 1987 WR Weimarer Republik. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1918–1933. Hrsg. Anton Kaes. Stuttgart 1983 Folgende bibliographische, lexikalische und literaturgeschichtliche Werke können der raschen Infor- mation dienen. Alle diese Titel sowie Einzelbeiträge daraus finden sich erneut unter »Forschungslite- ratur«. Ästhetische Grundbegriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden. Hrsg. Karlheinz Barck, Mar- tin Fontius, Dieter Schlenstedt u.a. 7 Bde. Stuttgart, Weimar 2000-05 Benjamin-Handbuch. Hrsg. Burkhardt Lindner. Stuttgart, Weimar 2006 Brecht-Handbuch. Hrsg. Jan Knopf. -

Bibliographie
BIBLIOGRAPHIE Es werden alle Titel aufgeführt, aus denen im Text zitiert bzw. auf die verwiesen worden ist. Die Anordnung der Titel folgt dem alphabetischen Wortlaut, aber ohne Berücksichtigung der Artikel. Um die Erschließung von Spezialliteratur zu erleichtern, werden bei Aufsatzsammlungen Einzelbeiträge in der Bibliographie eigens aufgeführt, wenn sie im Text Erwähnung finden. Auf die leicht zugänglichen Reclam-Bände ist durch Angabe der Reihentitel eigens verwiesen worden. Folgende Siglen werden verwendet: Expr. Expressionismus. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920. Hrsg. Tho mas Anz u. Michael Stark. Stuttgart 1982 Jhw. Jahrhundertwende. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1890-1910. Hrsg. Ernst Ruprecht u. Dieter Bänsch. Stuttgart 1981 LMN Literarische Manifeste des Naturalismus 1880-1892. Hrsg. Erich Ruprecht. Stuttgart 1962 Manif. Manifeste und Proklamationen der europäischen Avantgarde (1909-1938). Hrsg. Wolfgang Asholt u. Walter Fähnders. Stuttgart, Weimar 1995 Mod. Die literarische Moderne. Dokumente zum Selbstverständnis der Literatur um die Jahrhun dertwende. Hrsg. Gotthart Wunberg. Frankfurt/M. 1971 Nat. Naturalismus. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1880-1900. Hrsg. Man fred Brauneck u. Christine Müller. Stuttgart 1987 WR Weimarer Republik. Manifeste und Dokumente zur deutschen Literatur 1918-1933. Hrsg. Anton Kaes. Stuttgart 1983 Folgende bibliographische, lexikalische und literaturgeschichtliche Werke können der raschen Infor mation dienen. Alle diese Titel sowie Einzelbeiträge daraus finden sich erneut unter» Forschungslite ratur« Deutsche literarische Zeitschriften 1880-1945. Ein Repertorium. Hrsg. Deutsches Literaturarchiv Marbach am Neckar. Bearb. Thomas Dietzel u. Hans-Otto Hügel. 5 Bde. München, New York U.a. 1987/88 Deutsche Literatur. Eine Sozialgeschichte. Horst Albert Glaser. Bd 8: Jahrhundertwende: Vom Natu ralismus zum Expressionismus 1880-1918. -
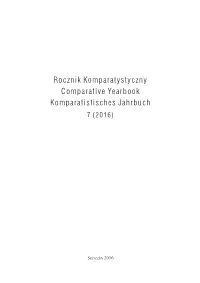
Download Issue File
Rocznik Komparatystyczny Comparative Yearbook Komparatistisches Jahrbuch 7 (2016) Szczecin 2016 Rada Naukowa prof. dr hab. Dalibor Blažina, prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (zastępca redaktor naczelnej) dr hab. Andrzej Hejmej prof. UJ, prof. dr hab. Ulrike Jekutsch prof. dr hab. Marta Skwara (redaktor naczelna), prof. dr hab. Lech Sokoł prof. dr Dorota Walczak -Delanois, dr hab. Bożena Zaboklicka prof. de la Universitat de Barcelona Sekretarz Redakcji dr Justyna Bucknall-Hołyńska, dr Rafał Makała Recenzenci Dr hab. Piotr Augustyniak, prof. UEK (UEK), prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski (UW) prof. Dorothy Figueira (University of Georgia), prof. dr hab. Dorota Heck (Uwr) prof. dr Kris Van Heuckelom (KU Lueven) prof dr Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) prof. dr John Merchant (Loyola University Chicago), prof. dr Joanna Niżyńska (Indiana University) dr Małgorzta Sokalska (UJ), prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska (UAM) Redaktorzy językowi mgr Joanna Grzybowska (język polski) dr Justyna Bucknall-Hołyńska (język angielski) prof. dr Ulrike Jekutsch (język niemiecki) Korektor Paulina Kaczyńska-Domagalska Skład komputerowy Joanna Dubois-Mosora Projekt okładki Paweł Kozioł Na okładce wykorzystano formę przestrzenną M.C. Eschera Adres Redakcji Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa US, 71-065 Szczecin, al. Piastów 40b e-mail: [email protected] Wszystkie numery czasopisma dostępne są na stronie http://www.us.szc.pl/main.php/Rocznik%20komparatystyczny Wersja papierowa jest wersją pierwotną Streszczenia opublikowanych artykułów są dostępne online w międzynarodowych bazach danych: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), http://cejsh.icm.edu.pl The Central and Eastern European Online Library (CEEOL), www.ceeol.com © Copyright by Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2016 ISSN 2081-8718 WYDAWNICTWO NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO Nakład 80 egz.