Natel, Mobiltelefon, Smart- Phone, Handy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
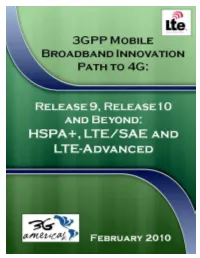
UMTS: Alive and Well
TABLE OF CONTENTS PREFACE…………………………………………………………………...……………………………… 5 1 INTRODUCTION......................................................................................................................... 10 2 PROGRESS OF RELEASE 99, RELEASE 5, RELEASE 6, RELEASE 7 UMTS-HSPA .......... 12 2.1 PROGRESS TIMELINE .................................................................................................................. 12 3 PROGRESS AND PLANS FOR RELEASE 8: EVOLVED EDGE, HSPA EVOLVED/HSPA+ AND LTE/EPC ............................................................................................................................ 19 4 THE GROWING DEMANDS FOR WIRELESS DATA APPLICATIONS ................................... 26 4.1 WIRELESS DATA TRENDS AND FORECASTS ................................................................................. 28 4.2 WIRELESS DATA REVENUE ......................................................................................................... 29 4.3 3G DEVICES............................................................................................................................... 31 4.4 3G APPLICATIONS ...................................................................................................................... 34 4.5 FEMTOCELLS ............................................................................................................................. 41 4.6 SUMMARY ................................................................................................................................. -

View Annual Report
1997 Annual Report Swisscom This year’s Annual Report focuses on people and communication The Swisscom Annual Report gives the reader a meaningful insight into our company. It seeks to convey an impression of the company’s mission as well as providing financial facts and figures. The 1997 Annual Report focuses on human communi- cation. The pictorial theme is based on the origin and fount of all communication: people. The photographs, with their communicative faces, form a deliberate contrast to the high-tech communication usually associated with a leading telecommunications company like Swisscom. The people shown in the photographs symbolise the linguistic and cultural diversity of our world. But they also reflect our determination to win over people of other countries and cultures to Swisscom through our outstanding products and services. The 1997 Annual Report and Financial Review of Swisscom are not intended for distribution or publication in the USA, Canada or Japan. The 1997 Financial Review with the review of the group’s results and the consolidated accounts of the Swisscom Group are appended to this Annual Report. Contact Publishing Details Swisscom AG Swisscom’s 1997 Annual Report Corporate Communications is available in English, German, French Viktoriastrasse 21 and Italian. Postfach You can order extra copies of the CH-3050 Berne report or ask for more information Tel. +41 31 342 36 78 using the reply coupon enclosed. Fax +41 31 342 27 79 Up-to-date information is Internet: http://www.swisscom.ch also available on the Internet. E-mail: [email protected] Publisher: Swisscom AG, Berne, Investor Relations Switzerland Curd-Hasso von Flemming Concept and production: Tel. -
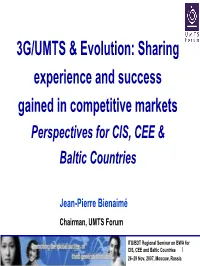
Presentation
3G/UMTS & Evolution: Sharing experience and success gained in competitive markets Perspectives for CIS, CEE & Baltic Countries Jean-Pierre Bienaimé Chairman, UMTS Forum ITU/BDT Regional Seminar on BWA for CIS, CEE and Baltic Countries 1 26–29 Nov. 2007, Moscow, Russia Summary (1) 3G / WCDMA / HSPA deployments global panorama including operator case studies (2) Mobile broadband evolution a clear standards path to 3G LTE (Long Term Evolution) (3) The promise for CIS, CEE & Baltic countries looking to 3G and mobile broadband deployment ITU/BDT Regional Seminar on BWA for CIS, CEE and Baltic Countries 2 26–29 Nov. 2007, Moscow, Russia About The UMTS Forum: who are we? The UMTS Forum is an international, cross-sector industry body comprising operators, manufacturers, regulators, application developers, research organisations and IT industry players. OBJECTIVES To promote a common vision of the development and Long Term Evolution of 3G/UMTS, and to ensure its worldwide commercial success: ¾ by expressing a strong industry voice promoting 3G/UMTS technology and its evolutions through lobbying and promotional actions globally ¾ by forging dialogue between operators, manufacturers, administrations & regulators, and other market players that can ensure commercial success for all ¾ by providing market knowledge to aid rapid development and uptake of new services and applications To provide practical support to industry, administrations and policy-makers: ¾ by offering guidance to governmental and financial communities, providing marketing input to technical standardization bodies (the Forum is a Market Representation Partner of 3GPP), and advising on spectrum requirements both for the present and future 3G systems ¾ through its membership of the three sectors of ITU, in the activities of which it participates regularly - such as the ITU-R WP8F – in view of contributing to the World Radio Conferences (WRC-07,…) The UMTS Forum serves the interests of all its members through educational and promotional activities in its role as the voice of the 3G mobile market. -
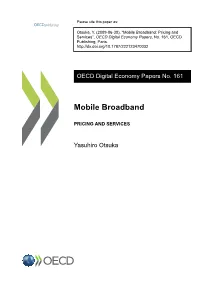
Mobile Broadband: Pricing and Services”, OECD Digital Economy Papers, No
Please cite this paper as: Otsuka, Y. (2009-06-30), “Mobile Broadband: Pricing and Services”, OECD Digital Economy Papers, No. 161, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/222123470032 OECD Digital Economy Papers No. 161 Mobile Broadband PRICING AND SERVICES Yasuhiro Otsuka Unclassified DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development 30-Jun-2009 ___________________________________________________________________________________________ English - Or. English DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE FOR INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS POLICY Unclassified DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy MOBILE BROADBAND: PRICING AND SERVICES English - Or. English JT03267481 Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Complete document available on OLIS in its original format DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL FOREWORD This paper was presented to the Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy in December 2008. The Working Party agreed to recommend the declassification of the document to the ICCP Committee. The ICCP Committee agreed to declassify the document at its meeting in March 2009. The paper was prepared by Mr. Yasuhiro Otsuka of the OECD’s Directorate for Science, Technology and Industry. It is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. © OECD/OCDE 2009. 2 DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL TABLE OF -

Mobile Broadband: Pricing and Services
Unclassified DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development 30-Jun-2009 ___________________________________________________________________________________________ English - Or. English DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE FOR INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS POLICY Unclassified DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy MOBILE BROADBAND: PRICING AND SERVICES English - Or. English JT03267481 Document complet disponible sur OLIS dans son format d'origine Complete document available on OLIS in its original format DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL FOREWORD This paper was presented to the Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy in December 2008. The Working Party agreed to recommend the declassification of the document to the ICCP Committee. The ICCP Committee agreed to declassify the document at its meeting in March 2009. The paper was prepared by Mr. Yasuhiro Otsuka of the OECD’s Directorate for Science, Technology and Industry. It is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. © OECD/OCDE 2009. 2 DSTI/ICCP/CISP(2008)6/FINAL TABLE OF CONTENTS FOREWORD .................................................................................................................................................. 2 MOBILE BROADBAND: PRICING AND SERVICES .............................................................................. -

The Race Is on Swissquote N°3 July
N°3 JULY 2019 WWW.SWISSQUOTE.COM CHF 9.- WWW.SWISSQUOTE.COM FINANCE AND TECHNOLOGY UNPACKED PORTRAIT Stadler picks up speed LIVESTREAMERS Vying for clicks SAUDI ARAMCO Revving up for the IPO DOSSIER THE5G RACE 5G: THE RACE IS ON IS ON Novel applications Companies to watch Interview: Olaf Swantee, CEO of Sunrise ATC BROADCOM CELLNEX ERICSSON NOKIA QORVO QUALCOMM SWISSQUOTE N°3 JULY 2019 SWISSQUOTE N°3 JULY EDITORIAL SWISSQUOTE JULY 2019 Candidate for the position of 5G: tensions are high Chief Performance Officer. The new Cayenne Coupé. Shaped by Performance. Win an alpine test drive: www.cayenne-coupe.ch By Marc Bürki, CEO of Swissquote hey say that whoever mas- with operators, are selling a dream. ters data masters the world. Virtual reality, connected objects, au- This is extremely relevant tonomous cars... So many applications p. 40 p. 45 Tto the trade war raging between are finally made possible via this new Washington and Beijing these past ultra-fast, reactive mobile network. In few months. At the centre of this practice, these usages will very likely battle is a Chinese company: Huawei, become widespread, but only in two accused of espionage by the Trump or three years, when the coverage and government and now blacklisted power of the network is in full force. by several US companies, includ- Currently, average consumers can ing Google. One may wonder who already enjoy speeds that are said to benefits from the situation, given be up to 10 times faster than 4G. But that Huawei, according to independ- there still needs to be a use for it. -

The Business Dynamics in Telecommunication Market Consolidation George Amstad Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Master's Theses Graduate School 2006 The business dynamics in telecommunication market consolidation George Amstad Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses Part of the Management Sciences and Quantitative Methods Commons Recommended Citation Amstad, George, "The business dynamics in telecommunication market consolidation" (2006). LSU Master's Theses. 4006. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/4006 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Master's Theses by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. THE BUSINESS DYNAMICS IN TELECOMMUNICATION MARKET CONSOLIDATION A Thesis Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College In Partial fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science In The Department of Information Systems & Decision Sciences By George Amstad stud.rer.pol University of Berne, 2006 December 2006 Acknowledgements I am grateful to Dr. Thomas D. Clark, my advisor, for his active support, patience and commitment to help me developing our model. I especially appreciate his input when I was stuck in the modeling process and he showed me new modeling approaches to solve this situation. I would like to thank Dr. Edward F. Watson who introduced me to the Information Systems & Decision Sciences Master program. He demonstrated exceptional patience and stamina, answering my numerous administrative questions. I want to thank Dr. -

Mobile and PSTN Communication Services: Competition Or Complementarity?”, OECD Digital Economy Papers, No
Please cite this paper as: OECD (1995-01-01), “Mobile and PSTN Communication Services: Competition or Complementarity?”, OECD Digital Economy Papers, No. 13, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/237485605680 OECD Digital Economy Papers No. 13 Mobile and PSTN Communication Services COMPETITION OR COMPLEMENTARITY? OECD GENERAL DISTRIBUTION OCDE/GD(95)96 MOBILE AND PSTN COMMUNICATION SERVICES: COMPETITION OR COMPLEMENTARITY? ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Paris 1995 COMPLETE DOCUMENT AVAILABLE ON OLIS IN ITS ORIGINAL FORMAT FOREWORD These papers were prepared in the context of the work programme of the Committee for Information, Computer and Communications Policy. They were considered by the Working Party on Telecommunications and Information Services Policies in 1992 and recommended for derestriction by the Committee in 1993. Part A of the report was prepared by Dr. Tim Kelly of the Secretariat, and Part B was prepared by Messrs. Derek Laval and Kristen Hansen of the consultancy firm Schema (United Kingdom). The information contained in this paper is valid as of the end of 1992. However, significant changes have occurred in the mobile sector since then. Nevertheless, much of the discussion and arguments in the report remain valid and, for this reason, it has been viewed as useful to make the document available to the general public. Copyright OECD, 1995 Applications for permission to reproduce or translate all or part of this material should be made to: Head of Publications Service, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. 2 TABLE OF CONTENTS Part A MOBILE AND PSTN COMMUNICATION SERVICES: COMPETITION OR COMPLEMENTARITY? Page I. -

Connected Televisions: Convergence and Emerging Business Models”, OECD Digital Economy Papers, No
Please cite this paper as: OECD (2014-02-04), “Connected Televisions: Convergence and Emerging Business Models”, OECD Digital Economy Papers, No. 231, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5jzb36wjqkvg-en OECD Digital Economy Papers No. 231 Connected Televisions CONVERGENCE AND EMERGING BUSINESS MODELS OECD Unclassified DSTI/ICCP/CISP(2013)2/FINAL Organisation de Coopération et de Développement Économiques Organisation for Economic Co-operation and Development 04-Feb-2014 ___________________________________________________________________________________________ English - Or. English DIRECTORATE FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY COMMITTEE FOR INFORMATION, COMPUTER AND COMMUNICATIONS POLICY Unclassified DSTI/ICCP/CISP(2013)2/FINAL Cancels & replaces the same document of 22 January 2014 Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy CONNECTED TELEVISIONS: CONVERGENCE AND EMERGING BUSINESS MODELS English - Or. English JT03351873 Complete document available on OLIS in its original format This document and any map included herein are without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area. DSTI/ICCP/CISP(2013)2/FINAL FOREWORD This report was presented to the Working Party on Communication, Infrastructures and Services Policy (CISP) in June 2013. It was made public by the Committee for Information, Computer and Communications Policy (ICCP) in December 2013. The report was prepared by Mr. Rudolf van der Berg. It is published under the responsibility of the Secretary-General of the OECD. Mr. Jonathan Levy of the United States Federal Communications Commission is thanked for his substantial contributions to the report. © OECD 2014 2 DSTI/ICCP/CISP(2013)2/FINAL TABLE OF CONTENTS FOREWORD ................................................................................................................................................. -
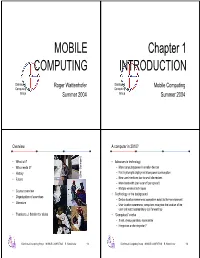
MOBILE COMPUTING Chapter 1 INTRODUCTION
MOBILE Chapter 1 COMPUTING INTRODUCTION Distributed Roger Wattenhofer Distributed Mobile Computing Computing Computing Group Summer 2004 Group Summer 2004 Overview A computer in 2010? • What is it? • Advances in technology • Who needs it? – More computing power in smaller devices • History – Flat, lightweight displays with low power consumption • Future [Der Spiegel] – New user interfaces due to small dimensions – More bandwidth (per second? per space?) – Multiple wireless techniques • Course overview • Technology in the background • Organization of exercises – Device location awareness: computers adapt to their environment • Literature – User location awareness: computers recognize the location of the user and react appropriately (call forwarding) • Thanks to J. Schiller for slides • “Computers” evolve – Small, cheap, portable, replaceable – Integration or disintegration? Distributed Computing Group MOBILE COMPUTING R. Wattenhofer 1/3 Distributed Computing Group MOBILE COMPUTING R. Wattenhofer 1/4 What is Mobile Computing? Application Scenarios • Aspects of mobility • Vehicles – User mobility: users communicate “anytime, anywhere, with anyone” (example: read/write email on web browser) • Nomadic user – Device portability: devices can be connected anytime, anywhere to the • Smart mobile phone network • Invisible computing • Wireless vs. mobile Examples • Wearable computing 88Stationary computer 8 9 Notebook in a hotel • Intelligent house or office 9 8 Wireless LANs in historic buildings • Meeting room/conference What is important? 99Personal Digital Assistant (PDA) • Taxi/Police/Fire squad fleet • The demand for mobile communication creates the need for • Service worker integration of wireless networks and existing fixed networks • Lonely wolf – Local area networks: standardization of IEEE 802.11 or HIPERLAN • Disaster relief and Disaster alarm – Wide area networks: GSM and ISDN – Internet: Mobile IP extension of the Internet protocol IP • Games • Military / Security Distributed Computing Group MOBILE COMPUTING R. -

Faktenblatt GSM
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Bundesamt für Kommunikation BAKOM Juni 2015 Faktenblatt GSM Einführung GSM (Global System for Mobile Communications) ist ein äusserst leistungsfähiges und komplexes di gitales Mobilfunksystem der zweiten Generation (2G), das sehr viele Dienste, gute Betriebseigen schaften und eine hohe Sicherheit bietet. Mitte der achtziger Jahre wurde in Europa, den USA und in Japan eine Vielzahl von gegenseitig nicht kompatiblen analogen Mobilfunksystemen der ersten Generation (1G) eingeführt. Die bekanntesten Standards waren: AMPS (in den USA und Kanada), TACS (in England, Italien und Österreich), Radio- com 2000 (in Frankreich), C 450 (in Deutschland und Portugal) sowie NMT (in allen nordischen Län dern, in den Benelux-Staaten und in der Schweiz). Mit den Wachstumsraten dieser konventionellen analogen Mobilfunksysteme wurde bald klar, dass Planungen für ein zukünftiges digitales System mit deutlich höherer Kapazität notwendig waren. Ein weiteres Ziel eines solchen neuen Systems war internationale Kompatibilität zu erreichen, um das Flickwerk der unterschiedlichen analogen Netze zu ersetzen. Von 1982 bis 1990 entwickelte das ETSI (European Telecommunications Standards Institute) in Zu sammenarbeit mit der europäischen Industrie und den Netzbetreibern den GSM-Standard. Mit GSM wurde als W eltpremiere ein digitaler Mobilfunkstandard mit modernen Leistungsmerkmalen und vor allem für eine grenzüberschreitende Benutzung (Roaming) geschaffen. Das GSM-System war ursprünglich für den mobilen Sprachtelefoniedienst ausgelegt. Die steigende Nachfrage nach neuen schnelleren Datendiensten wurde schon bald erkannt und der GSM-Standard wurde mit neuen Funktionalitäten wie HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), GPRS (General Packet Radio Service) und EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) erweitert. Diese Dienste erlauben höhere Datenraten und bildeten die Basis für innovative neue Datendienste. -
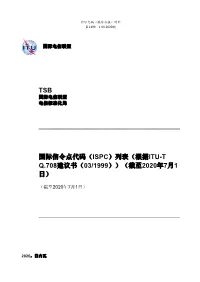
List of International Signalling Point Codes (ISPC)
国际电联《操作公报》附件 第1199 – 1.VII.2020期 国际电信联盟 TSB 国际电信联盟 电信标准化局 _______________________________________________________________ 国际信令点代码(ISPC)列表(根据ITU-T Q.708建议书(03/1999))(截至2020年7月1 日) (截至2020年7月1日) _______________________________________________________________ 2020,日内瓦 List of International Signalling Point Codes (ISPC) Note from TSB 1. This List of International Signalling Point Codes (ISPC) replaces the previous one published as Annex to the ITU Operational Bulletin No. 1109 of 1.X.2016. Since then, a number of notifications have been received at TSB and they have been published separately in various issues of the ITU Operational Bulletin. The present list recapitulates all the different amendments that have been published up to ITU Operational Bulletin No. 1199 of 1.VII.2020. 2. Recommendation ITU-T Q.708 states that the assignment of signalling area/network codes (SANC) is to be administered by TSB. Each country will then be responsible for the assignment of international signalling point codes (ISPC) that will then be notified to TSB. 3. The numbering plan of Recommendation ITU-T Q.708 contains 2 048 SANCs providing for 16 384 international signalling points. From these, currently 1 536 SANCs are available for assignment allowing for 12 288 international points. At present 1 055 SANCs are assigned; the reported utilization is 6 255 international signalling points. 4. In order to keep the list up to date, administrations are, therefore, requested to notify TSB, by using the notification form attached, as soon as an ISPC assignment or withdrawal is made, www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/ispc.aspx . 5. This List will be updated by numbered series of amendments published in the ITU Operational Bulletin.