Die Seele Der Seide – Eine Reise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2 Nd Quarterly
Magazine of the Documentation Center of Cambodia Searching for THE TRUTH The Impact of the World’s Most Influential People Coping with the Psychological Trauma of the Khmer Rouge « If justice has not been sought, the piled-up bones should not be SpecialEnglish Edition cremated. Proper cremation is not enough for the victims, for Second Quarter 2007 their spirits will not be in a peaceful state unless justice is found. We should build a stupa and place the bones inside.» -- Suos Phorn Searching for the truth. TABLE OF CONTENTS Magazine of the Documentation Center of Cambodia Special English Edition, Second Quarter 2007 EDITORIAL Good Leisure in Gloom, Dark Leisure in Bloom 1 Letters from Youk Chhang: The Impact of the World’s Most Influential People 3 Ethnic Minority Groups and the Legacy of the Khmer Rouge 4 DOCUMENTATION Youth Questions on the Khmer Rouge Tribunal 6 HISTORY Youths Seek Understanding on KR History 15 Discovery of the Sre Lieu Mass Grave 17 Tuol Sleng, a Reminder of the Past 20 To Be Starved Like a Prisoner 22 LEGAL Joint Statement by Judicial Officers 25 PUBLIC DEBATE Coping with the Psychological Trauma of the Khmer Rouge 26 DC-Cam’s Education Tours 31 Review of DC-Cam’s Genocide Education Project 37 Copyright © Resistance and Reconciliation: Examining the Muslim Community of Rwanda 43 Documentation Center of Cambodia Using Documents to Understand the All rights reserved. Khmer Rouge’s Security System 50 Licensed by the Ministry of Information of the Royal Government of Cambodia, Prakas No.0291 P.M99, FAMILY TRACING 2 August 1999. -
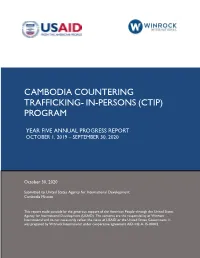
Cambodia Countering Trafficking- In-Persons (Ctip) Program
CAMBODIA COUNTERING TRAFFICKING- IN-PERSONS (CTIP) PROGRAM YEAR FIVE ANNUAL PROGRESS REPORT OCTOBER 1, 2019 – SEPTEMBER 30, 2020 October 30, 2020 Submitted to United States Agency for International Development Cambodia Mission This report made possible by the generous support of the American People through the United States Agency for International Development (USAID). The contents are the responsibility of Winrock International and do not necessarily reflect the views of USAID or the United States Government. It was prepared by Winrock International under cooperative agreement AID-442-A-15-00002. Annual Progress Report: October 2019 – September 2020 1 TABLE OF CONTENTS LIST OF FIGURES AND TABLES ............................................................................................................... 3 ANNEXES ........................................................................................................................................................ 3 ACRONYMS .................................................................................................................................................... 4 I. EXECUTIVE SUMMARY ....................................................................................................................... 5 II. GOALS AND OBJECTIVES ................................................................................................................. 9 III. ACTIVITIES AND PERFORMANCE AGAINST OBJECTIVES ................................................. 12 PREVENTION ............................................................................................................................................................. -

A STUDY of the NAMES of MONUMENTS in ANGKOR (Cambodia)
A STUDY OF THE NAMES OF MONUMENTS IN ANGKOR (Cambodia) NHIM Sotheavin Sophia Asia Center for Research and Human Development, Sophia University Introduction This article aims at clarifying the concept of Khmer culture by specifically explaining the meanings of the names of the monuments in Angkor, names that have existed within the Khmer cultural community.1 Many works on Angkor history have been researched in different fields, such as the evolution of arts and architecture, through a systematic analysis of monuments and archaeological excavation analysis, and the most crucial are based on Cambodian epigraphy. My work however is meant to shed light on Angkor cultural history by studying the names of the monuments, and I intend to do so by searching for the original names that are found in ancient and middle period inscriptions, as well as those appearing in the oral tradition. This study also seeks to undertake a thorough verification of the condition and shape of the monuments, as well as the mode of affixation of names for them by the local inhabitants. I also wish to focus on certain crucial errors, as well as the insufficiency of earlier studies on the subject. To begin with, the books written in foreign languages often have mistakes in the vocabulary involved in the etymology of Khmer temples. Some researchers are not very familiar with the Khmer language, and besides, they might not have visited the site very often, or possibly also they did not pay too much attention to the oral tradition related to these ruins, a tradition that might be known to the village elders. -

Exchanging Weapons for Development in Cambodia
i UNIDIR/2005/6 Exchanging Weapons for Development in Cambodia An Assessment of Different Weapon Collection Strategies by Local People Geofrey Mugumya UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research Geneva, Switzerland NOTE The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area, or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. * * * The views expressed in this paper are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the United Nations Secretariat. UNIDIR/2005/6 Copyright © United Nations, 2005 All rights reserved UNITED NATIONS PUBLICATION Sales No. GV.E.04.0.28 ISBN 92-9045-167-X The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR)—an intergovernmental organization within the United Nations—conducts research on disarmament and security. UNIDIR is based in Geneva, Switzerland, the centre for bilateral and multilateral disarmament and non- proliferation negotiations, and home of the Conference on Disarmament. The Institute explores current issues pertaining to the variety of existing and future armaments, as well as global diplomacy and local entrenched tensions and conflicts. Working with researchers, diplomats, Government officials, NGOs and other institutions since 1980, UNIDIR acts as a bridge between the research community and Governments. UNIDIR’s activities are funded by contributions from Governments and donors foundations. The Institute’s web site can be found at URL: http://www.unidir.org iv CONTENTS Page Preface. ix Acknowledgements . -

Report -Final-Education-Congress Report Eng.Pdf
Unofficial Translation CONTENTS Pages Part 1 : ACHIEVEMENT AND DIRECTION 1. INTRODUCTION 1 2. PROGRESS 1 2.1. Overall Achievements of Education, Youth and Sport Sectors 1 2.1.1 Progress of Joint Monitoring Indicators 1 2.1.2 Progress of Core Breakthrough Indicators 2 2.1.3 Progress of Fifteen-Point Reform Program 3 2.1.4 Progress of the Management and Implementation of Education Strategic Plan 9 2.1.4.1 Progress of Aid Management and Effectiveness 9 2.1.4.2 Progress of D&D Reform Implementation 11 2.1.4.3 Progress of Public Administrative Reform Implementation 12 2.1.4.4 Progress of Public Financial Management Reform Implementation 13 2.1.5 Progress of 2017 AOP Implementation at the National Level 16 2.1.6 Progress of the Implementation of Directions Set in Education Congress in 2016-2017 at the 18 National Level 2.1.7 Progress of the Implementation of Policy Actions in 2016, continued by 2017 and 2017 20 2.1.8 Progress of the Implementation of Action Plan of the Joint Sector Review Mission 2017 21 2.1.9 Progress of the Implementation of Action Plan for 2016-2017 at POE level 22 2.2. Results by Sub-Sectoral 24 2.2.1 Sub-Sector: Early Childhood Education 24 2.2.2 Sub-Sector: Primary Education 32 2.2.3 Sub-Sector: Secondary and Technical Education 43 2.2.4 Sub-Sector: Higher Education 57 2.2.5 Sub-Sector: Non-Formal Education 66 2.2.6 Sub-Sector: Youth Development 76 2.2.7 Sub-Sector: Physical Education and Sport 82 3. -

The Soul of Silk: a Journey
The Soul of Silk: A Journey Klaus Rink May 2020 The Soul of Silk: A Journey Siem Reap, September 2017 I’ve just landed in Siem Reap, and I enjoy a brief stroll outside to the arrivals terminal of this pleasantly small, manageable airport. It’s a bright, friendly place–even the smoking lounge is decorated with plants and flowers. Sambo Roeurn–my driver when I’m here, and he’s available–picks me up and takes me the few kilometers to the city. It’s still the rainy season, muggy and warm, with occasional downpours. Dust on the street, swirls up in the air. The provincial capital Siem Reap is a destination for many tourists, who use it as a base to visit the nearby Angkor Wat, often staying for three days with a three-day Angkor Pass. By confining their explorations to the temple, these tourists seldom set foot in the “other” Cambodia. Sambo, who has become a friend by this point, is always up for a great conversation about the current political situation and the country’s affairs. He’s been a driver for 15 years, and knows every turn by heart. He’s one of the hundreds of tuk-tuk drivers who make their daily rounds here, always on the lookout for passengers to offer day tours or one-way transports. “Hello, sir…”, “Tuk-tuk?” or “Where you go today?”, the drivers call out to potential passengers. With Sambo, I set out on the trip that’s been on my mind for weeks: to the weaving village I hold so dear. -

Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP)
RATP No. 10 ASIST Asia Pacific NRDP IRAP/GIS Project ….Reaching the Millennium Development Goals…. Integrated Rural Accessibility Planning (IRAP) Fourth Expert Group Meeting March 29-31, 2004, Siem Reap International Labour Organization Hosted by Ministry of Rural Development Regional Office for Asia and the Pacific Kingdom of Cambodia ANNEXES Annex 1 Foreword Annex 2 Opening Address Annex 3 List of Participants Annex 4 IRAP Report Annex 5 Cambodia Annex 6 Indonesia Annex 7 Philippines Annex 8 LAO PDR Annex 9 India Annex 10 Nepal Annex 11 Thailand Annex 12 Afghanistan ANNEX Foreword 11 Foreword Background The fourth regional IRAP meeting was held by ILO and the Ministry of Rural Development (MRD) in Siem Reap, Cambodia, from 29-31st March 2004. The ILO ASIST-AP Programme, jointly with the IRAP/GIS project under the Northwest Rural Development Programme (NRDP), organized and financed the meeting while MRD hosted the meeting. The main theme of the meeting was “Institutionalizing and Mainstreaming the IRAP approach” and about 25 participants representing 9 countries (Afghanistan, Cambodia, India, Indonesia, Laos, Nepal, Philippines, Thailand and Vietnam) attended the meeting. The Agenda and List of Participants are given in the Annexes. This Meeting Report includes all papers and presentations prepared for the meeting. The first regional IRAP meeting was funded by ILO, organized by the International Forum for Rural Transport and Development (IFRTD) and hosted by the Local Government Engineering Department (LGED) in Dhaka, Bangladesh, in 1997. The main objective was to introduce and discuss the IRAP approach which was at that time being developed in the Philippines and Laos. -
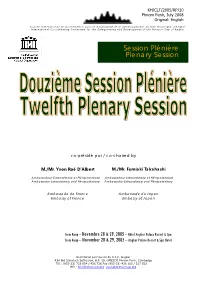
Report of the Ad Hoc Group of Experts on Behalf of the International
KH/CLT/2005/RP/10 Phnom Penh, July 2008 Original: English Comité International de Coordination pour la Sauvegarde et le Développement du Site Historique d'Angkor International Co-ordinating Committee for the Safeguarding and Development of the Historic Site of Angkor Session Plénière Plenary Session co-présidé par / co-chaired by M./Mr. Yvon Roé D’Albert M./Mr. Fumiaki Takahashi Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Ambassade de France Ambassade du Japon Embassy of France Embassy of Japan Siem Reap – Novembre 28 & 29, 2005 – Hôtel Angkor Palace Resort & Spa Siem Reap – November 28 & 29, 2005 – Angkor Palace Resort & Spa Hotel Secrétariat permanent du C.I.C. Angkor #38 Bld Samdech Sothearos, B.P. 29, UNESCO Phnom Penh, Cambodge Tél.: (855-23) 723 054 / 426 726 Fax (855-23) 426 163 / 217 022 Mél.: [email protected] [email protected] Douzième Session Plénière / Twelfth Plenary Session 1/152 STANDING SECRETARIAT • UNESCO Office Address : 38, blvd Samdech Sothearos BP 29 Phnom Penh Cambodia Tel.: (855) (23) 426 726 (855) (23) 723 054 / 725 071 (855) (12) 911 651 (855) (16) 831 520 (855) (12) 813 844 (855) (23) 720 841 Fax: (855) (23) 426 163 / 217 022 E-mail: [email protected] [email protected] [email protected] • Standing Secretariat in Paris Mr. Azedine BESCHAOUCH Scientific Advisor of the Sector of Culture in Phnom Penh Mr Blaise KILIAN Ms CHAU SUN Kérya (APSARA Authority) Mr. -

World Bank Document
First 18 months Procurement Plan I. General Public Disclosure Authorized 1. Bank’s approval Date of the procurement Plan February 1, 2017 2. Date of General Procurement Notice: July 2017 3. Period covered by this procurement plan: first 18 months II. Goods and Works and non-consulting services. 1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: Procurement Category Prior Review Threshold Comments US$ Public Disclosure Authorized 1. Goods and >= US$ 4 million All 2. Works >= US$ 15 million All 3. (Non-Consultant Services) >= US$ 4 million All 2. Prequalification. Not applicable. 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: Construction of New school buildings (30 sites), additional classrooms (100 sites), teacher accommodations (30 sites), on-demand school rehabilitation (70 sites), and rehabilitation of 25 POE, 99 DOE, and three RTTCs would be procured following the community participation procedures set out in the project operational manual. Public Disclosure Authorized 4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: As specified in the project legal agreement. 5. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 months after project effectiveness. 1 2 3 4 5 6 7 Ref. Description Estimated Packages Domest Review Comments No. Cost ic by Bank US$ Prefere (Prior / Post) Public Disclosure Authorized million nce (yes/no) Constructio 11.35 At least No Post Communi n of New 357 ty school contract participat buildings packages ion (30 sites), procedur additional e classrooms (100 sites), teacher accommod ations (30 sites), on- demand school rehabilitati on (70 sites), and rehabilitati on of 25 POE, 99 DOE, and three RTTCs Procureme 3.15 Multiple No Post To be nt of contracts procured vehicles, centrally office by equipment, MoEYS office furniture, motorcycle s, school furniture, etc. -

Annual Report 2013
ANNUAL REPORT 2013 Self-confidence building and Children have chance to get the livelihood improvement of the holistic development poorest Counseling with the Poorest Liveilhood Improvement Krousar Yoeung Association is specialized in: Early Childhood Care and Development, Parenting, Child Club, Counseling (with poorest and vulnerable families, and people with disability), Livelihood Improvement, Family Health Improvement, and Vocational Training to disadvantage out-of-school youths. Contents Message from Chair of Board of Directors ............................................................................1 Message from Executive Director.......................................................................................... 2 1. Who are we? ...................................................................................................................... 3 1.1. Vision.......................................................................................................................... 3 1.2. Mission ....................................................................................................................... 3 1.3. Values ........................................................................................................................ 3 2. Strategic Plan 2009-2013....................................................................................................4 3. Krousar Yoeung from 2010-2013 ....................................................................................... 4 4. Beneficiaries of Kory’s -

Banteay Srei Annual Report 2014
BANTEAY SREI Annual Report 01 January – 31 December 2014 Phnom Penh, 31 January 2015 CONTENTS CONTENTS ................................................................................................................................... 1 ACRONYMS ................................................................................................................................. 2 GENERAL INFORMATION ...................................................................................................... 3 VISION ......................................................................................................................................................................... 3 MISSION ....................................................................................................................................................................... 3 GOAL ........................................................................................................................................................................... 3 PROJECT OBJECTIVES .................................................................................................................................................. 3 BACKGROUND INFORMATION ...................................................................................................................................... 3 EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................................... 5 COUNTRY CHANGING CONTEXT ....................................................................................... -

Gender Equality in Practice of Child Clubs, Community Based Child Protection Mechanisms and Parents/Caregivers Groups Report
JUNE 2019 GENDER EQUALITY IN PRACTICE OF CHILD CLUBS, COMMUNITY BASED CHILD PROTECTION MECHANISMS AND PARENTS/CAREGIVERS GROUPS REPORT ROBIN MAUNEY, RACHAN SRUN INDEPENDENT CONSULTANTS Phnom Penh CONTENTS Abbreviations ...................................................................................................................................................... 4 Executive Summary ............................................................................................................................................. 5 1. Introduction ..................................................................................................................................................... 9 1.1 Country Context .................................................................................................................................. 9 1.2 Objectives of the Study ..................................................................................................................... 10 2. Methodology ............................................................................................................................................. 10 2.1 Research Questions ........................................................................................................................... 10 2.2 Literature Review .............................................................................................................................. 11 2.3 Primary Data Collection ....................................................................................................................