Packet Radio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Examining Ambiguities in the Automatic Packet Reporting System
Examining Ambiguities in the Automatic Packet Reporting System A Thesis Presented to the Faculty of California Polytechnic State University San Luis Obispo In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Science in Electrical Engineering by Kenneth W. Finnegan December 2014 © 2014 Kenneth W. Finnegan ALL RIGHTS RESERVED ii COMMITTEE MEMBERSHIP TITLE: Examining Ambiguities in the Automatic Packet Reporting System AUTHOR: Kenneth W. Finnegan DATE SUBMITTED: December 2014 REVISION: 1.2 COMMITTEE CHAIR: Bridget Benson, Ph.D. Assistant Professor, Electrical Engineering COMMITTEE MEMBER: John Bellardo, Ph.D. Associate Professor, Computer Science COMMITTEE MEMBER: Dennis Derickson, Ph.D. Department Chair, Electrical Engineering iii ABSTRACT Examining Ambiguities in the Automatic Packet Reporting System Kenneth W. Finnegan The Automatic Packet Reporting System (APRS) is an amateur radio packet network that has evolved over the last several decades in tandem with, and then arguably beyond, the lifetime of other VHF/UHF amateur packet networks, to the point where it is one of very few packet networks left on the amateur VHF/UHF bands. This is proving to be problematic due to the loss of institutional knowledge as older amateur radio operators who designed and built APRS and other AX.25-based packet networks abandon the hobby or pass away. The purpose of this document is to collect and curate a sufficient body of knowledge to ensure the continued usefulness of the APRS network, and re-examining the engineering decisions made during the network's evolution to look for possible improvements and identify deficiencies in documentation of the existing network. iv TABLE OF CONTENTS List of Figures vii 1 Preface 1 2 Introduction 3 2.1 History of APRS . -

Digital Radio Technology and Applications
it DIGITAL RADIO TECHNOLOGY AND APPLICATIONS Proceedings of an International Workshop organized by the International Development Research Centre, Volunteers in Technical Assistance, and United Nations University, held in Nairobi, Kenya, 24-26 August 1992 Edited by Harun Baiya (VITA, Kenya) David Balson (IDRC, Canada) Gary Garriott (VITA, USA) 1 1 X 1594 F SN % , IleCl- -.01 INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE Ottawa Cairo Dakar Johannesburg Montevideo Nairobi New Delhi 0 Singapore 141 V /IL s 0 /'A- 0 . Preface The International Workshop on Digital Radio Technology and Applications was a milestone event. For the first time, it brought together many of those using low-cost radio systems for development and humanitarian-based computer communications in Africa and Asia, in both terrestrial and satellite environments. Ten years ago the prospect of seeing all these people in one place to share their experiences was only a far-off dream. At that time no one really had a clue whether there would be interest, funding and expertise available to exploit these technologies for relief and development applications. VITA and IDRC are pleased to have been involved in various capacities in these efforts right from the beginning. As mentioned in VITA's welcome at the Workshop, we can all be proud to have participated in a pioneering effort to bring the benefits of modern information and communications technology to those that most need and deserve it. But now the Workshop is history. We hope that the next ten years will take these technologies beyond the realm of experimentation and demonstration into the mainstream of development strategies and programs. -

Mind the Uppercase Letters
Integration of APRS Network with SDI Tomasz Kubik1,2, Wojciech Penar1 1 Wroclaw University of Technology 2 Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Abstract. From the point of view of large information systems designers the most important thing is a certain abstraction enabling integration of heterogeneous solutions. Abstraction is associated with the standardization of protocols and interfaces of appropriate services. Behind this façade any device or sensor system may be hidden, even humans recording their measurements. This study presents selected topics and details related to two families of standards developed by OGC: OpenLS and SWE. It also dis- cusses the technical details of a solution built to intercept radio messages broadcast in the APRS network with telemetric information and weather conditions as payload. The basic assumptions and objectives of a prototype system that integrates elements of the APRS network and SWE are given. Keywords: SWE, OpenLS, APRS, SDI, web services 1. Introduction Modern measuring devices are no longer seen as tools for qualitative and quantitative measurements only. They have become parts of highly special- ized solutions, used for data acquisition and post-processing, offering hardware and software interfaces for communication. In the construction of these solutions the latest technologies from various fields are employed, including optics, precision mechanics, satellite and information technolo- gies. Thanks to the Internet and mobile technologies, several architectural and communication barriers caused by the wiring and placement of the sensors have been broken. Only recently the LBS (Location-Based Services) entered the field of IT. These are information services, available from mo- bile devices via mobile networks, giving possibility of utilization of a mobile This work was supported in part by the Polish Ministry of Science and Higher Edu- cation with funds for research for the years 2010-2013. -

THE EASTNET NETWORK CONTROLLER David W. Borden
THE EASTNET NETWORK CONTROLLER David W. Borden, K8MMO Director, AMRAD Rt. 2, Box 233B Sterling, VA 22170 Abstract clock s eed, the noisy 74LS138 I/O decoder and slow 27 88 EPROMs. Bill Ashby has been trying toI This paper describes a proposed packet radio get it to function at 9600 baud and has failed. network control computer running at high packet baud rates on the East Coast Amateur Packet The Tucson Amateur Packet Radio (TAPR) Network, EASTNET. Principally discussed is the terminal node controller may go higher speeds than digital hardware, but also mentioned is some crude 1200 baud by not using the on board modem and RF hardware to accompany the control computer. The cranking up the clock speed. However, Tom CPar‘k, digital side uses STD bus hardware developed by W3IWI sa s the interrupt structure may be overrun Jon Bloom, KE3Z to begin testin and eventually at 9600 IT aud. This represents an unknown at this will use the AMRAD Packet Assem% 'ler Disassembler point. There ap ears no way to go 48K bit/second (PAD) board running in an S-100 Bus (IEEE-696) or greater spee cr. computer. The Bill Ashby terminal node controller has Introduction been tested at 96010 baud and works well. It probably will not go faster than that, but Bill is' The basis of a real packet radio network is testing it. the packet switch, which in its simplest implementation is a two port HDLC I/O board The AMRAD Packet Assembler Disassembler (PAD) running in a microcomputer. board, designed by Terry Fox, WB4JF1, exists only as a prototype board currently with plans for A Z80 based, STD bus computer has been making printed circuit boards sometime in the assembled which is capable of sending and future. -

Ad Hoc Networks – Design and Performance Issues
HELSINKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Department of Electrical and Communications Engineering Networking Laboratory UNIVERSIDAD POLITECNICA´ DE MADRID E.T.S.I. Telecomunicaciones Juan Francisco Redondo Ant´on Ad Hoc Networks – design and performance issues Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Telecommunications Engineering Espoo, May 2002 Supervisor: Professor Jorma Virtamo Abstract of Master’s Thesis Author: Juan Francisco Redondo Ant´on Thesis Title: Ad hoc networks – design and performance issues Date: May the 28th, 2002 Number of pages: 121 Faculty: Helsinki University of Technology Department: Department of Electrical and Communications Engineering Professorship: S.38 – Networking Laboratory Supervisor: Professor Jorma Virtamo The fast development wireless networks have been experiencing recently offers a set of different possibilities for mobile users, that are bringing us closer to voice and data communications “anytime and anywhere”. Some outstanding solutions in this field are Wireless Local Area Networks, that offer high-speed data rate in small areas, and Wireless Wide Area Networks, that allow a greater mobility for users. In some situations, like in military environment and emergency and rescue operations, the necessity of establishing dynamic communications with no reliance on any kind of infrastructure is essential. Then, the ease of quick deployment ad hoc networks provide becomes of great usefulness. Ad hoc networks are formed by mobile hosts that cooperate with each other in a distributed way for the transmissions of packets over wireless links, their routing, and to manage the network itself. Their features condition their design in several network layers, so that parameters like bandwidth or energy consumption, that appear critical in a multi-layer design, must be carefully taken into account. -

KISS/SLIP TNC Description
A simple TNC for megabit packet-radio links Matjaž Vidmar, S53MV 1. Computer interfaces for packet-radio Computers were essential parts of packet-radio equipment right from its beginning more than two decades ago. Since at that time computers were not easily available and were much less capable than today, most amateurs started their activity on packet-radio with an old ASCII terminal. The ASCII terminal required an interface called TNC (Terminal Node Controller). The TNC interface lead to a standardization of the protocol used and to a worldwide acceptance of the AX.25 standard. Today there are many different interfaces called TNC. The most popular is the TNC2, originally developed by TAPR (Tucson Area Packet Radio) and afterward cloned elsewhere. Lots of software was written for the TNC2 too, ranging from simple terminal interfaces to complex computer interfaces and even network nodes. As more powerful computers became available, some functions of the TNC were no longer required. In fact, some early TNC software, designed to work with dumb ASCII terminals, represented a bottleneck for efficient computer file transfer or multi-connect operation. Most functions of the TNC were therefore transferred to the host computer using the simple KISS protocol, originally developed for TCPIP operation only. Unfortunately, the KISS protocol adds additional delays in any packet-radio connection. Today most computers allow a direct steering of a radio modem up to about 10kbit/s, making the TNC completely unnecessary. For higher speeds, different interface cards were developed. These cards are plugged directly into the ISA bus of IBM PC clones to avoid the delays and other problems caused by external interfaces. -
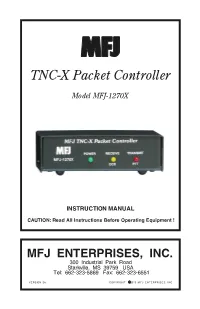
TNC-X Packet Controller
TNC-X Packet Controller Model MFJ-1270X INSTRUCTION MANUAL CAUTION: Read All Instructions Before Operating Equipment ! MFJ ENTERPRISES, INC. 300 Industrial Park Road Starkville, MS 39759 USA Tel: 662-323-5869 Fax: 662-323-6551 VERSION 2A COPYRIGHT 2013 MFJ ENTERPRISES, INC. MFJ-1270X Instruction Manual TNC-X Packet Contoller DISCLAIMER Information in this manual is designed for user purposes only and is not intended to supersede information contained in customer regulations, technical manuals/documents, positional handbooks, or other official publications. The copy of this manual provided to the customer will not be updated to reflect current data. Customers using this manual should report errors or omissions, recommendations for improvements, or other comments to MFJ Enterprises, 300 Industrial Park Road, Starkville, MS 39759. Phone: (662) 323-5869; FAX: (662) 323-6551. Business hours: M-F 8-4:30 CST. 2 MFJ-1270X Instruction Manual TNC-X Packet Contoller Introduction................................................................................................4 Power Requirements .........................................................................5 Terminal Speed..................................................................................5 Setup If You Are Using USB..................................................................5 Setup If You Are Using the TNC’s Serial Port .......................................6 Back Connections..................................................................................6 Radio Setup...............................................................................................7 -

(Pdf) Download
1 2 • Winlink programs group: “Official Group to support Winlink Team developed Products, both user and gateway software” • Winlink_for_EmComm: “Supports the discussion and use of the Winlink network and Winlink products for emergency or event support communications. ” 3 4 5 6 7 8 1. Digital voice radio works in exactly the same fashion, except that it deals with audio input, not text. 2. PACKET-1200 uses frequency shift keying (FSK) modulation with a 1000Hz shift and 1200 Bd symbol rate. There are a number of variations for PACKET-1200, including a PSK-based satellite version. PACKET-1200 can be seen in the VHF and UHF bands with indirect FM Modulation. FM bandwidth is 12 kHz. 3. See https://www.sigidwiki.com/wiki/PACKET#PACKET-1200 9 10 11 12 • That’s the packet sound • Each individual packet! • Carrier detect • ”NAK” = “NO ACKNOWLEDGEMENT” – resend • ”ACK” – “ACKNOWLEDGEMENT” – send the next packet • Too many retries, and the sending station stops sending (connection is dropped) • Breaking the message into small packets makes it easier to send a large message. But ALL packets MUST be received in order for the message to be read, 13 • One bye = 8 bits = 1 alphanumeric character • See https://tapr.org/pub_ax25.html • FLAG: start and end of each packet • Address: sender, receiver, and the path in between • Control (CTRL): The control field is responsible for identifying the type of “frame” being sent, and is also used to convey commands and responses from one end of the link to the other in order to maintain proper link control • The length of DATA is ≤ 255, and is set by the use. -

Packet Radio O Verview
P a c k e t R a d io O v e r v ie w P re s e n t e d b y M a tt V K 2 R Q What is Packet Radio? ● One of many digital modes available in Amateur Radio ● Transmited information is received 100% error free! ● Divide data stream into bite-sized packets ● Sends a “packet” of data (envelope + payload) at a time ● At VHF/UHF, typically operates at 1200 baud (AFSK on FM) or 9600 baud (G3RUH FSK) ● At HF, typically operates at 300 baud (FSK/AFSK on SSB) Flag Flag Header Payload CHK (01111110) (01111110) High level structure of a packet 2 Typical Packet Stations Simplex Simplex BBS Radio (HT, Mobile, Base) Radio-specific (audio) Cable (may have PTT line, or use VOX) Soft TNC TNC (Terminal Node Controller) (use PC soundcard) RS-232 Cable PC Running Winpak and PacForms 3 3 AX25 Frames ● Can have Information (I), Unnumbered (U) and Supervisory (S) frames ● I-frames use sequence numbers to ensure packets are received in the right order and are retransmited if needed (like TCP). A connection must frst be established between the two stations. ● UI-frames allow packets of information to be sent without frst establishing a connection. Correct ordering of packets and retransmission requests not supported (like UDP). APRS uses this type of frame. ● Fully described in the AX.25 Link Access Protocol standard: htp://www.tapr.org/pdf/AX25.2.2.pdf Address Control Proto Info FCS DST CS DST SRC CS SRC Digi1 CS Digi1 7 6 5 4 3 2 1 0 eg. -

Marc 2020.08.13
Packet Radio Murray Amateur Radio Club (MARC) Jan L. Peterson (KD7ZWV) What is it? u Packet Radio is a digital communications mode where data is sent in ”packets.” u So what are packets? u Packets are discrete collections of data, typically called “datagrams”, that have assorted headers and trailers added to handle things like addressing, routing, and data integrity. u I’ve never heard of such a thing? u Sure you have... you’re using it right now. The Internet uses packet technology, and if you are using Wi-Fi, you are already using a form of packet radio! History u Radio is essentially a broadcast medium... many or all nodes are connected to the same network. u In the early 1970s, Norman Abramson of the University of Hawaii developed the ALOHAnet protocol to enable sharing of this medium. u Work done on ALOHAnet was instrumental in the development of Ethernet in the mid-to-late 1970s, including the choice of the CSMA mechanism for sharing the channel. u In the mid-1970s, DARPA created a system called PRNET in the bay area to experiment with ARPANET protocols over packet radio. History u In 1978, amateurs in Canada started experimenting with transmitting ASCII data over VHF using home-built hardware. u In 1980, the Vancouver Area Digital Communications Group started producing commercial hardware to facilitate this... these were the first Terminal Node Controllers (TNCs). u The FCC then authorized US amateurs to send digital ASCII data over VHF, also in 1980, including the facility for “digipeaters” or digital repeaters. u This started rolling out in San Francisco in late 1980 with a system called AMPRNet. -

Santa Clara County Enhanced BBS Implementation Guide
County Packet Network System Description Prepared for: County Packet Committee Santa Clara County RACES Author: Jim Oberhofer KN6PE Date: May 2009 Vision: V0.5, WORK IN PROGRESS County Packet System Description Santa Clara County RACES Table of Contents 1 INTRODUCTION............................................................................................................................... 1 1.1 INTRODUCTION............................................................................................................................. 1 1.2 TERMS AND ABBREVIATIONS ....................................................................................................... 1 2 REQUIREMENTS.............................................................................................................................. 3 2.1 IN GENERAL ................................................................................................................................. 3 2.2 ASSUMPTIONS .............................................................................................................................. 3 2.3 PARTICIPATING ORGANIZATIONS.................................................................................................. 4 3 SYSTEM OVERVIEW ...................................................................................................................... 5 3.1 IN GENERAL ................................................................................................................................. 5 3.2 CITY/AGENCY SPECIFICS ............................................................................................................ -

Telecommunications: Making Sense of New Technology and New Legislation
DOCUMENT RESUME ED 267 735 IR 012 026 AUTHOR Divilbiss, James L., Ed. TITLE Telecommunications: Making Sense of New Technology and New Legislation. Papers Presented at the 1984 Clinic on Library Applicatio-s of Data Processing (April 14-16, 1984). INSTITUTION Illinois Univ., Urbana. Graduate School of Library and Information Science. REPOT NO ISBN-0-87845-072-6 PUB DATE 85 NOTE 120p. AVAILABLE FROMGraduate School of Library & Information Science, Publications Office, 249 Armory Building, 505 E. Armory Street, Champaign, Illinois 51820 ($15.00). PUB TYPE Collected Works - Conference Proceedings (021)-- Viewpoints (120) -- Guides - General (050) EDRS PRICE MF01 Plus Postage. PC Not Available from EDRS. DESCRIPTORS Electronic Equipment; Electronic Mail; Federal Legislation; *Information Networks; *Libraries; *Library Automation; *Online Systems; Position Papers; Radio; Technological Advancement; *Telecommunications; Teleconferencing IDENTIFIERS Office Automation; *Online Catalogs ABSTRACT This collection of papers addresses the impact of rapidly changing telecommunications technology on libraries. A brief introduction by dames L. Divilbiss sets the stage for the fallowing papers: (1) "Making Sense of New Technologies and New Legislation" (Joseph Ford); (2) "Selection and Use of Telecommunications Consultants for Library Automation" (Rodney B. Perry); (3) "Modeling Library Communications Traffic" (John C. Kountz); (4) "Telecommunications for Libraries" (Richard W. Boss); (5) "A Collection of Books" (Herbert P. Crane); (6) "Telecommunications in the Office" (Michael A. Flavin); (7) "Electronic Mail Services in the Library and Information Center Community" (Dennis Oliver;; (8) "Packet Radio for Library Online Catalogs" (Edwin B. Brownrigg); (9) 'Narrowband Teleconferencing" (Joan Maier McKean); and (10) "Establishing a Data Communications Network: A Case Stuay" (Deborah K. Conrad). (THC) *********************************************************************** Reproductions supplied by EDRS are the best thatcan be made from the original document.