Das Rauriser Weglohnbuch Des Michael Aster Über Die Mauteinnahmen Vom 1
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
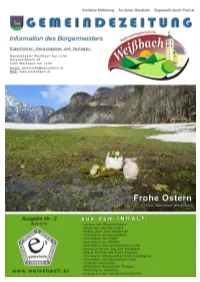
Download Bereit Bzw
Bild Inhalt - Vorwort des Bürgermeisters - Neues aus dem Naturpark - Kneipp aktiv Club Saalachtal - Information Kinderreisepass - Information der SGKK - Information der ZEMKA - Information Seniorenwohnheim Lofer - Rückblick Winter des USV Weißbach - Mobile Rufhilfe des Roten Kreuzes - Information Arbeitnehmer/innenveranlagung - Information der Hauptschule Lofer - Clubkids Information - Information Sozialmarkt Pinzgau - Wohnung zu vermieten - Auszug aus der Jahresrechnung 2011 Klammeingangssteg sowie der Steg beim Haus Liebe Weißbacherinnen, OW 17 (Rudi Haitzmann) erneuert werden. Weiters Liebe Weißbacher! soll die Weißbachbrücke beim Haus OW 19 (Fam. Stockklauser) erneuert werden. Diese wird aller Voraussicht nach um 30 bis 50 cm angehoben, um den Durchfluss des Weißbaches bei Hochwasserereignissen zu erhöhen. Diese Maßnahme war bereits bei der Schutzverbauung des Weißbaches 2005 angedacht. Auf jeden Fall wird es dadurch zu notwendigen Sperren der Brücken kommen. Ich bitte jetzt schon alle davon In den letzten Tagen und Wochen haben einige Betroffenen um ihr Verständnis. sehr wichtige Ereignisse für die Gemeinde Weißbach stattgefunden. Wie jedes Jahr stellte das Frühjahrskonzert unserer Trachtenmusikkapelle im Turnsaal der Hauptschule Zum einen wurde der Spatenstich für das Lofer den Auftakt des musikalischen Jahres dar. Seniorenwohnheim Unken – Lofer - St. Martin - Mit dem Mut zu neuem haben Kapellmeister Sepp Weißbach durchgeführt. Die Bauarbeiten gehen Hagn und seine Musikanten wieder einmal nun sehr zügig voran. Die Fertigstellung und somit bewiesen, zu welchen Leistungen sie fähig sind. die Übersiedlung der Bewohner wird Ende 2013 Neben den musikalischen Höchstleistungen sein. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, dass imponieren dabei die hervorragende Kamerad- unsere ortsansässige Baufirma Schmuck GmbH schaft und der Zusammenhalt. Ich freue mich nun doch nicht mit dem Bau beauftragt wurde. Mit schon jetzt auf die kommenden Ausrückungen Ende März 2012 ist die Leiterin des unserer Musikkapelle. -

Salzburger Landesrechnungshof Bericht Zur Marktgemeinde Rauris
Salzburger Landesrechnungshof Bericht zur Marktgemeinde Rauris August 2015 003–3/164/6-2015 Landesrechnungshof Marktgemeinde Rauris Kurzfassung Der LRH prüfte die formale Führung sowie die Gebarung der Marktgemeinde Rauris auf Grund der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen. Zusätzlich wurden die betrieblichen Einheiten sowie die Beteiligung an der Rauris Entwicklungs GmbH, der Marktgemeinde Rauris Immobilien KG und der ARGE Therme Unterpinzgau GmbH einer Überprüfung unterzogen, ob eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Führung gewährleistet ist. Weiters erfolgte auch eine Einschau in die Abwicklung von Bauvorhaben und deren Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt in den Jahren 2011 bis 2013. Die Analyse der Haushaltsdaten zeigte, dass die Marktgemeinde Rauris über Jahre hinweg hohe Steuerrückstände ausweist. Im gesamten Prüfzeitraum erhielt die Marktgemeinde Mittel aus dem Gemeindeausgleichsfonds zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung des Haushaltsgleichgewichtes. Die vom GAF erhaltenen Mittel wurden nicht zur Reduktion der Schulden eingesetzt, sondern wurden damit neue Investitionen über Pflichtaufgaben hinaus getätigt. Die formalen Erfordernisse nach den Vorgaben der Salzburger Gemeindeordnung wurden größtenteils eingehalten. Von der Gemeinde ist verstärkt ein Augenmerk darauf zu legen, dass das Mindestmaß an Sitzungen der Gemeindevertretung als auch jener der Ausschüsse den gesetzlichen Anforderungen entspricht. Weiters sind die Niederschriften der Sitzungen der Gemeindevorstehung in der nächstfolgenden Sitzung zur Richtigstellung -

Letter from Salzburg, June 2019 How He Used His Degree and Study-Abroad Experience to Find a Job in Germany
SUMMER 2019 in Cologne, gave the first of two presentations. He explained what he does and Letter from Salzburg, June 2019 how he used his degree and study-abroad experience to find a job in Germany. Subsequently Dan graciously allowed several of our students to shadow him on business trips to Vienna and Munich. At the second European careers session In another few weeks, AYA Salzburg 2018-19 will come to a close. I would Kimme Scherer (M.A. 2005), who lives in Salzburg, spoke about her experience as a love to say to this moment in time: “Verweile doch, du bist so schön!” (Yes, translator in Austria. we went to see Faust I at the Landestheater!) It has been another wonderful year in Salzburg, my eighth and last year directing the AYA program. Extremely gratifying for me this year has been having so much contact with former AYA participants, first in summer 2018 – at the 50-year celebration and during the The year was filled with excursions, often led by our geography instructor Fritz Salzburg summer program, which I directed – then throughout the year as many Baier, including orientation walks through Salzburg and daylong excursions alumni travelling through Salzburg stopped by. To name a few: Amy Young (M.A. into the countryside, e.g. to the Dürrnberg salt mines and Keltic museum in 1994), Jenn Hesse (M.A. 2011), Brian Pfaltzgraff (dual M.A. German/Music 1994) Hallein and to the Nationalpark Hohe Tauern, where we went snow-shoeing. and, most recently, Kenneth Sponsler (AYA 1977-78). In the fall we went to Vienna for the traditional week-end stay. -

Blatt 150 Mayrhofen Blatt 154 Rauris
Blatt 150 Mayrhofen Siehe Bericht zu Blatt 149 Lanersbach von JERZY ZASADNI Blatt 154 Rauris Bericht 2010 to the north), where it extends up to 1750 or 1850 m a.s.l. über geologische Aufnahmen Up to 3 more or less pronounced steps can be seen on der quartären Sedimente im Naßfeld this slope, probably marking the extent of the glacier dur- und Umgebung (Gasteinertal) ing the Würm post-maximum stages. Peat-bogs (currently auf Blatt 154 Rauris protected) have developed on some of these steps. A very well pronounced slope step occurs on an altitude JANUSZ MAGIERA of about 1900-2000 m a.s.l. and extends south from the (Auswärtiger Mitarbeiter) vicinity of Mooskarl for some distance up the Weißenbach The investigated area consists of three different geo- valley. Gently sloping areas above this step are probably morphologic zones, each with different Quaternary sedi- part of a valley shoulder that developed during the late ments and landforms. The Naßfeld valley is the largest part of the Würm glacial stage. of these zones: its wide and relatively flat floor is formed The slopes on the south-west side of the Naßfeld valley from the remnants of a moraines, fluvioglacial sediments, are mostly rocky, with only few patches of moraine. A large and postglacial alluvia. On either side of the Naßfeld val- landslide on the slope to the west of Moisesalm probably ley are slopes and hanging valleys with moraines from Ho- occurred during the post-1850 warming. locene and contemporaneous glaciers. Finally, the narrow, Parts of the slope on the north-west side of the Naßfeld incised Nassfelder-Ache valley forms a steep outlet from valley (above Sportgastein) have been modified by inten- the Naßfeld valley towards the north-east. -

Recco® Detectors Worldwide
RECCO® DETECTORS WORLDWIDE ANDORRA Krimml, Salzburg Aflenz, ÖBRD Steiermark Krippenstein/Obertraun, Aigen im Ennstal, ÖBRD Steiermark Arcalis Oberösterreich Alpbach, ÖBRD Tirol Arinsal Kössen, Tirol Althofen-Hemmaland, ÖBRD Grau Roig Lech, Tirol Kärnten Pas de la Casa Leogang, Salzburg Altausee, ÖBRD Steiermark Soldeu Loser-Sandling, Steiermark Altenmarkt, ÖBRD Salzburg Mayrhofen (Zillertal), Tirol Axams, ÖBRD Tirol HELICOPTER BASES & SAR Mellau, Vorarlberg Bad Hofgastein, ÖBRD Salzburg BOMBERS Murau/Kreischberg, Steiermark Bischofshofen, ÖBRD Salzburg Andorra La Vella Mölltaler Gletscher, Kärnten Bludenz, ÖBRD Vorarlberg Nassfeld-Hermagor, Kärnten Eisenerz, ÖBRD Steiermark ARGENTINA Nauders am Reschenpass, Tirol Flachau, ÖBRD Salzburg Bariloche Nordkette Innsbruck, Tirol Fragant, ÖBRD Kärnten La Hoya Obergurgl/Hochgurgl, Tirol Fulpmes/Schlick, ÖBRD Tirol Las Lenas Pitztaler Gletscher-Riffelsee, Tirol Fusch, ÖBRD Salzburg Penitentes Planneralm, Steiermark Galtür, ÖBRD Tirol Präbichl, Steiermark Gaschurn, ÖBRD Vorarlberg AUSTRALIA Rauris, Salzburg Gesäuse, Admont, ÖBRD Steiermark Riesneralm, Steiermark Golling, ÖBRD Salzburg Mount Hotham, Victoria Saalbach-Hinterglemm, Salzburg Gries/Sellrain, ÖBRD Tirol Scheffau-Wilder Kaiser, Tirol Gröbming, ÖBRD Steiermark Schiarena Präbichl, Steiermark Heiligenblut, ÖBRD Kärnten AUSTRIA Schladming, Steiermark Judenburg, ÖBRD Steiermark Aberg Maria Alm, Salzburg Schoppernau, Vorarlberg Kaltenbach Hochzillertal, ÖBRD Tirol Achenkirch Christlum, Tirol Schönberg-Lachtal, Steiermark Kaprun, ÖBRD Salzburg -

Winterurlaub Im Skigebiet Der Klimafreundlichen Rauriser Hochalmbahnen
Presse-Information … in Kürze Oktober 14 RAURISERTAL Seite 1 Winterurlaub im Skigebiet der klimafreundlichen Rauriser Hochalmbahnen Die Rauriser Hochalmbahnen haben sich als erstes Seilbahnunternehmen überhaupt voll und ganz dem Klimaschutz verschrieben und sind deshalb auch anerkannter Klimabündnisbetrieb. Für Wintersportler bedeutet das: Sie be- treiben mit gutem Gewissen in einer alpinen Region Sport, die äußerst sorgsam mit den Ressourcen Wasser und Energie umgeht. Zwar sind die 30 Pistenki- lometer im Raurisertal durch ihre natürliche Höhenlage (950 m bis 2.175 m) schneesicher –, dennoch erlauben moderne Beschneiungsanlagen auch dann den Skibetrieb, wenn das Wetter einmal Kapriolen schlägt. Das wertvolle Wasser nutzen die Rauriser Hochalmbahnen übrigens gleich zweimal: für die Produktion von Maschinenschnee und für die Stromerzeugung. Das eigene Kraftwerk liefert übrigens mit dem erneuerbaren Energieträger Wasser rund 1,2 Mio. Kilowatt – und damit mehr Ökostrom, als für den Betrieb der Seilbahnen und der Beschneiungsanlage zusammen benötigt wird. Damit starten die Rauri- ser Hochalmbahnen vollends energieautark in die kommende Wintersaison, die von 12. bis 14. Dezember 2014 mit einem „Goldenen Winterauftakt- Wochenende“ eingeläutet wird! Das ganze Wochenende über gelten Son- dertarife: Die Tageskarte für Erwachsene kostet dann 23,50 Euro, eine Kinder- karte 14,50 Euro und eine Jugendkarte (Jahrgänge 1998 bis 1996) 20 Euro. Kinder ab dem Geburtsjahr 2009 und jünger fahren überhaupt zum Nulltarif! Abseits des Massentourismus ist das Rauriser Skigebiet ein wahrer Geheim- tipp im Salzburger Land – übersichtlich und trotzdem vielfältig mit Abfahrten in allen Schwierigkeitsgraden! Traumhafte Nordost-Hänge, ein glitzerndes Tief- schneeparadies, der Nuggetpark für Boarder und Freestyler und nicht zuletzt gemütliche Hütten machen dort Skitage für Groß und Klein zum absoluten Wintererlebnis. -

Page 1 108 IA at 592.103.630 Kohut Philipp Rauris in Si 111 110 *AT
Jubiläumsausstellung 50 Jahre Zuchtgebiet "Mitterpinzgau" am 27. September 2015 in Rauris RANG STD.NR KL. LEB. NR. BESITZER 12. Gruppe: Tiroler Bergschaf - Widder über 3 Jahre 1. 108 IA AT 592.103.630 Kohut Philipp Rauris 13. Gruppe: Tiroler Bergschaf - Widder 2 - 3 Jahre 1. 111 IA *AT 865.641.830 Fletzberger Herbert Rauris 2. 110 IA AT 215.801.540 Schwab Matthias u. Simone Fusch a.d.Glstr. 3. 109 IA AT 873.167.130 Pirchner Jakob u. Christine Rauris 14. Gruppe: Tiroler Bergschaf - Widder 1 - 2 Jahre 1. 112 IA AT 869.186.630 Hartl Martin u. Sandra Saalfelden 2. 115 IB AT 862.583.230 Fletzberger Herbert Rauris 3. 114 IB AT 862.579.630 Fletzberger Herbert Rauris 4. 113 IB AT 983.151.530 Langreiter Johann u. Roswitha Rauris 16. Gruppe: Tiroler Bergschafe über 6 Jahre 1. 118 IA AT 473.376.320 Pirchner Jakob u. Christine Rauris 2. 117 IA AT 683.136.720 Schwab Matthias u. Simone Fusch a.d.Glstr. 3. 120 IB AT 333.135.420 Schwab Matthias u. Simone Fusch a.d.Glstr. 4. 119 IIA AT 473.081.620 Fletzberger Herbert Rauris 17. Gruppe: Tiroler Bergschafe 4 - 6 Jahre 1. 122 IB AT 723.683.620 Pirchner Jakob u. Christine Rauris 2. 126 IB AT 304.253.830 Pirchner Jakob u. Christine Rauris 3. 123 IB AT 811.052.820 Schmuck Hofmeister ZG Leogang 4. 124 IIA AT 683.772.820 Rainer Josef Rauris 5. 127 IIA AT 302.720.930 Sommerer Konrad u. Renate Rauris 6. 125 IIA AT 302.713.130 Sommerer Thomas Rauris 18. -

Salzburgerlandcard 2021 – Mehr Urlaub Für Weniger Geld
SalzburgerLandCard 2021 – Mehr Urlaub für weniger Geld Freier Eintritt zu rund 180 Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen im ganzen Land Salzburg inklusive einer freien Fahrt auf der Großglockner Hochalpenstraße ODER inklusive 24-Stunden-Salzburg-Stadt-Card - Salzburg, eine der schönsten Städte der Welt für einen Tag lang, kostenlos erleben! Die SalzburgerLandCard ist erhältlich für 6 bzw. 12 Tage im Aktionszeitraum vom 1. Mai bis 26. Oktober. Aufgrund von COVID können die Öffnungszeiten der einzelnen Ausflugsziele abweichen. Bitte überprüfen Sie diese auf der jeweiligen Website. Attraktionen und Sehenswürdigkeiten in Uttendorf und Umgebung: Nr. Ereignis – Attraktion – Sehenswürdigkeit Öffnungszeiten Ersparnis in Euro 139 Pinzgauer Lokalbahn (Tageskarte) 1x frei 22,20 130 8-EUB Königsleiten Dorfbahn 19. Juni bis 10. Oktober 1x frei 17,60 95 Krimmler Wasserfälle 1. Mai bis 27. Oktober 1x frei 4,00 96 WasserWunderWelt Krimml 1. Mai bis 27. Oktober 1x frei 9,20 10 Freischwimmbad Krimml Juni bis Anf. September frei 5,00 123 Wildkogelbahnen Neukirchen oder Smaragdbahn Bramberg Ab 21. Mai – 17. Oktober 1x frei 27,00 53 Museum Wilhelmgut Bramberg Juni bis Oktober 1x frei 8,00 9 Badesee Hollersbach Juni bis September frei 5,20 17 Freischwimmbad Mittersill Juni bis September frei 5,00 18 Hallenbad Mittersill Ab Ende Mai täglich geöffnet 1x frei 18,30 97 Nationalparkzentrum Hohe Tauern Mittersill Täglich von 09.00-18.00 Uhr frei 12,00 33 Freibad Stuhlfelden Juni bis Anf. September frei 5,00 36 Erlebnisbadesee Uttendorf Juni – Ende August/saisonal frei 5,00 128 Weißsee Gletscherbahnen Uttendorf 18. Juni bis 03. Oktober 1x frei 25,00 (20% Ermäßigung auf Wiederholungsfahrten) 107 Keltendorf am Stoanabichl Uttendorf Mai bis Oktober frei 8,00 20 Badesee Niedernsill Juni bis Anf. -

Raurisertal: „Goldenes“ Hochtal in Der Sommersonne
Presse-Information Langtext Februar 16 RAURISERTAL Seite 1 Raurisertal: „Goldenes“ Hochtal in der Sommersonne Als „Goldenes Tal der Alpen“ gilt das einst vom Goldbergbau geprägte Raurisertal heute noch – und mit seinen fünf Seitentälern als eines der ursprünglichsten Hochtäler in den Alpen. Das 30 Kilometer lange Salzburger Raurisertal mit den Orten Rauris und Ta- xenbach ist die größte Gemeinde im Nationalpark Hohe Tauern und wird oft als sein „geheimes Juwel“ bezeichnet. Auch wenn die Zeiten des Goldabbaus bald ein Jahrhundert zurückliegen, steckt das Raurisertal voller Schätze: Die Kitzlochklamm am Taleingang ist eine der eindrucksvollsten Schluchten in den österreichischen Alpen. Den Sonnblick (3.106 m) am Talschluss krönt Eu- ropas höchstes ganzjährig bemanntes Observatorium. Die fünf Seitentäler bergen ursprüngliche Almenlandschaften, Mineralien des Tauernfensters und Gletscher. Das Seidlwinkltal war einst Hauptroute für den Saumhandel über die Alpen. Im Krumltal sind Steinadler, Bart- und Gänsegeier in freier Wild- bahn anzutreffen. Im Talschluss Kolm Saigurn scheint die Zeit stillzustehen. Der Rauriser Urwald ist mit seinen über 80 dunklen Moortümpeln, Sturzfichten, Zirben, saftig grünen Moosen und romantischen Lichtungen eine Erkundung wert. Und im Hüttwinkltal blickt man auf die Zeit der Goldgräber zurück. Die Orte Taxenbach, Rauris, Wörth und Bucheben im Raurisertal sind einfach über die Tauernautobahn zu erreichen. Von München sind es nur etwa 2,5 Stunden Autofahrt bis hierher. Anreise Raurisertal Auto: von Osten kommend über Linz/Salzburg/Bischofshofen oder Bruck a. d. Mur/Leoben/Bischofshofen; aus Nordwesten kommend über München/Salzburg/Bischofshofen; von Norden über Passau/Ried i. Inn- kreis/Salzburg/Bischofshofen Bahn: Anreise bis zum Bahnhof Taxenbach/Rauris möglich Flug: Low-Cost-Flüge nach Salzburg, Transfer ins Raurisertal mit Bus/Bahn/Taxi ca. -

Nationalpark Sommercard
THE MANY BENEFITS OF THE NATIONALPARK SOMMERCARD From 1 May 2018 until 31 October 2018 with the the ‘Nationalpark Sommercard there will be again an all-inclusive ticket for a holiday in the Hohe Tauern National Park holiday region. Guests re- ceive this ticket from their accommodation pro- vider on the day they arrive and with them get to avail of more than 60 attractions, such as the nu- merous cable cars and leisure and sports facilities, as well as free entry to sights, museums and nat- ural sights. The ‘Nationalpark Sommercard’ also ensures you enjoy maximum mobility, since you get to use local public transport free of charge. The day ticket for the ‘Großglockner alpine road’ and the day ticket for the Gerlos Alpenstraße are also included. Immediately after checking in you will receive your personal card from your accommodation. You can explore the characteristics and sights of the Hohe Tauern National Park holiday. Daily free entry with the Nationalpark Sommercard: Dorfbahn Koenigsleiten (ascent/descent) Wildkogelbahn Neukirchen (ascent/descent) Panoramabahn Hollersbach (ascent/descent) Smaragdbahn Bramberg (ascent/descent) Weissee Gletscherwelt (ascent/descent) Hochalmbahn Rauris (ascent/descent) incl. Panoramabahn Großarltal (ascent/descent) bird of prey demonstration & gold panning Swimming bath Krimml Kristallbad Wald im Pinzgau Swimming bath Mühlbach im Pinzgau Swimming lake Hollersbach Swimming bath Mittersill Indoor swimming pool Mittersill Swimming bath Stuhlfelden Swimming lake Uttendorf Swimming lake Niedernsill Swimming -

Perchtenlauf” in Its Relationship to the Carnivalesque
Ritual Rebellion and Social Inversion in Alpine Austria: Rethinking the “Perchtenlauf” in its Relationship to the Carnivalesque by David Natko A Thesis Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts Approved April 2014 by the Graduate Supervisory Committee: John Alexander, Chair Daniel Gilfillan Peter Horwath ARIZONA STATE UNIVERSITY May 2014 ABSTRACT The "Perchtenlauf," a multi-faceted procession of masked participants found in the eastern Alps, has been the subject of considerable discourse and often debate within European ethnology since the mid-19th century. While often viewed from a mythological perspective and characterized as a relic of pre-Christian cult practices, only recently have scholars begun to examine its connection with Carnival. Research of this kind calls for an in-depth analysis of the "Perchtenlauf" that is informed by Bakhtin's theory of the carnivalesque, an aesthetic of festive merriment and the release from social restrictions which is embodied by Carnival traditions. A carnivalesque reading of the "Perchtenlauf" reveals a tradition pregnant with playful ambivalence, celebrations of the lower body, and the inversion of social hierarchies. Past interpretations of the "Perchtenlauf" have often described its alleged supernatural function of driving away the harmful forces of winter, however its carnavalesque elements have definite social functions involving the enjoyment of certain liberties not sanctioned under other circumstances. The current study solidifies the relationship between the "Perchtenlauf" and Carnival using ethnographic, historical, and etymological evidence in an attempt to reframe the discourse on the tradition's form and function in terms of carnivalesque performance. i TABLE OF CONTENTS Page CHAPTER 1 PRELIMINARY REMARKS AND REVIEW OF LITERATURE .................... -

Weissbach 23.04.2016
des Weißbacher Straßenlauf 7. Georg Hohenwarter Gedächtnislauf WEISSBACH 23.04.2016 Veranstalter : USV Weißbach bei Lofer ZVR: 240399576 Weißbacher Straßenlauf 23.04.2016 7. Georg Hohenwarter Gedächtnislauf LAUF 1 - 300m Rg. Stn. KINDERLAUF WEIBLICH 11 u.j. LAUF 1 300m 8 Weißbacher Regina 11 USV Weißbach 3 Lohfeyer Katharina 11 USV Weißbach 2 Pusch Jasmin 12 WSV Königssee Rg. Stn. KINDERLAUF MÄNNLICH 11 u.j. LAUF 1 300m 6 Plattner Matthias 11 St. Martin 4 Hohenwarter Luis 12 USV Weißbach 5 Hohenwarter Alexander 11 USV Weißbach 7 Plattner Jakob 12 St. Martin LAUF 2 - 1 kleine Runde 1100m Rg. Stn. SCHÜLER WEIBLICH W7 09/10 LAUF 2 1100m 1. 93 Pirkner Magdalena 10 USV Weißbach 00:05:58,76 2. 21 Pusch Amelie 09 WSV Königssee 00:06:02,55 3. 20 Baumgartner Leonie 10 TrumerTriTeam 00:06:20,73 4. 104 Gerathwohl Paula 09 USV Weißbach 00:06:22,06 Rg. Stn. SCHÜLER MÄNNLICH M7 09/10 LAUF 2 1100m 1. 23 Frisch Clemens 09 TrumerTriTeam 00:05:30,04 2. 24 Scheikl Paul 09 TrumerTriTeam 00:05:56,72 3. 99 Fellinger Konstantin 10 USV Weißbach 00:06:00,36 4. 110 Weißbacher Sebastian 09 USV Weißbach 00:06:23,90 5. 116 Weber Lukas 09 USV Weißbach 00:07:27,82 6. 95 Eitzinger Lorenz 10 USV Weißbach 00:07:30,83 Rg. Stn. SCHÜLER WEIBLICH W9 07/08 LAUF 2 1100m 1. 27 Köppl Magdalena 07 SG Schönau/SK Ramsau 00:04:46,86 2. 25 Baumgartner Sarah 07 TrumerTriTeam 00:04:55,39 3. 67 Fussi Lisa 07 USV Weißbach 00:05:07,04 4.