Originalausgabe (PDF)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ghost Writer
Moviemento & City-Kino Februar 2010 Moviemento, OK Platz 1, 4020 Linz, 0732/78 40 90 – City-Kino, Graben 30, 4020 Linz, 0732/77 60 81 – www.moviemento.at 0732/77 Linz, 4020 30, Graben 40 90 – City-Kino, 0732/78 Linz, 4020 Platz 1, OK Moviemento, Programmzeitung für Moviemento & City-Kino für Moviemento Programmzeitung THE GHOST WRITER EIN FILM VON ROMAN POLANSKI 2010 Februar | 1 Nr. 253 – Februar 2010 – Programmzeitung für Moviemento & City-Kino für Moviemento – Programmzeitung 2010 253 – Februar Nr. Vorspann Inhalt 2010 ist kein unwesentliches Jahr für das Moviemento. Vor 20 Jahren eröffneten wir unser Neue Filme im Februar kleines Kino im Tiefparterre des OK. Nicht alle glaubten an die Existenzfähigkeit eines Pro- THE GHOS T WRI T ER ........................................... 3 grammkinos in Linz. Multiplexe kamen und Kinos sperrten zu. Bis auf das City-Kino, das wir GIULIAS VERSCHWINDEN .................................... 3 vorm Zusperren bewahren konnten und 2000 renovierten. Mit dem neuen Saal im Moviemento GÜN T ER WALLRAFF : SCHWARZ AUF WEISS ........... 10 konnten wir unsere Besucherzahlen gegenüber der Anfangszeit auf 143.000 vervierfachen. IN V IC T US ........................................................ 5 Und das, obwohl wir unser Publikum fast immer mit Originalfassungen „quälen“ oder auch NORD ............................................................ 7 beglücken. Unser Publikum zieht da vorbildlich mit. Danke sehr. PIANO MANIA ................................................... 7 Feiern werden wir unser Jubiläum im Sommer beim Sommerkino. DER RÄUBER ................................................... 6 RÜCKKEHR IN DIE NOR M ANDIE ............................ 9 Der Februar ist medial immer von der Berlinale geprägt, wir bieten Ihnen zwei Höhepunkte TE T RO ............................................................ 7 dieses Festivals: Roman Polanskis THE GHOS T WRI T ER und Jason Reitmans UP IN T HE AIR nach UP IN T HE AIR ................................................ -

April 2010 Zur 50. Ausgabe Statement FBW-Prädikate Herausgeber
April 2010 Zur 50. Ausgabe von Uwe Rosenbaum ...............................................................................................2 Aus dem Tätigkeitsbericht 2009 ...........................................................................3 Statement von Robert Cibis ("Pianomania - Auf der Suche nach dem perfekten Klang") ...................5 In Vorbereitung 2016 - DAS ENDE EINER NACHT / TAHITI ROSE / KOMM, WIR FINDEN EINEN SCHATZ / RICO, OSKAR UND DIE TIEFERSCHATTEN .................................................................6 In Produktion ATEMNOT / GO BASH! / MARIE ...................................................................................6 In Post-Production EL BULLI / MORGEN DAS LEBEN ................................................................................7 Fertiggestellte Produktionen DAVID WANTS TO FLY / HUNGER / 7 ODER WARUM ICH AUF DER WELT BIN / U.F.O. ....................................................7 Festival-Teilnahme .................................................................................................8 Nominierungen / Preise und Auszeichnungen ....................................................9 FBW-Prädikate IM HAUS MEINES VATERS SIND VIELE WOHNUNGEN (besonders wertvoll) .................. 10 U.F.O. (besonders wertvoll) ...................................................................................10 PIANOMANIA - DIE SUCHE NACH DEM PERFEKTEN KLANG (besonders wertvoll) ......11 FIVE WAYS TO DARIO (wertvoll) ........................................................................................ -
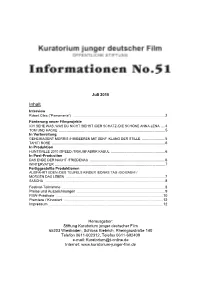
Inhalt Interview Robert Cibis ("Pianomania")
Juli 2010 Inhalt Interview Robert Cibis ("Pianomania") ........................................................................................2 Förderung neuer Filmprojekte ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST /DER SCHATZ /DIE SCHÖNE ANNA-LENA ....4 TOM UND HACKE .....................................................................................................5 In Vorbereitung GEHEIMAGENT MORRIS /HIMBEEREN MIT SENF /KLANG DER STILLE ......................5 TAHITI ROSE ............................................................................................................6 In Produktion HUNTSVILLE 2010 /SPEED /TRAUMFABRIK KABUL ....................................................6 In Post-Production DAS ENDE DER NACHT /FRIEDENAU ........................................................................6 WINTERVATER .........................................................................................................7 Fertiggestellte Produktionen AUSFAHRT EDEN /DES TEUFELS KINDER /EDNAS TAG /GO BASH! / MORGEN DAS LEBEN ...............................................................................................7 SASCHA ...................................................................................................................8 Festival-Teilnahme ..................................................................................................8 Preise und Auszeichnungen ....................................................................................9 FBW-Prädikate ......................................................................................................10 -

VOD Workshop
VOD Workshop Hotel San Sebasan 18th ‐ 19th of September 2011 Workshop Programme . Under The Milky Way – Pierre‐Alexandre Labelle .Moderaon , . Introducon, . Context, . VoD aggregaon, . European VoD Release (Business Case), SUNDAY: MONDAY: . Soda Pictures – Frances Harvey . Verce – Ania Jones .VoD market in the UK . Legal issues in VoD, . Non‐Stop Entertainment – Isabella Lindell . Society of Audiovisual Authors – Cécile . VoD markets in Scandinavia Despringes . Day and Date theatrical/VoD releases . Authors Right in Europe with regards to online exploitaon . Frenec – Nicola Weissman . Wuaki ‐ Josep Monleon . VoD market in Switzerland . Presentaiton of Wuaki, a spanish VoD operator 2 VoD Workshop . The context: . VoD as a new distribuon channel, . Changes in internaonal distribuon, . Market overview (United States and France), . Global/Local players, . The VoD aggregator: . Guiding principles, . Price points and commercial issues, . The importance of VoD posioning, promoon and markeng, . Example of iTunes exploitaon, . Business Case : . Pianomania 3 Year 2010 - Results Consumer Spend 2009(E) 2010(E) '10 v '09 Packaged ST $ 12,900 $ 11,868 -8% BD ST $ 1,100 $ 1,900 73% Packaged RN $ 6,578 $ 6,223 -5% Total Packaged $ 19,478 $ 18,091 -7% Digital ST $ 527 $ 672 28% Digital RN $ 92 $ 159 73% PPV/VOD $ 1,210 $ 1,379 14% Total On Demand $ 1,829 $ 2,210 21% Total HE $ 21,307 $ 20,302 -5% * Total packaged spend : down by 7% * Digital spend : up by 21% 6 Sources: Nielsen; Rentrak; Lionsgate MEDIA Mundus 2011 Internal Research Home Video Market YTD (July 2011) Consumer spend is down by 7% for the first half of 2011, led by an 18% decline in packaged sell-through, and a 23% growth in Digital Q1 Q2 1st H U.S. -

Pianomania - Die Suche Nach Dem Perfekten Klang (Dokumentarfilm)
Kostenlose Veranstaltungen September 2017 Internetcafé Planet13 / Klybeckstrasse 60/ 4057 Basel www.planet13.ch/ E-Mail: [email protected] Filmabend, 1. September 2017, 20.00 Uhr Eintritt frei. Pianomania - Die Suche nach dem perfekten Klang (Dokumentarfilm) Regie: Lilian Franck u.Robert Cibis Mit: Pierre-Laurent Aimard, Lang Lang, Alfred Brendel, Richard Hyung-Ki Joo, Aleksey Igudesman, Stephan Knüpfer Dauer: 96 Min. Sprache: Deutsch "Pianomania - Die Suche nach dem perfekten Klang" ist ein Film über Liebe, Perfektion und ein kleines bisschen Wahnsinn. Der aussergewöhnliche und gleichermassen humorvolle Dokumentarfilm zeigt den Zuschauer_innen die geheimnisvolle Welt der Töne und begleitet Stefan Knüpfer, Meisterstimmer und Cheftechniker von Steinway & Sons, bei seiner ungewöhnlichen Arbeit mit den grossen Stars der Musikszene wie Pierre-Laurent Aimard, Lang Lang oder Alfred Brendel. "Der Ton atmet nicht", "das Instrument braucht mehr Magie" - Sätze wie diese hört Stefan Knüpfer, der Cheftechniker und Meisterstimmer von Steinway & Sons, jeden Tag. Er arbeitet mit den besten Pianisten der Welt zusammen. Kostenlose Veranstaltungen September 2017 Internetcafé Planet13 / Klybeckstrasse 60/ 4057 Basel www.planet13.ch/ E-Mail: [email protected] Montag, 4. September 2017, 19.00 Uhr Unser Bildungsangebot in unserer: uni von unten – lernen und lehren – lehren und lernen Bildungszugang für Flüchtlingsjugendliche *Vortrag von Johannes Gruber Bund und Kantone arbeiten zurzeit an einer «Integrationsagenda Sc hweiz» und wollen mit verschiedenen Massnahmen «spät zugewanderten Jugendlichen» den Zugang zum postobligatorischen Bildungssystem erleichtern. Welche Formen von Bildungsangeboten benötigen die Jugendlichen und wie können wir das Recht auf Bildung für diese politisch durchsetzen? *Johannes Gruber, publizistische und politische Tätigkeit für die Gewerkschaft vpod in den Bereichen Bildung und Migration sowie Lehrtätigkeit als Soziologe an der Universität St. -

September 2012 News & Notes
September 2012 News & Notes Newsletter of the Boston Chapter Piano Technicians Guild CONTENTS September MEETING - Aardvark Piano Restorations. “Pianomania” 2 FEATURING: The Movie “Pianomania” “PREZ SEZ” 3 Spotlight 4 When: Tuesday, September 18th Technical Tip 5 Where: Aardvark Piano Restorations 65 Sprague Street Tidbits 6 Hyde Park, MA Secretary Report 7-8 Schedule: 6:00 PM. Gather, Converse, Eat 7:00 PM. Chapter Business Meeting 7:30 PM. Movie For Sale 9-11 Chapter Administration 12 June Meeting 12 The Movie “Pianomania” a review by Tom Location Map Huizenga Anyone with a piano at home can tell stories about Aardvark Piano Restorations piano tuners — or piano technicians, as they prefer Absolute Piano Movie to be called. In more than a dozen years of - producing classical music here at NPR, I have a few stories myself about brilliant but picky pianists and the extraordinary demands they’ve made on our piano technicians. Like the time I had to page the entire building in search of a hairdryer so the felt hammers in the piano’s guts could get a blow-dry. Now there’s a new feature-length documentary that renders any average pianist vs. piano technician nightmare utterly trivial. Pianomania, directed by Lilian Franck and Robert Cibis, takes persnickety to a new pinnacle. September 2012 News & Notes Page 2 From the web site: www.npr.org/blogs/deceptivecadence/2011 The movie follows the adventures of Stefan Knüpfe, chief piano technician for the German branch of Steinway & Sons, who over the course of the film preps pianos for Lang Lang, Alfred Brendel, Rudolf Buchbinder, Julius Drake and the high priest of fussiness, Pierre-Laurent Aimard. -

Vier Minuten Pianomania Das Piano Das Mädchen, Das Die Seiten
Die kleine Zauberflöte kleine Die Seiten umblättert Seiten Das Mädchen, das die die das Mädchen, Das Das Piano Das am 4.6./11.6./18.6./25.6.2012 am Pianomania Mozart Special Vier Minuten Vier Mozart für Kids Mo, 18.6.und Mo, 25.6. um 16:00 Augsburger Puppenkiste: Eine kleine Zauberflöte R: Horst Thürling und Hanns-Joachim Marschall, D 1989, 57 Min. FSK: o. Al., empfohlen ab 5 J. Die „kleine Zauberflöte“ der Augsburger Puppenkiste entstand nicht mit Opern- sängern, sondern mit singenden Schauspielern, weshalb man sich für Sprechgesang entschied. Die musikalische Untermalung ist mit Flöten, Oboen, Glockenspiel, drei Klarinetten und einer Bassklarinette arrangiert. In der Inszenierung der Augsburger Puppenkiste wird die „Zauberflöte“ auch für die ganz Kleinen zum Vergnügen. Kartenpreis: € 6,-, ermäßigt € 5,-, Kinder € 3,50 Mo,4.6., 20:30 Vier Minuten R: Chris Kraus, D: Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung, D 2009, 111 Min., FSK ab 12 J. Ein Film von Chris Kraus mit Monica Bleibtreu und Hannah Herzsprung über zwei un- gleiche Frauen und die ungeheure Kraft der Musik, die nicht versöhnt, aber den Kern der Freiheit in sich trägt. Die Komponistin Annette Focks schafft im Soundtrack die Balance zwischen Schumann, Mozart, Beethoven und ihrer eigenen Musik, die am reichsten aus- drückt, um was es in „Vier Minuten“ geht, nämlich den tiefen Wunsch nach Individualität und Freiheit des Ausdrucks. (nach:www.vierminuten.de) Mo, 11.6., 20:30 Pianomania Dokumentarfilm mit: Lang Lang, Alfred Brendel, Rudolf Buchbinder, Pierre-Laurent Aimard, Stefan Knüpfer R: Lilian Franck und Robert Cibis, D/AT 2009, 93 Min., FSK o.Al. -

CANBERRA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Wednesday 27 October – Sunday 7 November 2010
TransACT proudly presents the … 14th CANBERRA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL Wednesday 27 October – Sunday 7 November 2010 SEE INSIDE Dendy Cinemas Canberra Level 2 North Quarter Canberra Centre Arc Cinema National Film and Sound Archive McCoy Circuit Acton www.canberrafilmfestival.com.au 1 Canberra International Film Festival (CIFF) ACT Chief Minister Chief Executive and Minister for the Arts Officer TransACT Jon Stanhope MLA Ivan Slavich The Canberra International Film Festival is an annual opportunity I’m proud that for the third year running TransACT is the major for Canberrans to enjoy some of the best new films from around sponsor of the Canberra International Film Festival. The festival is the world. a highlight of Canberra’s cultural events calendar and this year’s But it is also an important forum for international and national program is jam-packed with a variety of screenings. filmmakers, emerging filmmakers and others in the industry to As your local provider of phone, mobile, broadband, and pay TV discuss the art and business of film, and to form new creative and services, we’re proud to be a big supporter of local events. From film business partnerships. festivals, to sporting teams and charities, TransACT is committed to For artists, film offers a story-telling medium that draws together the Canberra community. literary, visual and performing arts. For audiences, film is a window This festival is one of our favourites with a 12-day celebration into the lived and imagined worlds of others. It can make us of film, showcasing an exceptional selection of feature films and question our assumptions about our world and can stir the spirit of documentaries from around the world plus the best Australian new inquiry in us, long after we have left the cinema. -

At Cannes 2010
German Films at Cannes 2010 Contents In Competition 6 Un Certain Regard 7 Cannes Classics 9 Directors’ Fortnight 10 Market Screenings: New German Films 14 Next Generation 2010 42 European Film Promotion’s “Producers on the Move” 51 Members of the Association of German Film Exporters (VDFE) at the Cannes Film Festival 52 Foreign Representatives & Imprint 62 In Competition MY JOY by Sergei Loznitsa German Producer: ma.ja.de fiction/Leipzig World Sales: Fortissimo Film Sales/Amsterdam In Competition LA PRINCESSE DE MONTPENSIER by Bertrand Tavernier German Producer: Pandora Film/Cologne World Sales: StudioCanal/Paris In Competition TENDER SON – THE FRANKENSTEIN PROJECT by Kornél Mundruczó German Producer: Essential Filmproduktion/Berlin World Sales: Coproduction Office/Paris In Competition TOURNÉE by Mathieu Amalric German Producer: Neue Mediopolis Filmproduktion/Leipzig World Sales: Le Pacte/Paris In Competition UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES by Apichatpong Weerasethakul German Producers: Geissendoerfer Film- und Fernsehproduktion & The Match Factory/Cologne World Sales: The Match Factory/Cologne Out of Competition THE AUTOBIOGRAPHY OF NICOLAE CEAUSESCU by Andrei Ujicaˇ German Producer: Neue Mira Filmproduktion/Bremen World Sales: Mandragora International/Paris Out of Competition CARLOS THE JACKAL by Olivier Assayas German Producer: Egoli Tossell Film/Halle World Sales: StudioCanal/Paris Un Certain Regard AURORA by Cristi Puiu German Producer: Essential Filmproduktion/Berlin World Sales: Coproduction Office/Paris GERMAN FILMS -

Press Me, and Should Also Be Conveyed by the Film
A film by Lilian Franck & Robert Cibis Length: 93 min., Format: 35 mm FIRST RUN FEATURES The Film Center Building, 630 Ninth Ave. #1213 New York, NY 10036 (212) 243-0600 Fax (212) 989-7649 Website: www.firstrunfeatures.com Email: [email protected] www.pianomania.de PRAISE FOR PIANOMANIA " Surprisingly compelling! Too intriguing and entertaining to be left to the specialists... A captivating film not just for pianomaniacs." – Trevor Johnston, Time Out London " Enthralling!" – The Financial Times (London) " An excellent film. In keeping with its subject matter, this high-minded documentary has elegance and exactitude...Knüpfer is a thoroughly engaging personality." – Peter Bradshaw, The Guardian UK "A delightfully esoteric documentary." – The Telegraph (UK) NOMINATIONS, AWARDS AND PRIZES Locarno Film Festival in Switzerland : Semaine de la Citique in its section International Filmweekend Würzburg: Audience Award for Best Documentary , January 2010 Cinema Festival in Lünen, Germany: The Lüdia (first prize) , November 2009 Diagonale Graz, Austria : Best Editing European Film Academy : 22nd European Film Prize . The Film Evaluation Committee in Wiesbaden : Highly Recommended rating . EURODOK Film Festival : Honourable Mention 2 SYNOPSIS A smash in Europe and winner of the Golden Gate Award for Best Feature Documentary at the San Francisco International Film Festival, Pianomania comes at last to theaters in the United States. Directed by Lilian Franck and Robert Cibis, Pianomania takes you into the secret world of sounds – a place where passion and the pursuit of perfection collide with artistic obsession and a little bit of madness. As Steinway & Sons’ chief technician and Master Tuner in Vienna, Stefan Knüpfe is dedicated to the unusual task of pairing world-class instruments with world-famous pianists.