Philipp Melanchthons.Indd
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
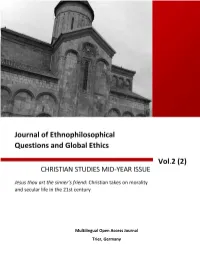
Christian Studies Mid-Year Issue (2018)
Multilingual Open Access Journal Trier, Germany Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics | Christian Studies Mid-Year Issue (2018) Imprint Open access peer review journal Trier, Germany Chief Editor: Timo Schmitz February 2018 Co-editor: Iulian Mitran Reviewers: Timo Schmitz, Iulian Mitran, Nikolay Kuznetsov, Mariam Mangoshvili Contact: Timo Schmitz c/o Papyrus Autoren-Club, R.O.M. Logicware GmbH Pettenkoferstr. 16-18 10247 Berlin GERMANY E-Mail: [email protected] Publisher/ Issuer: Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics Timo Schmitz Trier, Germany Website: www.ethnophilosophical-journal.de ISSN: 2568-6828 This magazine is published under CC-BY-ND 3.0 license. https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/deed.en 2 | P a g e Journal of Ethnophilosophical Questions and Global Ethics | Christian Studies Mid-Year Issue (2018) Contents Foreword .................................................................................................................................................. 4 TIMO SCHMITZ:Was Jesus born to an unmarried couple?...................................................................... 7 NIKOLAY KUZNETSOV:Pre-Reformed Russian Orthography in Clerical and Secular Spheres as a Symbol of the Russian National Identity Outside Russia. Part 1: Theoretical Justification .................................... 11 IULIAN MITRAN:The «New Dacians» and Crypto-Orthodoxy at the Dawn of Rational Historicism (I) . 27 ALEXANDRU DRAGULIN:BOOK REVIEW: Darius Baronas, S.C. Rowell, -

Changing Images of the Virgin Mary in Lutheran Sermons of the Sixteenth Century Beth Kreitzer
Reforming Mary OXFORD STUDIES IN HISTORICAL THEOLOGY Series Editor David C. Steinmetz, Duke University Editorial Board Gerhard Sauter, Rheinische Friedrich- Irena Backus, Universite´ de Gene`ve Wilhelms-Universita¨t Bonn Robert C. Gregg, Stanford Susan E. Schreiner, University of University Chicago George M. Marsden, University of John Van Engen, University of Notre Notre Dame Dame Wayne A. Meeks, Yale University Geoffrey Wainwright, Duke University Robert L. Wilken, University of Virginia THE GOSPEL OF JOHN IN THE THE CONFESSIONALIZATION OF SIXTEENTH CENTURY HUMANISM IN REFORMATION The Johannine Exegesis of Wolfgang Musculus GERMANY Craig S. Farmer Erika Rummell PRIMITIVISM, RADICALISM, AND THE THE PLEASURE OF DISCERNMENT LAMB’S WAR Marguerite de Navarre as Theologian The Baptist-Quaker Conflict in Seventeenth- Carol Thysell Century England REFORMATION READINGS OF THE T. L. Underwood APOCALYPSE HUMAN FREEDOM, CHRISTIAN Geneva, Zurich, and Wittenberg RIGHTEOUSNESS Irena Backus Philip Melanchthon’s Exegetical Dispute with WRITING THE WRONGS Erasmus of Rotterdam Women of the Old Testament among Biblical Timothy J. Wengert Commentators from Philo through the Reformation CASSIAN THE MONK John L. Thomspon Columba Stewart THE HUNGRY ARE DYING IMAGES AND RELICS Beggars and Bishops in Roman Cappadocia Theological Perceptions and Visual Images in Susan R. Holman Sixteenth-Century Europe John Dillenberger RESCUE FOR THE DEAD The Posthumous Salvation of Non-Christians in THE BODY BROKEN Early Christianity The Calvinist Doctrine of the Eucharist and the Jeffrey A. Trumbower Symbolization of Power in Sixteenth-Century AFTER CALVIN France Studies in the Development of a Theological Christopher Elwood Tradition WHAT PURE EYES COULD SEE Richard A. Muller Calvin’s Doctrine of Faith in Its Exegetical THE POVERTY OF RICHES Context St. -
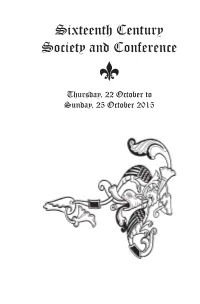
2015 Program
Sixteenth Century Society and Conference S Thursday, 22 October to Sunday, 25 October 2015 Sixteenth Century Society & Conference 22–25 October 2015 2014-2015 OFFICERS President: Marc Forster Vice-President: Anne Cruz Past-President: Elizabeth Lehfeldt Executive Director: Donald J. Harreld Financial Officer: Eric Nelson ACLS Representative: Kathryn Edwards Endowmento Chairs: Raymond Mentzer COUNCIL Class of 2015: Cynthia Stollhans, Amy Leonard, Susan Felch, Matt Goldish Class of 2016: Alison Smith, Emily Michelson, Andrea Pearson, JoAnn DellaNeva Class of 2017: Rebecca Totaro,o Andrew Spicer, Gary Ferguson, Barbara Fuchs PROGRAM COMMITTEE Chair: Anne Cruz History: Scott K. Taylor English Literature: Scott Lucas German Studies: Bethany Wiggin Italian Studies: Suzanne Magnanini Theology: Rady Roldan-Figueroa French Literature: Robert Hudson Spanish and Latin American Studies: Elvira Vilches Arto History: James Clifton NOMINATING COMMITTEE Gerhild Williams (Chair), Sara Beam,o Phil Soergel, Konrad Eisenbichler, Christopher P. Baker 2014–2015 SCSC PRIZE COMMITTEES Gerald Strauss Book Prize Kenneth G. Appold, Amy Leonard, Marjorie E. Plummer Bainton Art History Book Prize Cristelle Baskins, Diane Wolfthal, Lynette Bosch Bainton History/Theology Book Prize Jill Fehleisen, Dean Bell, Craig Koslofsky Bainton Literature Book Prize Edward Friedman, WIlliam E. Engel, James H. Dahlinger Bainton Reference Book Prize Carla Zecher, Diana Robin, Phil Soergel Grimm Prize Jesse Spohnholz, Carina Johnson, Duane Corpis Roelker Prize Judy K. Kem, Allan Tulchin, -

Music and Confession in Heidelberg, 1556– 1618
Music and Confession in Heidelberg, 1556– 1618 Matthew Alan Laube Royal Holloway, University of London Submitted for the Degree of Doctor of Philosophy Acknowledgements I wish to thank my supervisor, Stephen Rose, for his constant encouragement and critical eye over the course of many drafts. In the UK, Christian Leitmeir, Howard Hotson, Helen Deeming, Iain Fenlon, Katharine Ellis, Paul Harper-Scott and Robin Leaver all provided helpful information and feedback on my work. Joachim Kremer, Peter Wollny and Eike Wolgast provided valuable support and assistance with archives and sources during my time in Germany. I wish also to thank the staff of libraries and archives in the UK and Europe: the British Library, Cambridge University Library, the Bodleian Library, the Library of St John’s College, Oxford, National Library of Scotland, Glasgow University Library, Aberdeen University Library, the Universitätsbibliothek and Universitätsarchiv Heidelberg, Generallandesarchiv Karlsruhe, Geheimes Hausarchiv and Bayerisches Staatsarchiv München, Staatsbibliothek Berlin, Theologisches Seminar Herborn, Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, Universitätsbibliothek Leipzig, Bach-Archiv Leipzig, Uppsala University Library and Bibliotheca Apostolica Vaticana. For their help with tricky German and Latin translation, thanks go to Annika Forkert, Peter Sjökvist and Mattias Lundberg. Fellow post-graduate students Ester Lebedinski, Clare Brady and Harriette Peel proofread and provided feedback through the entire process. Lastly, my greatest measure of gratitude goes to my wife, Elizabeth, who has been proud since day one. Declaration of Authorship I, Matthew Laube, hereby declare that this thesis and the work presented in it is entirely my own. Where I have consulted the work of others, this is always clearly stated. -

Inhaltsverzeichnis Des Zweiten Teilbandes
INHALTSVERZEICHNIS DES ZWEITEN TEILBANDES HUMANISMUS UND RENAISSANCE I. Blütezeit des Renaissance-Humanismus i. Manifestation neuer Bildungsziele KONRAD CELTIS aus .Oratio in gymnasio in Ingelstadio publice recitata' (mit Übersetzung: Öffentliche Rede an der Universität Ingolstadt) 3 JOACHIM VADIANUS aus ,De Poetica et Carminis ratione' (mit Übersetzung: Über Poetik und die Wissenschaft der Dichtung) Vadians Dichterkrönung 12 KAISER MAXIMILIAN I. Poetendiplom für Joachim Vadianus (mit Über setzung) 13 2. Die großen Einzelpersönlichkeiten KONRAD CELTIS aus .Norimberga' (von 1495) Capitulum primum: praefatio ad senatum 17 GEORG ALT aus Übersetzung der .Norimberga' des KONRAD CELTIS Das erst capitl ist ein vorrede gein den rats elltern 19 KONRAD CELTIS aus .Quatuor libri amorum, secundum quatuor latera Ger manie' (mit Übersetzung: Vier Bücher Liebesgedichte, nach den vier Ge staden Deutschlands) (II, 2) Adse ipsum, quod amore relegato adphilosophiam se conferre velit (An sich selbst, da er sich der Liebe entziehen und der Philosophie zuwenden wollte) Postquam Sarmaticis remeassem ab oris 22 (II, 13) AdDanubium, ut puellam descendentem in Pannonias numtne suo tueatur (An den Donaustrom, auf daß er sein Mädchen, das nach Pan- nonien hinabreist, durch sein gnädiges Walten beschütze) Hister in Euxinum properans septemfide Pontum 25 aus ,Libri Odarum quatuor' (mit Übersetzung: Vier Bücher Oden) (III, 5) Adloannem Vigilium sodalitatis litterariae Rhenanae hospitem in situm Hedelbergae et quare decennioperegrinatusfuerit (An Johannes Vigilius, -

Early Music Printing in German-Speaking Lands Edited by Andrea Lindmayr-Brandl, Elisabeth Giselbrecht and Grantley Mcdonald
Early Music Printing in German-Speaking Lands Edited by Andrea Lindmayr-Brandl, Elisabeth Giselbrecht and Grantley McDonald First published 2018 ISBN: 978-1-138-24105-3 (hbk) ISBN: 978-1-315-28145-2 (ebk) Chapter 9 The cult of Luther in music Grantley McDonald (CC BY-NC-ND 4.0) 9 The cult of Luther in music1 Grantley McDonald Several studies have confirmed the truism that the Reformation could not have taken place if not for the easy availability of print. The triangular relationship between print, the Reformation, and music is less obvious. The sudden demands of the Reformation on the presses of Germany and on the attention and resources of German readers and book buyers temporarily suppressed the production of certain kinds of printed musical sources. For example, while seventeen editions of the missal, most containing music, were printed for the diocese of Passau between 1491 and 1522, none were produced after this period.2 The presence of similar patterns in other German dioceses suggests that this was not due simply to coincidence or a saturation of requirements. Rather, the kinds of music being printed changed in response to the onset of the Reformation. Beginning in 1524, there was an explosion of editions providing music for the Lutheran rite: liturgical books for the use of the clergy, monophonic hymn books for the use of the congregation, and books of polyphony for the choir. Moreover, Lutheran and Roman Catholic controversialists alike used music to spread propaganda, as Rolf Wilhelm Brednich, Rebecca Wagner Oettinger and others have shown.3 Printed material tends to be of two kinds: ephemeral (or occasional), and archival, that is, material intended to be consulted more than once. -

Spätmittelalter Humanismus Reformation Texte Und Zeugnisse
SPÄTMITTELALTER HUMANISMUS REFORMATION TEXTE UND ZEUGNISSE HERAUSGEGEBEN VON HEDWIG HEGER ERSTER TEILBAND SPÄTMITTELALTER UND FROHHUMANISMUS ms C. H. BECK'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG MÜNCHEN 1975 T INHALTSVERZEICHNIS DES ERSTEN TEILBANDES S PÄTMITTE LALTE R A. RELIGIÖSE DICHTUNG I. Ausklang mittelalterlicher Frömmigkeit i. Geistliche Epik in Vers und Prosa a) Ausklingende geistliche Versepik ANDREAS KURZMANN ,Soliloquium Marie cum Jhesu' 3 b) Von der Verslegende zur Prosalegende JOHANNES ROTHE aus ,Das Leben der hl. Elisabeth' Kirchenbesuch zu Eisenach 9 UNBEKANNTER VERFASSER Maria und die Klosterküsterin 11 c) Predigtexempel und Mirakelerzählung JOHANNES PAULI aus Predigten Der brüder und der bös vigint 12 MARTIN VON AMBERG aus ,Der Gewissensspiegel' Exempel von Ruffus, dem Spieler 16 UNBEKANNTER VERFASSER Exempel vom Jesuskind 18 d) Lebens- und Tugendlehre MARTIN VON AMBERG aus ,Der Gewissensspiegel' Gebete und Gebote. Wider den Aberglauben 19 HENDRIK HERP aus ,Spieghel der volcomenheit' Van den scouwen 21 HEINRICH HASZ aus Übersetzung des ,Spiegels der Vollkommenheit' des HEINRICH HERP Von dem beschaiven 22 Wie das verstentlich lieht wirt zugleich der clarheit sunnen vnd der morgen rot . 2 3 XXVIII Inhaltsverzeichnis. Erster Teilband e) Geistliche Allegorie PETER DE MERODE aus ,Die Pilgerfahrt des träumenden Mönchs' Vorspruch 24 Der Traum. Das himmlische Jerusalem 24 f) Jenseitsvision UNBEKANNTER VERFASSER ,Visio Lazari' (Die Vision des Lazarus) .... 32 2. Geistliche Lyrik a) Geistliches Lied. Kirchenlied DER MÖNCH VON SALZBURG Das guidein Abc mit vil subtiliteten Ave, ballsams creatur 52 HUGO VON MONTFORT Geistliches Tagelied Ich fragt ein wachter, ob es wer tag 57 MUSKATBLÜT Marien erwälung Ein junger man mit synnen 58 HEINRICH LAUFENBERG Ave maris Stella Bis grust, stern im mere 60 Ich wolt da% ich daheime waer 61 UNBEKANNTER VERFASSER In dulcijubilo 61 b) Kontrafakturen UNBEKANNTER VERFASSER Den liepsten bulen den ich hän, contrafactum Den liepsten herren den ich han 62 HEINRICH LAUFENBERG Es stot ein lind in himelrich 63 3. -

A Collection of Georg Rhau's Music Editions and Some Previously
A Collection of Georg Rhau’s Music Editions and Some Previously Unnoticed Works Richard Charteris Predictably the largest collections of mid-sixteenth-century music editions produced in Germany are found on the Continent, the main ones are located in the Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, the Biblioteka Jagiellonska Kraków, the Bayerische Staatsbibliothek München, the Österreichische Nationalbibliothek Wien and the Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg (those in the first two were once together in Berlin but became separated as a result of World War II). Apart from these libraries, the finest collection of such materials is to be found in the United Kingdom and encompasses sacred and secular compositions as well as instrumental works. Preserved in the British Library in London, the collection reflects the commitment of successive librarians to amassing early Continental materials, a policy at its most productive between the early to mid-nineteenth century and early twentieth century. In regard to the British Library’s mid-sixteenth-century music editions published in Germany, the majority originated from cities then long established as major centres of book publishing. The leading ones include: (1) Nuremberg, where its principal music publishers during this time were Johann Petreius (1497–1550), Hieronymus Formschneider (d. 1556), Johann vom Berg (b. c.1500–1515; d. 1563), Ulrich Neuber (d. 1571) and Katharina Gerlach (b. c.1515–1520; d. 1592); (2) Augsburg, where notable contributors were Philipp Ulhart the Elder (d. 1567 or 1568) and Melchior Kriesstein (b. c.1500; d. 1572 or 1573); and (3) Munich, where someone from a subsequent generation, Adam Berg the Elder (d. -

These Adiaphoristic Devils: Matthias Flacius Illyricus in Statu Confessionis, 1548-1552
THESE ADIAPHORISTIC DEVILS: MATTHIAS FLACIUS ILLYRICUS IN STATU CONFESSIONIS, 1548-1552 Wade R. Johnston Professor Robert von Friedeburg CH 5050 Erasmus University, Rotterdam 14 June 2013 Johnston 1 Table of Contents Introduction ………………………………………………………………………... 3 I. Flacius’ Propaganda War ………………………………………………...6 II. English Historiography ………………………………………………… 7 III. German Historiography ……………………………………………….. 12 IV. Lacunae and Methodology ……………………………………..............15 V. Organization ……………………………………………………………. 18 VI. Arguments ……………………………………………………………...19 Luther, the Two Kingdoms, and His Warning ……………………………............. 20 I. Luther’s Theology of Two Kingdoms …………………………............... 20 II. Luther’s Warning ………………………………………………………. 25 The Schmalkaldic League, the Outbreak of the Controversy, and Flacius’ Life until Then ………………………………………………............. 31 I. Luther and the Jurists …………………………………………………… 31 II. The Diet of Speyer ……………………………………………………... 32 III. Augsburg, Torgau, and the Open Door …………………...…………... 33 IV. The Defeat of the Schmalkaldic League and the Adiaphoristic Controversy ……………………………............. 38 V. Adiaphora Defined ……………………………………………………... 41 VI. A Brief Biography of Matthias Flacius Illyricus to the time of the Adiaphoristic Controversy …………………………. 43 VII. Flacius’ Luther-an Identity …………………………………...………. 47 Flacius’ General Argumentation in the Adiaphoristic Controversy ……...……….. 51 I. The Nature of Illyricus’ Writings ……………………………………….. 51 II. The Purpuse of His Writings …………………………………………… 52 III. Flacius’ Chief Arguments -

Zur Appellativischen Verwendung Von Eigennamen in Luthers Deutschen Schriften Vincent Balnat
Zur appellativischen Verwendung von Eigennamen in Luthers deutschen Schriften Vincent Balnat To cite this version: Vincent Balnat. Zur appellativischen Verwendung von Eigennamen in Luthers deutschen Schriften. Muttersprache, 2019. hal-02490166 HAL Id: hal-02490166 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02490166 Submitted on 24 Feb 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Zur appellativischen Verwendung von Eigennamen in Luthers deutschen Schriften Vincent Balnat (Université de Strasbourg, EA 1339) Wie die Durchsicht der sprachwissenschaftlich relevanten Titel, die in der Germanistische[n] Luther-Bibliographie für den Zeitraum von 1880 bis 1980 verzeichnet sind (Wolf 1985), der seitdem erschienenen Luther-Jahrbücher sowie der großen neueren Sprachgeschichten des Deutschen1 zeigt, haben sich in der sprachwissenschaftlichen Forschung zu Luthers Schriften drei Schwerpunkte herausgebildet: i. Luthers Wortbildungskraft, für die als Beispiele immer wieder die von ihm geprägten Komposita Feuereifer und wetterwendisch angeführt werden,2 ii. sein Beitrag zu einem überregionalen Wortschatzausgleich, etwa durch die Verwendung ostmitteldeutscher Ausdrücke wie Hügel und Lippe anstelle von oberdeutsch Bühel und Lefze,3 iii. die von ihm vorgenommene semantische Neubesetzung von Begriffen wie Arbeit, fromm, Glaube, Gnade im Sinne der protestantischen Theologie.4 Zur Onomastik gibt es dagegen nur wenige Untersuchungen, was insofern erstaunlich ist, als Luther selbst großes Interesse an Eigennamen (nachfolgend: EN) zeigte: seinen eigenen Namen änderte er zweimal (vgl. -

Erasmus Alberus, Dichter
Erasmus Alberus, Dichter Zur Person: Name Erasmus Alberus eigentl. Alber Lebensdaten * 1500 in Bruchenbrücken (heute Stadtteil v. Friedberg) + 05. Mai 1553 in Neubrandenburg Quelle: florstadt mobil Wohnaufenthalt-Lebensbereich: Bruchenbrücken, Nidda, Weilburg, Mainz, Wittenberg, Büdingen, Oberursel, Marburg, Basel, Sprendlingen, Rothenburg, Neustadt, Babenhausen, Marburg, Hamburg, Lübeck, Neubrandenburg Beruf: Dichter u. Pädagoge Ausbildung: Lateinschulen in Nidda und Weilburg humanistisches Studium in Mainz 1520 Immatrikulation an der Universität Wittenberg zum Theologie-Studium (seine Lehrer u. a. Martin Luther u. Andreas Bodenstein) 1522 Gründung einer Lateinschule in Büdingen 1524 Gründung einer Lateinschule in Oberursel und ihr 1. Rektor 1528-1536 Pfarrer in Sprendlingen Hier führte er die Reformation wie im Herzogtum Küstrin ein. Ab 1539 führte Alberus eine Art Wanderleben Aufenthalt in Marburg und Basel Pfarrposten in Rothenburg ob der Tauber und in der Wetterau Erasmus Alberus, Dichter Ausbildung: Ende 1541-1542 Pfarrer und Superintendent in der St. Katharinenkirche in der Neustadt Brandenburg (heute Brandenburg an der Havel). 1543 Promovierung zum Doktor d. Theologie in Wittenberg Nach Auslauf seines Anstellungsvertrages in Staden (heute Ortsteil von Florstadt) 1544 Anstellung bei Graf Philipp IV. von Hanau-Lichtenberg in Babenhausen um im Amt Babenhausen der Grafschaft Hanau- Lichtenberg die Reformation durchzuführen. Ab 1548 Magdeburg - auf Seiten der Gnesiolutheraner, Wortführer gegen das Augsburger Interim und die Leipziger -

9 the Cult of Luther in Music1
9 The cult of Luther in music1 Grantley McDonald Several studies have confirmed the truism that the Reformation could not have taken place if not for the easy availability of print. The triangular relationship between print, the Reformation, and music is less obvious. The sudden demands of the Reformation on the presses of Germany and on the attention and resources of German readers and book buyers temporarily suppressed the production of certain kinds of printed musical sources. For example, while seventeen editions of the missal, most containing music, were printed for the diocese of Passau between 1491 and 1522, none were produced after this period.2 The presence of similar patterns in other German dioceses suggests that this was not due simply to coincidence or a saturation of requirements. Rather, the kinds of music being printed changed in response to the onset of the Reformation. Beginning in 1524, there was an explosion of editions providing music for the Lutheran rite: liturgical books for the use of the clergy, monophonic hymn books for the use of the congregation, and books of polyphony for the choir. Moreover, Lutheran and Roman Catholic controversialists alike used music to spread propaganda, as Rolf Wilhelm Brednich, Rebecca Wagner Oettinger and others have shown.3 Printed material tends to be of two kinds: ephemeral (or occasional), and archival, that is, material intended to be consulted more than once. Print increased the availability and quantity of both kinds of source, ephemera particularly strongly.4 Since propaganda is usually topical and timely, it is naturally somewhat ephemeral. However, collectors who preserved ephemeral material for later consultation helped it cross over into the realm of the archival.