Gm Cantacuzino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Cod Articol Titlu Pret Euro ADG9738892316 GRAFICA FARA
Cod articol Titlu pret euro ADG9738892316 GRAFICA FARA COMPUTER# 9789738892316 15,50 ADL9737887290 MARAMURES TARA LEMNULUI (FRA)# 5948374000521 13,00 ADLBUCURESTIF-GFLORIN ANDREESCU / BUCURESTI (FR-GERM)# 2000000183 7,00 ALL9735712016 BREZIANU BARBU / BRANCUSI IN ROMÂNIA (LB. FRANCEZA) 17,00 ALL9736842061 ARISTITA NEGREANU / DICTIONAR DE EXPRESII ROMAN FR 6,50 ALL9736845524 DICTIONAR DE PROVERBE ROMANESTI# 9789736845529 5,00 ALL9737240340 BARBU BREZIANU / BRANCUSI IN ROMANIA (LB. ENGLEZA) 17,00 ALL9737241016 ATLAS RUTIER-ROMANIA# 9789737241016 13,00 ALL9737241221 DICTIONAR EUROPEAN DE CONVERSATIE# 9789737241221 9,00 ALL9737243065 BUJOR NEDELCOVICI / CINE SUNTETI, BUJOR NEDELCOVICI?# 9789737243065 13,00 ANG9738675780 ROMANIA. DATE SI FAPTE (1989-2009)# 5948491190013 11,50 ARA973679458X GHID DE CONVERSATIE SI CIVILIZATIE ROMAN FRANCEZ E 8,00 ATS9730093445 LEMN. BISERICI DIN NORDUL OLTENIEI# 9789730093445 15,50 CAD6069216248 CRISTINA TURLEA / BANCA NATIONALA A ROMANIEI CRONICA RESTAURARII PALATULUI VECHI# 9786069216248 33,00 CAR978997579544DAN PERIOVSHI / URMUZ PAGINI BIZARE# 2000000234069 7,50 CAR9975792028 VASILE ERNU/ ILUZIA ANTICOMUNISMULUI# 978997579202 7,50 CAR9975796118 PLANETA MOLDOVA - NEKROTITANIUM# 9789975796118 7,50 CAR9975796255 MARIA-PAULA ERIZANU / ACEASTA E PRIMA MEA REVOLUTIE. FURATI-MI-O# 9789975796255 8,50 CAR9975796354 ALEXANDRU VAKULOVSKI / 157 DE TREPTE SPRE IAD SAU SALVATI-MA LA ROSIA MONTANA 5,50 CBC9736145766 ALBUM DE COLECTIE MARINA MILITARA ROMANA 1860-1960# 2000000267456 34,00 COJ9731283463 PETRE ISPIRESCU / BASME# -

New Europe College Yearbook 2015-2016
New Europe College ûWHIDQ2GREOHMD Program Yearbook 2015-2016 Program Yearbook 2015-2016 Program Yearbook ûWHIDQ2GREOHMD 1>4B55151>E 75?B791>18E91> F1C9<5=9819?<1BE NEW EUROPE COLLEGE NEW EUROPE CRISTIANA PAPAHAGI VANEZIA PÂRLEA 9E<9EB1 9E 1>4B51CCD1=1D5D561> ISSN 1584-0298 D85?4?B5E<95B9EB?CD£C CRIS New Europe College Ştefan Odobleja Program Yearbook 2015-2016 This volume was published within the Human Resources Program – PN II, implemented with the support of the Ministry of National Education – The Executive Agency for Higher Education and Research Funding (MEN – UEFISCDI), project code PN–II– RU–BSO-2015 EDITORIAL BOARD Dr. Dr. h.c. mult. Andrei PLEŞU, President of the New Europe Foundation, Professor of Philosophy of Religion, Bucharest; former Minister of Culture and former Minister of Foreign Affairs of Romania Dr. Valentina SANDU-DEDIU, Rector, Professor of Musicology, National University of Music, Bucharest Dr. Anca OROVEANU, Academic Coordinator, Professor of Art History, National University of Arts, Bucharest Dr. Irina VAINOVSKI-MIHAI, Publications Coordinator, Professor of Arab Studies, “Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest Copyright – New Europe College 2017 ISSN 1584-0298 New Europe College Str. Plantelor 21 023971 Bucharest Romania www.nec.ro; e-mail: [email protected] Tel. (+4) 021.307.99.10, Fax (+4) 021. 327.07.74 New Europe College Ştefan Odobleja Program Yearbook 2015-2016 ANDREEA EŞANU GEORGIANA HUIAN VASILE MIHAI OLARU CRISTIANA PAPAHAGI VANEZIA PÂRLEA IULIU RAŢIU ANDREAS STAMATE-ŞTEFAN THEODOR E. ULIERIU-ROSTÁS -

Analele Universităţii Din Craiova, Seria Istorie, Anul XIX, Nr. 2(26)/2014
Analele Universităţii din Craiova, Seria Istorie, Anul XIX, Nr. 2(26)/2014 CONTENTS STUDIES AND ARTICLES Anișoara Băbălău, THE FISCAL ORGANISATION OF WALLACHIA IN BRANCOVAN ERA .................................................................................................................................. 5 Elena Steluţa Dinu, HEALTH LAWS IN THE PERIOD 1874-1910 .............................. 15 Adi Schwarz, THE STRUGGLE OF THE JEWS FOR THEIR POLITICAL RIGHTS IN THE VIEW OF WESTERN JOURNALISTS (1876-1914) ............................................. 23 Cosmin-Ştefan Dogaru, LE PORTRAIT DE CHARLES DE HOHENZOLLERN- SIGMARINGEN. UN REPERE DANS L’HISTOIRE DE L’ETAT ROUMAIN ............. 31 Stoica Lascu, THE SITUATION OF THE BALKAN ROMANIANS REFLECTED IN “REVISTA MACEDONIEI” MAGAZINE (BUCHAREST; 1905-1906) ...................... 43 Gheorghe Onişoru, MAY 15, 1943: DISSOLUTION OF THE KOMINTERN AND ITS EFFECTS ON THE COMMUNIST PARTY OF ROMANIA .......................................... 75 Cezar Stanciu, CHALLENGES TO PROLETARIAN INTERNATIONALISM: THE COMMUNIST PARTIES’ CONFERENCE IN MOSCOW, 1969 .................................. 85 Lucian Dindirică, ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL ORGANIZATION OF ROMANIA UNDER THE LEADERSHIP OF NICOLAE CEAUŞESCU ........................................... 101 Virginie Wanyaka Bonguen Oyongmen, ARMÉE CAMEROUNAISE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA NATION: LE CAS DU GÉNIE MILITAIRE (1962-2012) ................................................................................ 109 Nicolae Melinescu, THE MARITIME -

Aalto and History
Keynote - Alvar Aalto Researchers’ Network March 12th – 14th 2012, Seinäjoki and Jyväskylä, Finland Aalto and history Aino Niskanen Professor Aalto University, School of Arts, Design and Architecture Department of Architecture Finland [email protected] Publisher Alvar Aalto Museum ISSN-L 2323-6906 ISSN 2323-6906 www.alvaraalto.fi www.alvaraaltoresearch.fi Keynote - Alvar Aalto Researchers’ Network March 12th – 14th 2012, Seinäjoki and Jyväskylä, Finland www.alvaraaltoresearch.fi In the present seminar the history of Alvar Aalto’s work is being dealt with on many different levels. As an introduction, I should like to discuss Aalto’s relationship with history. Many of the presentations over the course of the seminar will no doubt take these issues further. What do we know about Aalto’s formative years as an architect? During the period he was studying at the Helsinki Institute of Technology, 1916-1921, the teaching there had a strong emphasis on history: examples from the antiquities beckoned as a foundation for everything new. (Fig 1) Fig 1. Alvar Aalto in 1916. Photo: Schildt, Göran: The Early Years, p. 75. Nevertheless, those teachers considered important by Aalto were, according to Göran Schildt, above all important as pedagogues of attitudes: Usko Nyström, who taught the history of architecture of the antiquities and Middle Ages, emphasised the values of modesty, humanity, vitality, comfort and practicality. Armas Lindgren, who taught more recent architectural history, awoke a love in Aalto for Italian Renaissance architecture and an understanding of the organic thinking of Jugend architecture.1 In the paintings he made during his youth Aalto often portrayed historically layered urban milieus. -

Teodor Mateoc Editor
TEODOR MATEOC editor ------------------------------------------------ Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World (V) Teodor Mateoc editor CULTURAL TEXTS AND CONTEXTS IN THE ENGLISH SPEAKING WORLD (V) Editura Universităţii din Oradea 2017 Editor: TEODOR MATEOC Editorial Board: IOANA CISTELECAN MADALINA PANTEA GIULIA SUCIU EVA SZEKELY Advisory Board JOSE ANTONIO ALVAREZ AMOROS University of Alicante, Spaian ANDREI AVRAM University of Bucharest, Romania ROGER CRAIK University of Ohio, USA SILVIE CRINQUAND University of Bourgogne, France SEAN DARMODY Trinity College, Dublin, Ireland ANDRZEJ DOROBEK Instytut Neofilologii, Plock, Poland STANISLAV KOLAR University of Ostrava, Czech Republic ELISABETTA MARINO University Tor Vergata, Rome MIRCEA MIHAES Universitatea de Vest, Timisoara VIRGIL STANCIU Babes Bolyai University, Cluj-Napoca PAUL WILSON University of Lodz, Poland DANIELA FRANCESCA VIRDIS University of Cagliari, Italy INGRIDA ZINDZIUVIENE Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania Publisher The Department of English Language and Literature Faculty of Letters University of Oradea ISSN 2067-5348 CONTENTS Introduction Cultural Texts and Contexts in the English Speaking World: The Fifth Edition ............................................................................. 9 I. BRITISH AND COMMONWEALTH LITERATURE Adela Dumitrescu, Physiognomy of Fashion in Fiction: Jane Austen ..... 17 Elisabetta Marino, “Unmaidenly” Maidens: Rhoda Broughton’s Controversial Heroines ................................................ 23 Alexandru -

1 Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida
Dalí Museum, Saint Petersburg, Florida Integrated Curriculum Tour Form Education Department, 2015 TITLE: “Salvador Dalí: Elementary School Dalí Museum Collection, Paintings ” SUBJECT AREA: (VISUAL ART, LANGUAGE ARTS, SCIENCE, MATHEMATICS, SOCIAL STUDIES) Visual Art (Next Generation Sunshine State Standards listed at the end of this document) GRADE LEVEL(S): Grades: K-5 DURATION: (NUMBER OF SESSIONS, LENGTH OF SESSION) One session (30 to 45 minutes) Resources: (Books, Links, Films and Information) Books: • The Dalí Museum Collection: Oil Paintings, Objects and Works on Paper. • The Dalí Museum: Museum Guide. • The Dalí Museum: Building + Gardens Guide. • Ades, dawn, Dalí (World of Art), London, Thames and Hudson, 1995. • Dalí’s Optical Illusions, New Heaven and London, Wadsworth Atheneum Museum of Art in association with Yale University Press, 2000. • Dalí, Philadelphia Museum of Art, Rizzoli, 2005. • Anderson, Robert, Salvador Dalí, (Artists in Their Time), New York, Franklin Watts, Inc. Scholastic, (Ages 9-12). • Cook, Theodore Andrea, The Curves of Life, New York, Dover Publications, 1979. • D’Agnese, Joseph, Blockhead, the Life of Fibonacci, New York, henry Holt and Company, 2010. • Dalí, Salvador, The Secret life of Salvador Dalí, New York, Dover publications, 1993. 1 • Diary of a Genius, New York, Creation Publishing Group, 1998. • Fifty Secrets of Magic Craftsmanship, New York, Dover Publications, 1992. • Dalí, Salvador , and Phillipe Halsman, Dalí’s Moustache, New York, Flammarion, 1994. • Elsohn Ross, Michael, Salvador Dalí and the Surrealists: Their Lives and Ideas, 21 Activities, Chicago review Press, 2003 (Ages 9-12) • Ghyka, Matila, The Geometry of Art and Life, New York, Dover Publications, 1977. • Gibson, Ian, The Shameful Life of Salvador Dalí, New York, W.W. -

Salvador Dalí and Science, Beyond Mere Curiosity
Salvador Dalí and science, beyond mere curiosity Carme Ruiz Centre for Dalinian Studies Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres Pasaje a la Ciencia, no.13 (2010) What do Stephen Hawking, Ramon Llull, Albert Einstein, Sigmund Freud, "Cosmic Glue", Werner Heisenberg, Watson and Crick, Dennis Gabor and Erwin Schrödinger have in common? The answer is simple: Salvador Dalí, a genial artist, who evolved amidst a multitude of facets, a universal Catalan who remained firmly attached to his home region, the Empordà. Salvador Dalí’s relationship with science began during his adolescence, for Dalí began to read scientific articles at a very early age. The artist uses its vocabulary in situations which we might in principle classify as non-scientific. That passion, which lasted throughout his life, was a fruit of the historical times that fell to him to experience — among the most fertile in the history of science, with spectacular technological advances. The painter’s library clearly reflected that passion: it contains a hundred or so books (with notes and comments in the margins) on various scientific aspects: physics, quantum mechanics, the origins of life, evolution and mathematics, as well as the many science journals he subscribed to in order to keep up to date with all the science news. Thanks to this, we can confidently assert that by following the work of Salvador Dalí we traverse an important period in 20th-century science, at least in relation to the scientific advances that particularly affected him. Among the painter’s conceptual preferences his major interests lay in the world of mathematics and optics. -

Alvar Aalto and the Theory of Play: Through Analysis on Alvar Aalto’S Furniture Design
Alvar Aalto and the theory of play: Through analysis on Alvar Aalto’s furniture design Mayu Kamamoto / Osaka University / Osaka / Japan Blucher Design Abstract Proceedings November 2016, Play was an important concept for Finnish architect and designer Alvar Aalto (1898-1976). He Number 1, Volume 1 http://www.proceeding emphasized the importance of play in design activities. Aalto seems to have been influenced by s.blucher.com.br/articl Yrjö Hirn (1870-1952), a Finnish aesthetician and author of Barnlek [Child’s play, 1916]. From e-list/icdhs2016/list the late 1920s to 1940s, Aalto designed not only buildings, but also furniture. In functionalism, which spread from the early 1920s, experimentation with wood for furniture played a very im- portant role for Aalto. He emphasized that this experimentation was closely related to the idea of play. This study demonstrates Aalto’s suggestive idea through an analysis of his furniture de- sign. It can be said that the concept of play guided him to develop this idea. Keywords Alvar Aalto, Yrjö Hirn, play, furniture design, functionalism Introduction Alvar Aalto (1898-1976) was a Finnish architect and talented designer of furniture, glassware, lamps, and so on. He placed a lot of emphasis on play, a trait he shared with the Finnish aesthetician Yrjö Hirn (1870-1952). In 1916, Hirn wrote the book Barnlek [Child’s play], where he explained the importance of play. Aalto wrote an article entitled ‘Koetalo, Muuratsalo’ [Experimental house at Muuratsalo], pub- lished in the Finnish architectural journal Arkkitehti [Architect], where he stated the following: Whether or not Yrjö Hirn was the direct cause, at any rate the influence of his personality con- tributed to my firm conviction and instinctive feeling that in the midst of our laboring, calculating, utilitarian age, we must continue to believe in the crucial significance of play when building a society for human beings, those grown-up children. -

Congressional Record-Senate April 27 Petitions, Etc
8262 CONGRESSIONAL RECORD-SENATE APRIL 27 PETITIONS, ETC. 1941. Also, petition of the Workers' Health Bureau of Amer Under clause 1 of Rule XXII, petitions and papers were laid ic~, located in New York City, favoring the passage of tlfe on the Clerk's de k and referred as follows : Fitzgerald bill (H. R. 487), providing workman's compensation 1922. Petition of 52 citizens of Lama1·, Barton County, 1\Io., to workers employed in the District of Columbia · to the Com- protesting against House bill 7479, migratory bird refuge bill; mittee on the District of Columbia. ' to the Committee on Agriculture. 1942. Also, petition of George Bird Grinnell, of 236 East Fif 1923. Petition of the Prote tant churches of the village ~f teenth Street, New York City, fa-voring the pa ao-e of the game Arcade, N. Y:., opposing any modification of the prohibition refuge and marshland bill ( S. 2607 and H. R. 7479) ; to the law; to the Committee on the Judiciary. Committee on Agriculture. 1924. By Mr. BIXLER: Petition of C. S. Crawford and other 1943. Also, petition of Miss Katherine W. Smith of New York re idents of Ridgway, Pa., protesting again t any change in City, favoring the pas age of the game refuge a~d mar bland the eighteenth amendment and the Volstead law; to the Com conservation bill (H. R. 7479) ; to the Committee on Agricul mittee on the Judiciary. ture. 1925. Also, petition of Rev. J. E. lams and other residents of 1944. Also, petition of the Merchants' A sociation of New Johnsonburg, Pa., protesting against any change in the eight York, !avoring the creation of a national police bureau; to the eenth amendment and Volstead law; to the Committee on the Committee on the Judiciary. -
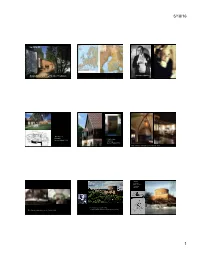
Lecture 22 Alvar Aalto and the Nordic Tradition
5/18/16 Lecture 22! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Alvar Aalto and the Nordic Tradition Alvar Aalto 1898-1975 *Eliel Saarinen Hvitträsk *Eliel Saarinen Luomo, Finland, 1903 Hvitträsk Luomo, Finland, 1903 *Eliel Saarinen, Hvitträsk, Luomo, Finland, 1903 *Asplund, Stockholm Public Library, Stockholm, 1920-28 Erik Gunnar Asplund (1885-1940), *Stockholm Public Library, Stockholm, Sweden, 1920-28 *Eliel Saarinen, Hvitträsk, Luomo, Finland, 1903 1 5/18/16 *Asplund, Stockholm Public Library, Stockholm, 1920-28 *Asplund, Stockholm Public Library, 1920-28 *Asplund, Stockholm Public Library, 1920-28 Boullee, National Library project Stockholm Public Library *Asplund, Stockholm Public Library, 1920-28 Aalto, Civil Guard Buildings: Stables, Seinajoki, Finland, 1924-26 Alvar Aalto (1898-1975) Aalto, Villa Vekara Karstula, Finland, 1924 Turun Sanomat News, Turku, Finland, 1928 Aalto, House for Terho Manner, Töyszä, Finland, 1923 2 5/18/16 * Alvar Aalto, * Alvar Aalto, Library, Library, Viipuri, Viipuri, Finland, 1927-35 * Alvar Aalto, Library, Viipuri, Finland, 1927-35 Finland, 1927-35 * Alvar Aalto, Library, Viipuri, Finland, 1927-35 * Alvar Aalto, Library, * Alvar Aalto, Library, Viipuri, Finland, 1927-35 Viipuri, Finland, 1927-35 * Alvar Aalto, (Tuberculosis) Sanitorium, Paimio, Finland, 1928-33 *(Tuberculosis) Sanitorium, Paimio, Finland *Alvar Aalto, (Tuberculosis) Sanitorium, Paimio, Finland 3 5/18/16 * Alvar Aalto, (Tuberculosis) Sanitorium, Paimio, Finland, 1928-33 *Alvar Aalto, (Tuberculosis) Sanitorium, Paimio, Finland Alvar Aalto, three-legged stacking -

The Utzon Paradigm
THE UTZON PARADIGM Roger Tyrrell Co-Director of the Jørn Utzon Research Network (JURN) and Adrian Carter Co- Director of the Jørn Utzon Research Network (JURN), Director of the Utzon Research Center, Aalborg University. RE-CONSIDERING UTZON “Comparable in subtle ways to the protean achievements of Le Corbusier, Utzon’s architecture emerges today as paradigmatic at many levels not least of which is the manner in which, from the beginning of his career, he would challenge the assumed superiority of Eurocentric culture.” (Frampton. K. 2003 p 6) This Paper strives to address three objectives. The first is to discuss the Utzon’s oeuvre from a paradigmatic perspective, the second to layer that paradigm within two distinct but interconnected frameworks. The third objective is to explore the fusion of this dichotomous paradigm through the concept of ‘poetic conjunction’. Jørn Utzon (1918-2008) is now internationally recognised as one of the most original, innovative and socially concerned of modern architects, perhaps the last great exponent of the humanistic Nordic tradition within modern architecture. He is the architect of what is still widely considered the most noble and humane housing built in Denmark, a simple, yet poetic modern church at Bagsværd and the most iconic and popular building of the 20th Century, his great unfinished masterpiece, the Sydney Opera House. (Fig 1) The Opera House has become the symbol of not just Sydney, but also Australia; that owes it origins to the maritime environment of Aalborg, where Jørn Utzon spent his youth, and the inspiration of his father Aage Utzon, an esteemed yacht designer. -

Muzeul Universității
https://biblioteca-digitala.ro Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași Muzeul Universității Historia Universitatis Iassiensis III/2012 EDITURA UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAȘI https://biblioteca-digitala.ro CONSILIUL EDITORIAL: Stefan Albrecht (Römisch‐Germanisches‐Zentralmuseum, Mainz) Pieter Dhondt (University of Eastern Finland, Joensuu) Dorin Dobrincu (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Iaşi) Gheorghe Iacob (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Vasile Ișan (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, din Iaşi) Victor Karady (Central European University, Budapesta) Inge Knudsen (Coimbra Group Office, Brussels) Bogdan‐Petru Maleon (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Hans‐Christian Maner (Johannes Gutenberg‐Universität, Mainz) Andi Mihalache (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” al Academiei Române, Iaşi) Marina Mureșanu Ionescu (Université Jean Monnet, Saint Etienne) Lucian Nastasă (Institutul de Istorie „George Bariţ” al Academiei Române, Cluj‐Napoca) Vasile Puşcaş (Universitatea „Babeş‐Bolyai”, Cluj‐Napoca) Alexander Rubel (Deutsches Kulturzentrum, Iași, Institutul de Arheologie, Iași) Cornel Sigmirean (Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş) László Szögi (Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta) Ion Toderașcu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Nicolae Ursulescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) COLEGIUL DE REDACȚIE: Florea Ioncioaia, redactor șef (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi) Leonidas Rados, redactor șef adjunct (Institutul de Istorie „A.