VÖ-Datum: 1.2.2013
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

PERFORMED IDENTITIES: HEAVY METAL MUSICIANS BETWEEN 1984 and 1991 Bradley C. Klypchak a Dissertation Submitted to the Graduate
PERFORMED IDENTITIES: HEAVY METAL MUSICIANS BETWEEN 1984 AND 1991 Bradley C. Klypchak A Dissertation Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY May 2007 Committee: Dr. Jeffrey A. Brown, Advisor Dr. John Makay Graduate Faculty Representative Dr. Ron E. Shields Dr. Don McQuarie © 2007 Bradley C. Klypchak All Rights Reserved iii ABSTRACT Dr. Jeffrey A. Brown, Advisor Between 1984 and 1991, heavy metal became one of the most publicly popular and commercially successful rock music subgenres. The focus of this dissertation is to explore the following research questions: How did the subculture of heavy metal music between 1984 and 1991 evolve and what meanings can be derived from this ongoing process? How did the contextual circumstances surrounding heavy metal music during this period impact the performative choices exhibited by artists, and from a position of retrospection, what lasting significance does this particular era of heavy metal merit today? A textual analysis of metal- related materials fostered the development of themes relating to the selective choices made and performances enacted by metal artists. These themes were then considered in terms of gender, sexuality, race, and age constructions as well as the ongoing negotiations of the metal artist within multiple performative realms. Occurring at the juncture of art and commerce, heavy metal music is a purposeful construction. Metal musicians made performative choices for serving particular aims, be it fame, wealth, or art. These same individuals worked within a greater system of influence. Metal bands were the contracted employees of record labels whose own corporate aims needed to be recognized. -
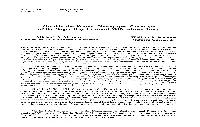
Newspaper Coverage of the Sugar Ray Leonard Wife Abuse Story
Sociology of Sport Journal,1993.10, 119-134 O 1993 Human Kinetics Publishers, Inc. Outside the Frame: Newspaper Coverage of the Sugar Ray Leonard Wife Abuse Story Michael A. Messner William S. Solomon University of Southern California Rutgers University This article analyzes the print media's ideological framing of the 1991 story of boxer Sugar Ray Leonard's admission of having physically abused his wife and abused cocaine and alcohol. We examined all news stories and editorials on the Leonard story in two major daily newspapers and one national sports daily. We found that all three papers framed the story as a "drug story," while ignoring or marginalizing the "wife abuse" story. We argue that sports writers utilized an existing ideological "jocks-on-drugs" media package that framed this story as a moral drama of individual sin and public redemption. Finally, we describe and analyze the mechanisms through which the wife abuse story was ignored or marginalized. Cette etude porte sur le cadre idkologique fa~onnbpar les media kcrits en ce qui concerne la nouvelle de I'annonce faite en 1991 par le boxeur Sugar Ray Leonard qu'il avait physiquement abusk de sa femme et abusk de la cocaiize et de I'alcool. Tous les articles et kditoriaux de deux journaux quotidiens et d'une revue sportive nationalefurent analysks. Les rksultats indiquent que les trois sources ont repris la nouvelle pour la presenter duns un cadre accentuant I'aspect "abus de drogue" et marginalisant ou ignorant I'aspect "violence conjugale." I1 est aussi suggkrk que les reporters sportifs ont utilisk un cadre idbologique dkja existant (celui du "sportif dope") qui eut pour effet de presenter la nouvelle en tant que dilemme moral ou il y a pbchk individuel et rkdemption publique. -

Mood Music Programs
MOOD MUSIC PROGRAMS MOOD: 2 Pop Adult Contemporary Hot FM ‡ Current Adult Contemporary Hits Hot Adult Contemporary Hits Sample Artists: Andy Grammer, Taylor Swift, Echosmith, Ed Sample Artists: Selena Gomez, Maroon 5, Leona Lewis, Sheeran, Hozier, Colbie Caillat, Sam Hunt, Kelly Clarkson, X George Ezra, Vance Joy, Jason Derulo, Train, Phillip Phillips, Ambassadors, KT Tunstall Daniel Powter, Andrew McMahon in the Wilderness Metro ‡ Be-Tween Chic Metropolitan Blend Kid-friendly, Modern Pop Hits Sample Artists: Roxy Music, Goldfrapp, Charlotte Gainsbourg, Sample Artists: Zendaya, Justin Bieber, Bella Thorne, Cody Hercules & Love Affair, Grace Jones, Carla Bruni, Flight Simpson, Shane Harper, Austin Mahone, One Direction, Facilities, Chromatics, Saint Etienne, Roisin Murphy Bridgit Mendler, Carrie Underwood, China Anne McClain Pop Style Cashmere ‡ Youthful Pop Hits Warm cosmopolitan vocals Sample Artists: Taylor Swift, Justin Bieber, Kelly Clarkson, Sample Artists: The Bird and The Bee, Priscilla Ahn, Jamie Matt Wertz, Katy Perry, Carrie Underwood, Selena Gomez, Woon, Coldplay, Kaskade Phillip Phillips, Andy Grammer, Carly Rae Jepsen Divas Reflections ‡ Dynamic female vocals Mature Pop and classic Jazz vocals Sample Artists: Beyonce, Chaka Khan, Jennifer Hudson, Tina Sample Artists: Ella Fitzgerald, Connie Evingson, Elivs Turner, Paloma Faith, Mary J. Blige, Donna Summer, En Vogue, Costello, Norah Jones, Kurt Elling, Aretha Franklin, Michael Emeli Sande, Etta James, Christina Aguilera Bublé, Mary J. Blige, Sting, Sachal Vasandani FM1 ‡ Shine -

Information and Secrecy in the Chicago DIY Punk Music Scene Kaitlin Beer University of Wisconsin-Milwaukee
University of Wisconsin Milwaukee UWM Digital Commons Theses and Dissertations December 2016 "It's My Job to Keep Punk Rock Elite": Information and Secrecy in the Chicago DIY Punk Music Scene Kaitlin Beer University of Wisconsin-Milwaukee Follow this and additional works at: https://dc.uwm.edu/etd Part of the Social and Cultural Anthropology Commons Recommended Citation Beer, Kaitlin, ""It's My Job to Keep Punk Rock Elite": Information and Secrecy in the Chicago DIY Punk Music Scene" (2016). Theses and Dissertations. 1349. https://dc.uwm.edu/etd/1349 This Thesis is brought to you for free and open access by UWM Digital Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of UWM Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. “IT’S MY JOB TO KEEP PUNK ROCK ELITE”: INFORMATION AND SECRECY IN THE CHICAGO DIY PUNK MUSIC SCENE by Kaitlin Beer A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Science in Anthropology at The University of Wisconsin-Milwaukee December 2016 ABSTRACT “IT’S MY JOB TO KEEP PUNK ROCK ELITE”: INFORMATION AND SECRECY IN THE CHICAGO DIY PUNK MUSIC SCENE by Kaitlin Beer The University of Wisconsin—Milwaukee, 2016 Under the Supervision of Professor W. Warner Wood This thesis examines how the DIY punk scene in Chicago has utilized secretive information dissemination practices to manage boundaries between itself and mainstream society. Research for this thesis started in 2013, following the North Atlantic Treaty Organization’s meeting in Chicago. This event caused a crisis within the Chicago DIY punk scene that primarily relied on residential spaces, from third story apartments to dirt-floored basements, as venues. -

Two Must-See 1990S Artists, Vanilla Ice and Mark Mcgrath, Are Bringing
Contact: Caitlyn Baker [email protected] (805) 944-7780 (c) (805) 350-7913 (o) VANILLA ICE AND MARK MCGRATH TO PERFORM AT CHUMASH CASINO RESORT SANTA YNEZ, CA – May 30, 2019 – Two must-see 1990s artists, Vanilla Ice and Mark McGrath, are bringing their “I Love the 90’s” tour to the Chumash Casino Resort’s Samala Showroom at 8 p.m. on Friday, June 28, 2019. Tickets for the show are $49, $59, $69, $74 and $79. Be prepared to go back in time and enjoy a retro night of music, dancing and nostalgic hits like “Ice, Ice Baby,” “Play That Funky Music,” “Fly” and “Every Morning.” Born Robert Matthew Van Winkle, Vanilla Ice first caught mainstream attention in 1990 when a local DJ decided to play “Ice Ice Baby,” a B-side track from his debut album “Hooked.” Due to the track’s quickly growing success, Ice re-released his debut, and not so successful, album, “Hooked,” under the title “To The Extreme.” This album went on to tell more than 15 million copies and once held the record for the highest selling rap record of all time. Later in 1991, Vanilla Ice decided to get involved with the movie business. He made an appearance in “Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze” and then later scored his first feature film, “Cool as Ice.” Later that year, he released a live concert album, “Extremely Live,” which sold 500,000 copies and reached Gold status. Today, he can be seen on his home renovation reality television series, “The Vanilla Ice Project.” The show wrapped up its eighth season this past fall. -

International Students Reflect on Floyd Widener ~Ware Campus Closed Due to Floyd's Effects
THE STUDENT .; .... :.;.;.:::::: ::::: ~ :c. .~ NEWSPAPER OF ....... :.: ::.::::::~::: :«0:::::::::: :::. WIDENER UNIVERSITY http://dome.life.nu Covering the good stuff (610) 499'4.421 INSIDE ENTERTAINMENT NEWS SPORTS University 2 Philadelphia 3 NY Surrenders Widener students Women's V Opinion 4 to Chemical Comics/Games 6 Ball p.12 Brothers p.8 abroad p.2 Entertainment 8 WIDENER PROFESSOR PASSES AWAY, Widener Feels Floyd SAYING FAIRWELL TO DR. CLARK. Ben Myers Brian O'Rourke RELATIONS MANAGER The University suffered a terrible first faculty member to participate in the STAFF WRITER defeat two weeks ago, when Dr. Michael German Exchange Program. Clark passed away. Dr. Clark Both teachers and students gave the Hurricane Floyd which passed along joined Widener IS faculty in 1981, same answers in describing- Dr. Clark: after receiving his Ph.D. from the IIFine mind ... very accessible ... down-to the east coast on September 18, 19, and University of Wisconsin-Madison. earth... he was the best in the 20 left devastation everywhere. Causing He was a professor of English and Department. II Dr. Lopota, a colleague for a time, the Associate Dean of hired by Dr. Clark, said, IIHe was the massive flooding and property damage Humanities. type of guy who could write two books Dr. Clark had a hand in just on Dos Passos, and then turn around in the Carolinas, Floyd also caused dam and have a drink with you at WalliolS. 1I about every facet of English at age along the upper east coast. In New Widener University. He did not Dr. Serambis, present Associate Dean speak the English language, he of Humanities, had this to say of his Jersey and Delaware states of emergen commanded it. -

AD GUITAR INSTRUCTION** 943 Songs, 2.8 Days, 5.36 GB
Page 1 of 28 **AD GUITAR INSTRUCTION** 943 songs, 2.8 days, 5.36 GB Name Time Album Artist 1 I Am Loved 3:27 The Golden Rule Above the Golden State 2 Highway to Hell TUNED 3:32 AD Tuned Files and Edits AC/DC 3 Dirty Deeds Tuned 4:16 AD Tuned Files and Edits AC/DC 4 TNT Tuned 3:39 AD Tuned Files and Edits AC/DC 5 Back in Black 4:20 Back in Black AC/DC 6 Back in Black Too Slow 6:40 Back in Black AC/DC 7 Hells Bells 5:16 Back in Black AC/DC 8 Dirty Deeds Done Dirt Cheap 4:16 Dirty Deeds Done Dirt Cheap AC/DC 9 It's A Long Way To The Top ( If You… 5:15 High Voltage AC/DC 10 Who Made Who 3:27 Who Made Who AC/DC 11 You Shook Me All Night Long 3:32 AC/DC 12 Thunderstruck 4:52 AC/DC 13 TNT 3:38 AC/DC 14 Highway To Hell 3:30 AC/DC 15 For Those About To Rock (We Sal… 5:46 AC/DC 16 Rock n' Roll Ain't Noise Pollution 4:13 AC/DC 17 Blow Me Away in D 3:27 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 18 F.S.O.S. in D 2:41 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 19 Here Comes The Sun Tuned and… 4:48 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 20 Liar in E 3:12 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 21 LifeInTheFastLaneTuned 4:45 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 22 Love Like Winter E 2:48 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 23 Make Damn Sure in E 3:34 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 24 No More Sorrow in D 3:44 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 25 No Reason in E 3:07 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 26 The River in E 3:18 AD Tuned Files and Edits AD Tuned Files 27 Dream On 4:27 Aerosmith's Greatest Hits Aerosmith 28 Sweet Emotion -

Robert Walser Published Titles My Music by Susan D
Running With the Devil : Power, Gender, title: and Madness in Heavy Metal Music Music/culture author: Walser, Robert. publisher: Wesleyan University Press isbn10 | asin: 0819562602 print isbn13: 9780819562609 ebook isbn13: 9780585372914 language: English Heavy metal (Music)--History and subject criticism. publication date: 1993 lcc: ML3534.W29 1993eb ddc: 781.66 Heavy metal (Music)--History and subject: criticism. Page i Running with the Devil Page ii MUSIC / CULTURE A series from Wesleyan University Press Edited by George Lipsitz, Susan McClary, and Robert Walser Published titles My Music by Susan D. Crafts, Daniel Cavicchi, Charles Keil, and the Music in Daily Life Project Running with the Devil: Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music by Robert Walser Subcultural Sounds: Micromusics of the West by Mark Slobin Page iii Running with the Devil Power, Gender, and Madness in Heavy Metal Music Robert Walser Page iv WESLEYAN UNIVERSITY PRESS Published by University Press of New England, Hanover, NH 03755 © 1993 by Robert Walser All rights reserved Printed in the United States of America 5 4 3 2 1 CIP data appear at the end of the book Acknowledgments for song lyrics quoted: "Electric Eye": Words and music by Glenn Tipton, Rob Halford, and K. K. Downing, © 1982 EMI APRIL MUSIC, INC. / CREWGLEN LTD. / EBONYTREE LTD. / GEARGATE LTD. All rights controlled and administered by EMI APRIL MUSIC, INC. International copyright secured. All rights reserved. Used by permission. "Suicide Solution": Words and music by John Osbourne, Robert Daisley, and Randy Rhoads, TRO© Copyright 1981 Essex Music International, Inc. and Kord Music Publishers, New York, N.Y. -

Undercover Marine Reconnaisance Units Help to Retake Saudi City from Iraqis
`Does' sharpen readiness . just in case Milestones of Afro-American Page A-2 heritage recognized Investigation verifies Iraqi cruelty Page B1 -1 Local family makes MWR way of life Page A-5 Vol. 20, No. 5 Published at MCAS Kaneohe Bay. Also serving 1st MEB, Camp H.M. Smith and Marine Barracks, Hawaii. February 7, le Undercover Marine reconnaisance units help to retake Saudi city from Iraqis By Set. Brad Mitzeden awakening if they had come up enemy troops. Reports on Saudi KHAFJI, Saudi Arabia after us," Brown said. and Qatari losses were sketchy Saudi and Qatari forces largely Apart from keeping their at best, but indications are that fought the allied battle for this heads down, the Marines also they were light to moderate. border city. However, two recon- took other precautions such as "Those Saudis have a lot of naissance teams from the let burning all personal and offi- heart," Ingraham said. "They Marine Division worked under- cial documents and using spe- had the hard job. They came cover to help retake Khafji from cial communications procedures in and went for broke. They an armored Iraqi force which to avoid detection. made themselves targets in order invaded early Jan. 29. All in all, according to Ingra- to find the Iraqis." The Marines remained hidden ham, it was a classic reconnais- Admire said that perhaps too from the enemy during two days sance mission, albeit unplanned much attention has been given of heavy fighting, which was and particularly unnerving. to the fact that the allies pulled supported by Marine air and "I never expected that kind of back after a previous attempt artillery. -

2008 Erik Axel Karlfeldt Memorial Open Round 1
2008 Erik Axel Karlfeldt Memorial Open Round 1 1. In Pete Dexter’s novel Paris Trout, these are discovered in Paris’s safes after his suicide. In John Barth’s novel The Floating Opera, the disposition of 72 of these allows Todd Andrews to win a suit about a contested will. In the course of doing publicity for Synecdoche, New York, Charlie Kaufman made it known that he did not collect these. Mojo Nixon wrote a song expressing his refusal to create one of these, which noted that Foghorn Leghorn and Huey Long would also refuse to create them. One of these was depicted in a photograph by Andres Serrano which also featured a crucifix. In The Aviator, Leonardo DiCaprio’s character is seen holed up in a room with them. FTP, identify these containers filled with a distasteful liquid. ANSWER: jars of urine (accept equivalents) 2. He played a pilot named Luke on the series Baa Baa Black Sheep, and also starred in the short-lived 2003 series Happy Family. He appeared on Kitchen Confidential as a customer trying to eat himself to death and on House as Vegetative State Guy, who was killed by House. After winning four straight Emmy awards starting in 1985 he requested that he not be nominated again. He was Kitty’s AA sponsor on Arrested Development, and played the evil Lawrence van Dough in the 1994 film Richie Rich. His most recent TV role has seen him return to the legal practice on Boston Legal as Carl Sack. FTP, name this actor who was Dan Fielding on Night Court. -

Spirit April
The Greenfield Spirit Apr-May 2015 GREENFIELD’S COMMUNITY NEWSLETTER VOLUME 22.0 Visit the town website at http://www.greenfield-nh.gov/ for more information FREE TOWN MEETING RESULTS Please consult the green pages of your annual report for the text of the warrant articles. Article 1: Inside this issue Selectboard - Stephen Atherton Jr. 225th Anniversary ........................13 Fire Chief - David Hall Cloverly Farm CSA .......................6 Town Clerk - Dee Sleeper Emerald Ash Borer ....................9 Trustee of Trust Funds - 3 years - Kenneth Paulsen Food Pantry...................................6 Trustee of Trust Funds - 2 years - Vicki Norris Fire Chief’s Corner.........................5 Trustee of Trust Funds - 1 year - Linda Nickerson Free CPR Training .........................6 Library Trustee - 3 years - Jami Bascom Cemetery Trustee - 3 years - Margo Charig Bliss From the Recycling Center .............4 Planning Board - 3 years - Kenneth Paulsen Historical Society News..................3 Budget Committee - 3 years - Kevin Taylor Memorial Day Planning .................3 Budget Committee - 3 years - Myron Steere III Monadnock Roller Derby ...............6 Budget Committee - 2 years - Kenneth Paulsen Recreation..................................11 Budget Committee - 2 years - Norman Nickerson Roadside Round-Up .....................10 Budget Committee - 1 year - Susan Moller Spirit Deadlines......................6, back School Representative - Myron Steere III School Board Moderator - 3 years - Timothy Clark Stephenson Library -

September 1985, Vol. 8 Issue 1
THE SUNY COBLESKILL VOLUME 8 ISSUE ONE SEYf. '85 Welcome to Coby Welcome to Coby! My name is Christy Roe and I will be 'serving you as your Student Government President. I am very optimistic about the year ahead, and I hope that you are also. I would like to fake this opportunity to pass on to you a few of my thoughts. As you stepped from high school into college you learn about many new freedoms that you've never had before. Don't forget that with freedOI}1 comes responsibility, responsibilities to your school and to yourself. You paid good money to attend this school so take pride in being a part of Cobleskill College and take pride in yourself . College is the place where you further your education while at the same time meeting new people and doing new things. Respect is important in college life, not only should you respect others, but show some respect for yourself. Treat people the way in which you like to be tgreated and be sensitive to their feelings. We are a ll coming here as individuals with your own ideas and it's important to share them. As we learn from each other we also Recruitment Sta rts E arly: President Nea l Robbi ns is shown here· learn valuable lessons about ourselves. So stand up for what you receiving a welcom ing handshake fr om Orion Ha mchuk whose believe in! . mother, Linda L emback, is a m ember of the f r eshman class, Cobleskill has many opportunities in whic h you can become m ajoring in Nur se r y Managem en t .