D Geschichte Und Länderkunde Dgaa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Johann Sleidan and the Protestant Vision of History 1St Edition Download Free
JOHANN SLEIDAN AND THE PROTESTANT VISION OF HISTORY 1ST EDITION DOWNLOAD FREE Alexandra Kess | 9781351925259 | | | | | Johannes Sleidanus In chapter 5, she examines the sources used by Sleidan, drawing attention to the role his service as a diplomat played in his ability to gather the material, but also in shaping his perspective and approach to the subject. Kelley has lauded Johann Philippson von Sleidan as the "father of Reformation history" and numbered him among "the greatest of modern historians. Built on the Johns Hopkins University Campus. Kess's work will thus only satisfy those who are prepared to accept ambivalence and ambiguity in the historical figure she presents. Select bibliography. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. At the end of his life, Sleidan expressed disappointment over a career that had "soured after once looking so promising" Kess has shown that the Commentaries were but one of many works composed in the sixteenth century that contributed to Protestant visions of history; the quest for the Protestant vision of history in this period is better redirected than further pursued. In this respect, the chapter on the French reception of Sleidan is thorough, down to details about the printing history and the various editions--more so than the parallel discussion of the German reception. Soon afterwards he became a civil servant of the city of Strasbourg, and finished his great task inthough lack of money and other misfortunes compelled him to delay printing. I examine the unexpectedly hostile reactions to the first edition and its very rapid success Johann Sleidan and the Protestant Vision of History 1st edition purchasers. -

History, Historiography, and Interpretations of the Reformations
Chapter 1 History, Historiography, and Interpretations of the Reformations We are like dwarfs standing on the shoulders of giants; thanks to them, we see farther than they. Busying ourselves with the treatises written by the ancients, we take their choice thoughts, buried by age and human neglect, and we raise them, as it were from death to renewed life. Peter of Blois (d. 1212) History and Historiography Peter of Blois penned this famous aphorism almost exactly three centuries before Luther’s “Ninety-Five Theses” rocked Europe. A major study of the historiography of the Reformation (Dickens and Tonkin 1985: 323) concludes that it is “a window on the West, a major point of access to the developing Western mind through the last five centuries. … By any reckoning, the Reformation has proved a giant among the great international movements of modern times.” On its shoulders we can look far- ther and deeper in both directions; that is, we can peer into both the medieval and contemporary worlds. History provides a horizon for viewing not only the past but also the present and the future. The philosopher Hans-Georg Gadamer (1975: 269, 272) argued that a person without a horizon will overvalue what is immediately present, whereas the horizon enables us to sense the relative significance of what is near or far, great or small. “A horizon means that one learns to look beyond what is close at hand – not in order to look away from it, but to see it better within a larger whole and in truer proportion.” In other words, “far away facts – in history as in navigation – are more effective than near ones in giving us true bearings” (Murray 1974: 285). -

Tudor Conciliar Theorists
Loma Linda University TheScholarsRepository@LLU: Digital Archive of Research, Scholarship & Creative Works Loma Linda University Electronic Theses, Dissertations & Projects 9-1975 Tudor Conciliar Theorists Daniel E. Mitchel Follow this and additional works at: https://scholarsrepository.llu.edu/etd Part of the European History Commons Recommended Citation Mitchel, Daniel E., "Tudor Conciliar Theorists" (1975). Loma Linda University Electronic Theses, Dissertations & Projects. 1074. https://scholarsrepository.llu.edu/etd/1074 This Thesis is brought to you for free and open access by TheScholarsRepository@LLU: Digital Archive of Research, Scholarship & Creative Works. It has been accepted for inclusion in Loma Linda University Electronic Theses, Dissertations & Projects by an authorized administrator of TheScholarsRepository@LLU: Digital Archive of Research, Scholarship & Creative Works. For more information, please contact [email protected]. Abstract TUDOR CONCILIAR THEORISTS I by Daniel E. Mitchel This thesis ~nalyzes a variety of sources such as printed books, diplomatic correspondence, letters, and notes, from which a description of Tudor ideas in relation to proposals to hold a general council can be derived. This Tudor Conciliar Theory has a definite beginning. Henry VII I developed a.flexible foreign policy to deal with continental suggestions to hold a general council of the church. The position which he took was that the English nation was not opposed to such a gathering, but on every occasion, matters of detail were used to block English participation. While these procedural details kept Henry from participating, a second 11wal1 11 of defense was raised: Henrician propagandists insisted that the princes of Christendom, not the pope, should be instrumental in calling a council into session. -

Discourses of Religious Change in England, C. 1414 – 1688
THE SEMANTICS OF REFORMATION: DISCOURSES OF RELIGIOUS CHANGE IN ENGLAND, C. 1414 – 1688 By [Copyright 2016] Benjamin Michael Guyer Submitted to the graduate degree program in History and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy. ________________________________ Chairperson: Jonathan Clark ________________________________ Luis Corteguera ________________________________ Katherine Clark ________________________________ Steven Epstein ________________________________ Geraldo Sousa Date Defended: March 07, 2016 The Dissertation Committee for Benjamin Michael Guyer certifies that this is the approved version of the following dissertation: THE SEMANTICS OF REFORMATION: DISCOURSES OF RELIGIOUS CHANGE IN ENGLAND, C. 1414 – 1688 ________________________________ Chairperson: Jonathan Clark Date approved: March 07, 2016 ii Abstract The Semantics of Reformation: Discourses of Religious Change in England, c. 1414 – 1688 examines how the events of the sixteenth century were conceptualized as the English Reformation. The word ‘reformation’ was widely used during these centuries, but its meaning changed in significant ways. By adopting a linguistic methodology, the dissertation studies reformation as a concept in motion; consequently, the English Reformation, a term widely used today, is treated not as an analytic category but as a historiographical label that developed contingently. The chapters fall into three roughly equal sections, each of which covers a distinct discourse of reformation. Chapters one and two cover the first discourse, which identified reformation as the work of a church council. This discourse began at the Council of Constance (1414 – 1418) and remained firmly in place in all Christian localities through the mid-sixteenth century, when it was challenged by a new discourse: reformation by armed resistance, which is introduced at the end of chapter two and discussed in chapters three and four. -
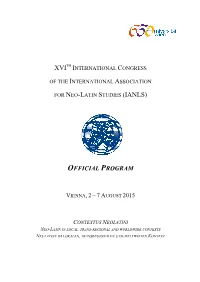
Official Program
XVITH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NEO-LATIN STUDIES (IANLS) OFFICIAL PROGRAM VIENNA, 2 – 7 AUGUST 2015 CONTEXTUS NEOLATINI NEO-LATIN IN LOCAL, TRANS-REGIONAL AND WORLDWIDE CONTEXTS NEULATEIN IM LOKALEN, TRANSREGIONALEN UND WELTWEITEN KONTEXT ~ 2 ~ XVITH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR NEO-LATIN STUDIES (IANLS) OFFICIAL PROGRAM VIENNA, 2 – 7 AUGUST 2015 CONTEXTUS NEOLATINI NEO-LATIN IN LOCAL, TRANS-REGIONAL AND WORLDWIDE CONTEXTS NEULATEIN IM LOKALEN, TRANSREGIONALEN UND WELTWEITEN KONTEXT ~ 3 ~ Druck: Bernhard Hofeneder Stadtdrucker 2012 GmbH Kolingasse 12 A-1090 Wien Layout: Franz Römer & Sonja Schreiner Redaktionsschluss: 14. Juli 2015 ~ 4 ~ TABLE OF CONTENTS Organizing Committee – Sponsors & Partners 6 Grußadresse des Wiener Bürgermeisters 7 Executive Committee – Advisory Board 8 Opening Ceremony 9 Plenary Papers 10 Conspectus Consessuum 11 Abstracts – Papers & Posters 36 Special Sessions 158 Practical Information 168 Maps 170 Exhibitors 175 Sponsors & Partners 177 ~ 5 ~ Organizing Committee: Chair: Franz Römer Coordinator: Sonja Schreiner Further Members: Elisabeth Klecker (Editor: „Fasti Austriae“) Annamaria Lesigang-Bruckmüller Sponsors & Partners: STADT WIEN: Magistratsdirektion – Präsidialabteilung des Bürgermeisters MA 7 – Wien Kultur Austrian Airlines – Official Carrier VEF – Rent a Bim Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. MAW. Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft. International Exhibitions & Advertising GuterStoff T-Shirt Druck Wien Mensa C.D. -

Der Krieg Frankreich Und Die Deutsche Fürstenopposition Gegen Karl V
Die Ehre – die Freiheit – der Krieg Frankreich und die deutsche Furstenopposition¨ gegen Karl V. 1547/48 – 1552 Teil 1 Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwurde¨ der Philosophischen Fakult¨at III (Geschichte, Gesellschaft und Geographie) der Universit¨at Regensburg vorgelegt von Ines Grund aus Bad Camberg 2006 Bad Camberg 2007 Erstgutachter: Prof. Dr. Albrecht P. Luttenberger Zweitgutachter: Prof. Dr. Peter Schmid Tag der mundlichen¨ Prufung:¨ 9. Februar 2007 Inhaltsverzeichnis Vorwort iii Einleitung v 1 Uber¨ die Ehre 1 1.1 Die Gefangennahme Landgraf Philipps von Hessen – ein Ehren- handel................................. 1 1.2 Freuntlicher lieber bruder – die Ehre Friedrichs von Castell . 15 2 Uber¨ die Freiheit 23 2.1 Gewissensfreiheit und Machterhalt . 23 2.1.1 Des Kaisers neue Religion – das Augsburger Interim . 24 2.1.2 Ausloten der Freiheit des Christenmenschen gegenuber¨ seiner weltlichen Obrigkeit – der Fall Magdeburg . 32 2.1.3 Konzilsformen als Indikatoren politischer Interessenlagen 47 2.2 Spanische Servitut und deutsche Libert¨at ............. 51 2.2.1 Wahlkaisertum als Familienangelegenheit . 51 2.2.2 Libert¨at – der Bedeutungshorizont reichsst¨andischer Mit- sprache ............................ 55 2.2.3 Defension I – K¨onigsbergerBund . 58 2.3 FrenchConnection .......................... 64 2.3.1 Flucht und Verteidigung – der gute Nachbar Frankreich . 64 2.3.2 Reichstagsausreden. 77 2.3.3 Defension II – Torgauer Bund . 84 2.3.4 Bekenntniskonsens als Handlungsgrundlage . 103 2.3.5 Außenpolitische Kontexte . 106 2.3.6 Offension I – Vertrag von Lochau . 109 2.3.7 Instrumentalisierte Ehre – Furbitte¨ und Einstellung in Hessen.............................129 2.3.8 Offension II – Vertrag von Chambord . 150 2.3.9 Offension IIa – Friedewald . 160 i ii 3 Uber¨ den Krieg 163 3.1 Der Feldzug der Kriegsfursten¨ gegen den Kaiser . -

Reformations Lost and Found CARINA L
INTRODUCTION 12 Reformations Lost and Found CARINA L. JOHNSON hen Johannes Sleidanus became the official historian of the Schmal- Wkaldic League in 1545–46, he was charged with describing “the whole matter of religion as it had started in our times, how far it has proceeded, and the events that have happened concerning this.” To advance the project, Elector John Frederick of Saxony and Landgrave Philip of Hesse agreed to supply Sleidanus with documentary source materials as needed. The princes also stipulated that they should have final approval over the resulting history. After the League was defeated and the princes imprisoned, Sleidanus perse- vered in his research, seeking documentary sources elsewhere. His history of the initial decades of religious reform was published in 1555 during the Diet of Augsburg. Sleidanus and his printer expected a controversial reception of the Commentaries on the Condition of Religion and the State under Charles V by Catholics and the Habsburg court, and sought to limit its social disruptiveness by printing it only in Latin. Protestant objections to the Commentaries were less anticipated, yet Philipp Melanchthon criticized it for containing “much which should be buried in eternal silence.” Sleidanus defended his history by emphasizing its dependence on the documentary evidence. Despite such cri- tiques, the Commentaries became extremely popular, and the book was soon translated into German, French, and other vernaculars. The history was con- sidered an indispensable account of politics and religion in the Holy Roman Empire during the first half of the sixteenth century. Its success led Sleidanus to be heralded as the first historian of the Reformation.1 Sleidanus’s experiences highlight the complexities of writing and reading histories of the Reformation. -

Die Manderscheider Herrschaft Schleiden Im Reformationszeitalter
Die Manderscheider Herrschaft Schleiden im Reformationszeitalter Vortrag für das Geschichtsforum Schleiden im Evangelischen Gemeindehaus Gemünd am 13. September 2016 von Andreas Züll, M.A. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste! Lassen Sie mich – als gebürtiger Schleidener – einige persönliche Worte voranstellen. Es ist mir eine außerordentlich schöne Ehre, heute hier im evangelischen Gemeindehaus zu Ihnen über die wechselvolle Geschichte der Reformation in unserer Region sprechen zu können und ich möchte mich herzlich bei dem Geschichtsforum Schleiden, der evangelischen Trinitatis- Gemeinde und dem Netzwerk Urft und Olef für die Einladung hierher bedanken. Ich wähne mich dabei in bester Gesellschaft: Im ansonsten unglückseligen Jahr 1933 hielt hier in Gemünd der Ihnen sicher bekannte Lehrer und Lokalhistoriker Wilhelm Günther schon einmal einen thematisch ähnlichen Vortrag, wenn auch mit dem aus heutiger Sicht etwas martialisch klingenden Titel Die Reformation und der Kampf um ihren Bestand in der Nord- Eifel. Die kämpferische Rhetorik zwischen den christlichen Konfessionen gehört – Gottlob! – im Großen und Ganzen längst der Vergangenheit an und ist der ökumenischen Zusammenarbeit gewichen. Und so ist eigentlich schon fast selbstverständlich geworden, was vor 83 Jahren noch gar nicht so selbstverständlich war, dass ein katholischer Historiker in einem evangelischen Hause über die gemeinsame Geschichte der Reformationsepoche sprechen kann. In Zeiten, in denen wieder viel über religiöse und kulturelle Unterschiede debattiert wird, ist das eine gute, eine hoffnungsvolle und vor allem eine ermutigende Sache! Auch der Protestant Günther hat das schon verstanden, er hat in seinen Arbeiten oft die Wogen zu glätten versucht, die zu seiner Zeit unter den Lokalhistorikern beider konfessioneller Lager noch oft hoch schäumten. -

Thomas Stapleton, the Life and Illustrious Martyrdom of Sir Thomas
THE LIFE AND ILLUSTRIOUS MARTYRDOM OF SIR THOMAS MORE by THOMAS STAPLETON Translated by PHILIP E. HALLETT Edited by Katherine Stearns and Emma Curtis CTMS Publishers at the University of Dallas © 2020 1 AbbreviAtions Corr The Correspondence of Sir Thomas More, ed. Elizabeth F. Rogers (Princeton University Press, 1947), followed by page numbers. CW The Complete Works of St. Thomas More, 15 vols. (Yale University Press, 1963–97), followed by volume and page numbers. CWE The Collected Works of Erasmus, 86 vols. (Toronto University Press, 1974–), followed by volume and page numbers. EE Erasmi Epistolae, ed. P. S. Allen et. al, 12 vols. (Oxford University Press, 1906–55), followed by letter number. EW Essential Works of Thomas More, ed. Gerard B. Wegemer and Stephen W. Smith. (Yale University Press, 2020), followed by page number. H (Hallett) Thomas Stapleton’sThe Life and Illustrious Martyrdom of Sir Thomas More, trans. and notes by Philip E. Hallett (Burns and Oates, 1966), followed by page number. R (Reynolds) Thomas Stapleton’sThe Life and Illustrious Martyrdom of Sir Thomas More, trans. by Philip E. Hallett; notes by E. E. Reynolds (Burns and Oates, 1966; Fordham UP, 1984), followed by page and note number. S Stapleton’s note 2 Contents Preface by Thomas Stapleton . 4 1. Birth, Education, and Studies. 6 2. His Youth . 8 3. His Public Career. 13 4. His Wide Learning and Literary Work . 19 5. The Many Learned and Famous Men Who Were His Friends . 25 6. His Holiness of Life . 37 7. His Contempt of Honors and Praise . 42 8. His Contempt of Riches . -

Spätmittelalter, Humanismus, Reformation / Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation
Spätmittelalter, Humanismus, Reformation / Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation Edited by Volker Leppin in association with Amy Nelson Burnett, Johannes Helmrath, Matthias Pohlig, Eva Schlotheuber, and Klaus Unterburger The series Studies in the Late Middle Ages, Humanism, and the Reformation (SMHR) focuses on the period between the late 13th century and the 17th century, including both epochs of the late Middle Ages and the early modern age. Particular attention is paid to the religious incentives which emerged in the church reform movements and the Reformation. In addition, it will deal with the entire range of cultural forces as represented by Renaissance humanism, which covers several epochs. The editor-in-chief of the series is Volker Leppin (Professor for Church History at the Eberhard Karls Universität Tübingen), he is supported by Amy Nelson Burnett (Professor for Renaissance, Reformation and Early Modern History at the University of Nebraska-Lincoln, USA), Johannes Helmrath (Professor for Medieval History II at the Humboldt-Universität zu Berlin), Matthias Pohlig (Juniorprofessor for Early Modern History at the Westfälischen Wilhelms-Universität Münster), Eva Schlotheuber (Professor for Medieval History II at the Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf), and Klaus Unterburger (Professor for Historical Theology/Medieval and Modern Church History at the Universität Regensburg). ISSN: 1865-2840 - Suggested citation: SMHR Last updated: 30/09/2021. Prices are subject to change. Order now: https://www.mohrsiebeck.com/en/monograph-series/spaetmittelalter-humanismus-reformation-studies-in-the-late-middle-ages-humanism-and-the- reformation-smhr?no_cache=1 [email protected] Phone: +49 (0)7071-923-0 Fax: +49 (0)7071-51104 Mohr Siebeck GmbH & Co. -

Early Printed Books in the Heiko A. Oberman Library at the University of Arizona
EARLY PRINTED BOOKS IN THE HEIKO A. OBERMAN LIBRARY AT THE UNIVERSITY OF ARIZONA Carl T. Berkhout EARLY PRINTED BOOKS IN THE HEIKO A. OBERMAN LIBRARY AT THE UNIVERSITY OF ARIZONA With an Appendix: Selected Recent Acquisitions CARL T. BERKHOUT Department of Special Collections University of Arizona Libraries Tucson 2017 The cover illustration is the device on the title pages of nos. 19 and 20. Copyright © 2017 Arizona Board of Regents for the University of Arizona Libraries Contents Preface 5 Bibliography 9 Early Printed Books 14 Appendix: Selected Recent Acquisitions 51 Indexes Authors, Editors, and Translators 71 Printers and Publishers 73 Provenance 75 4 EAR LY PRINTED BOOKS IN THE HEIKO A. OBERMAN LIBRARY 5 Preface Ut conclave sine libris, ita corpus sine anima. EVEN WHILE DECLINING that maxim’s common but dubious attribution to Cicero, whose writings he knew well, Heiko A. Oberman genially agreed that a room without books is like a body without a soul. Every room in Oberman’s pleasant home in the Santa Catalina foothills overlooking Tucson did in fact have its books—many books—and indeed a soul. From his student years in his native Utrecht and at Oxford and then through his long career of research and teaching at Harvard University, the Universität Tübingen, and the University of Arizona, he had assembled an extensive personal library in support of his untiring scholarship in late medieval and Reformation history. Shortly before his death on 22 April 2001 he and his family offered his books for acquisition by the University of Arizona Libraries as part of an arrangement that would establish a chair in his name in the College of Social and Behavioral Sciences’ Division for Late Medieval and Reformation Studies, a unit that he had founded five years after his arrival at the University in 1984. -

Commentary on Additions to a Tale of A
Additions to A Tale of a Tub Commentary p.1 Abstract of what follows after Sect. IX. in the Manuscript] Although this has been thought to be “a mistake for ‘X’” (GUTHKELCH AND NICHOL SMITH, p. 302n1), there are good reasons to believe that “Sect. IX” is correct (see Textual and Historical Introduction, p. 7). The History of Martin] ‘Martin’ naturally evokes the spiritus rector of the Reformation (see the footnote appended to the Tale’s fifth edition of 1710 [Prose Works, I, 84]), Martin Luther (1483-1546), whose controversial and contentious life looms particularly large in two ecclesiastical histories which Swift “abstracted” at Moor Park in 1697/8 (REAL [1978], pp. 128, 130): the first by Johannes Sleidanus, Commentariorum de statv religionis & reipublicæ Carolo V Cæsare libri xxvi ([Frankfurt: Johannes Theodor Schönwetter, 1610], pp. 1-74), and the second by Pietro Soave, better known as Father Sarpi, History of the Council of Trent (trans. Sir Nathanael Brent [London: by John Macock for Samuel Mearne, et al., 1676], pp. 5-15, 70-72, and passim [PASSMANN AND VIENKEN III, 1704-5]); ‘Martin’ also represents the Church of England (see the gloss on “to drop the former Martin, & to substitute in his place Lady Besses Institution, which is to pass under the name of Martin in the sequel of this true History” [p. 5, ll. 18-20]). Irritatingly, however, Martin seems to be the ‘weakest’ and the least outstanding of the three brothers in the Tale; a fact that has led to the extraordinary conclusion that “Swift would have accomplished his aim best by leaving Martin out” (Ehrenpreis, Mr Swift, pp.