Unterwegs Im Blauen Universum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

You're Listening to Ocean Currents, a Podcast Brought to You by NOAA's Cordell Bank National Marine Sanctuary
1 July 7th, 2014, oc070714.mp3 Free Diving and El Nino 2014 Jennifer Stock, Francesca Koe, Logan Johnson Jennifer Stock: You're listening to Ocean Currents, a podcast brought to you by NOAA's Cordell Bank National Marine Sanctuary. This radio program was originally broadcast on KWMR in Point Reyes Station, California. Thanks for listening! Welcome to another edition of Ocean Currents, I'm your host, Jennifer Stock. On this show I talk with scientists, educators, explorers, policy-makers, ocean enthusiasts, adventurers and more, all uncovering and learning about the mysterious and vital part of our planet: the blue ocean. I bring this show to you monthly on KWMR from NOAA's Cordell Bank National Marine Sanctuary, one of four national marine sanctuaries in California all working to protect unique and biologically diverse ecosystems. Cordell bank is located just offshore of the KWMR listening radius off the Marin-Sonoma coast, and it's thriving with ocean life above and below the surface. The ocean holds so many mysteries to us: the habitats, the life, the mysterious ways it moves and mixes, its temperatures, its ability to absorb carbon dioxide. And as a species-- as humans-- we've made great strides on being able to enter it and see it below the surface with technology aiding greatly. Before scuba was invented we were limited by our breath to explore underwater, and this is how humans first accessed the sea, and today we still access the sea this way. If you've ever held your breath underwater before you have been free diving. -

No Limits Freediving
1 No Limits Freediving "The challenges to the respiratory function of the breath-hold diver' are formidable. One has to marvel at the ability of the human body to cope with stresses that far exceed what normal terrestrial life requires." Claes Lundgren, Director, Center for Research and Education in Special Environments A woman in a deeply relaxed state floats in the water next to a diving buoy. She is clad in a figure-hugging wetsuit, a dive computer strapped to her right wrist, and another to her calf. She wears strange form-hugging silicone goggles that distort her eyes, giving her a strange bug-eyed appearance. A couple of meters away, five support divers tread water near a diving platform, watching her perform an elaborate breathing ritual while she hangs onto a metal tube fitted with two crossbars. A few meters below the buoy, we see that the metal tube is in fact a weighted sled attached to a cable descending into the dark-blue water. Her eyes are still closed as she begins performing a series of final inhalations, breathing faster and faster. Photographers on the media boats snap pictures as she performs her final few deep and long hyperventilations, eliminating carbon dioxide from her body. Then, a thumbs-up to her surface crew, a pinch of the nose clip, one final lungful of air, and the woman closes her eyes, wraps her knees around the bottom bar of the sled, releases a brake device, and disappears gracefully beneath the waves. The harsh sounds of the wind and waves suddenly cease and are replaced by the effervescent bubbling of air being released from the regulators of scuba-divers. -

Diving with the Seahorse
DIVING WITH THE SEAHORSE Omega has achieved a great deal in divers’ watches and was a true pioneer in water-sealed timepieces. The Omega seahorse symbolizing water resistance has even become one of the best known logos. BY JENS KOCH he history of divers’ watches at Omega began not only at an ex - T tremely early point in time but with a timekeeper that was better known for its elegance than its robust construc - tion. This is not surprising, for it was the age of art deco and thus rectangular watches. In 1932, the Omega Marine was already defining revolutionary case making: a double case ensured water re - sistance, while a tensioning lever pushed the inner case against a leather seal. The outer crystal was crafted in scratchproof sapphire, a rarity at the time. The watch was available in rust-free Staybrite steel as well as in gold. A strap crafted in seal leather guaranteed resistance to salt wa - ter, and the folding clasp offered length adjustment. In an extreme temperature test in 1936, three Marine models were placed The Omega Marine, introduced in 1932, with a in water heated to 85° C (185° F) for double case, sapphire crystal, and a strap made of four minutes and then lowered 73 meters saltwater-resistant seal leather HISTORY Omega Seamaster The foundations of a grand line: Seamaster models from 1948, The Seamaster Professional 600 from 1970, nicknamed ProPlof, Those who put their lives on the line need a good watch on their wrists: The Seamaster Professional 100 0m/330 0ft from 1971 with one of them in chronometer version with a monocoque case and security button for the rotating bezel an Omega ad from 1970 for the Seamaster Professional 600 a monocoque case was Omega’s most water-resistant watch. -

Moai Sightings, What's New in Polynesia, What's New in Hangaroa
Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation Volume 14 Article 8 Issue 3 September 2000 Moai Sightings, What's New in Polynesia, What's New in Hangaroa Follow this and additional works at: https://kahualike.manoa.hawaii.edu/rnj Part of the History of the Pacific slI ands Commons, and the Pacific slI ands Languages and Societies Commons Recommended Citation (2000) "Moai Sightings, What's New in Polynesia, What's New in Hangaroa," Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation: Vol. 14 : Iss. 3 , Article 8. Available at: https://kahualike.manoa.hawaii.edu/rnj/vol14/iss3/8 This Commentary or Dialogue is brought to you for free and open access by the University of Hawai`i Press at Kahualike. It has been accepted for inclusion in Rapa Nui Journal: Journal of the Easter Island Foundation by an authorized editor of Kahualike. For more information, please contact [email protected]. et al.: News and Notes Moai ~i9ntin9~ groups seized four tourist resorts on Turtle, Laucala Island, the Buca Bay resort on Vanua Levu, and the Rukuruku resort on THE AMERICAN UNIVERSITY in Washington D.C. held a dedi Ovalau. The Canadian couple who managed the Laucala Island cation ceremony on 7 June to welcome a 9 foot tall moai that resort were beaten and held for 24 hours. was carved by Easter Island artisans for an exhibit at the Telegram Tribune (San Luis Obispo) jar 23 July, 2000 American Museum of Natural History in New York City. Be cause oftheir global orientation and large international student IT APPEARS THAT REBEL ACTIVITY is not the only problem for enrolment, American University is proud to become the home Fiji, A 'hot spot' of weather over those islands has resulted in ofthe moai. -

Espaciosub22.Pdf
editorial Dice un viejo refrán popular que “las cosas de Desgraciadamente, parece que la única vía es palacio van despacio”. Teniendo en cuenta la abierta por el Club Bahía de Vigo, la lenta y que, posiblemente, date de épocas en las que costosa vía de los juzgados, de los abogados, las monarquías españolas eran autoritarias, de las discusiones de despacho. haríamos bien en traducir “palacio” por Hace ya casi un año que se dictó la primera “gobierno”. Y, desde luego, buena razón tiene sentencia a nuestro favor y aún no ha cam- el refranero si consideramos la lentitud con la biado nada. Saben perfectamente cómo que están atendiendo las justas solicitudes del moverse para perder todo el tiempo que nece- colectivo de pescadores submarinos, tan bien siten. Podemos ejercer iniciativas como la de gestionadas por el Club Bahía de Vigo, y que nuestros compañeros vigueses a través de solo piden una regulación más acorde con la contribuciones (n.º de cuenta (escasa) repercusión que tiene su actividad en 00460119140000004162) y dando a conocer el medio ambiente. a los demás que somos muchos y que no nos Parece ser que a los pescasub les ha tocado vamos a estar quietos. pagar la cuenta de un banquete al que no han En esta línea es en la que trabaja ESPACIO sido invitados; sin ni siquiera consultarles, se SUBMARINO; por eso haremos unos polos les han atribuido unas consecuencias en los que se repartirán entre clubes y tiendas para fondeaderos ridículamente desconmensura- que los socios puedan comprarlas al precio de das, mientras que los auténticos devoradores solo quince euros, IMPORTE QUE SE del mar rebañan los fondos de nuestras cos- DESTINARÁ, ÍNTEGRAMENTE, A LA CUEN- tas con total inmunidad, respaldados por los TA DE CONTENCIOSOS DEL CLUB BAHÍA que gestionan nuestros impuestos. -

POP Diving: the Big Blue
POP Diving: The Big Blue BACKGROUND INFO and FACTS In the 60's and 70's, freediving world champions Jaques Mayol and Enzo Maiorca face one another in the blue, beating each other's records. Their performances leave medical experts of those times speechless, and bring freediving to the attention of the general public. It is Mayol, the Frenchman, who finally prevails on the Italian, becoming the first freediver to go beyond 100 meters of depth. And it is precisely around Mayol, considered the father of modern day freediving, that in 1987, movie director Luc Besson creates his first cult-movie, Le Grand Bleu. THE FILM The Blue is so vast and dream-like that it could envelop the collective unconscious of any living being, from man to bacteria. A strong surreal sense permeates the movie, from Mayol's (Jean- Marc Barr) dream to Enzo's mask (Maiorca is played by an outstanding Jean Reno), to the drinking scene in evening attire on the bottom of the pool. In full Besson-style, almost all the characters are caricatural, including Rosanna Arquette, who at times moves like a puppet, as well as the Italians, and the competition judges. At sea, though, things get serious, bodies hyperventilate, go down, come up, dance. They dance with dolphins. It is especially an ethereal Barr-Jaques Mayol who dances; in the movie, as in real life, he was the first to sense the physiological similarities between man and dolphin. Mayol lay the foundations for scientific exploration of the blood-shift phenomenon, and for modern day freediving. -

Indirilen Tayfaları Bir Daha Gö- 26 Şubat 1855'De, James B
BİRİNCİ BÖLÜM Tarama ve Düzenleme: AYHAN [email protected] HAVANIN VE DENİZİN ESRARI BATI ATLANTİKTE, Amerika Birleşik Devletle- rinin kıyılarına yakın, genellikle üçgen biçiminde diye tanımlanan bir yöre vardır. Kuzeyde Bermuda'dan, Florida'nın güney kıyılarına, oradan doğuya, Bahama'lara, Porto Rico'dan öte, 40° boy- lama yakın bir noktaya, daha sonra yine kuzeye, Bermuda'ya birer doğru çizerseniz, bu üçgeni kaba görünümüyle elde etmiş olursunuz. İşte bu alan, dünya kayıtlarına göre insanı en tedirgin eden, an- laşılmaz kaybolma olaylarının rekorunu elinde tut- maktadır. 1945'den bu yana bu bölgede 100'ü aş- kın uçak ve gemi iz bırakmadan yok olmuş, son 26 yıl içinde 1000'den fazla insan kaybedilmiştir. Buna karşılık, denizlerde ne bir ceset, ne de kay- bolan uçak ve gemilerden en küçük bir enkaz par- çası ele geçmiştir. Günümüzde hava ve deniz yoi- larının eskiye oranla çok daha tecrübeli olmasına, daha sık seferler yapmasına, aramaların daha ku- sursuz uygulanıp kayıtların daha dikkatle tutulma- BERMUDA .ŞEYTAN. ÜÇGENİ BERMUDA .ŞEYTAN. ÜÇGENİ köpek gibi, olup bitenleri anlatamayacak bir tek sına rağmen, kaybolma olayları gittikçe sıklaşan bir canlı görülebilmektedir. Yine de, bir seferinde ge- tempoda, hâlâ sürüp gitmektedir. mideki konuşan papağanın tayfalarla birlikte kay- Uçakların çoğu, ya üsleriyle ya da inmek üze- bolduğunu eklemek oldukça ilginçtir. re oldukları alanlarla normal radyo bağlantılarını Bermuda Üçgeni içinde açıklanamayan kay- kaybolma anına kadar sürdümüşlerdir. Bir kısmının bolma olayları bugüne kadar sürüp gitmektedir. Ne ise garip radyo mesajları verdikleri biliniyor. Bu zaman bir gemi ya da uçak yerine varmakta arada aletlerinin çalışmaz olduğunu, pusla göster- gecikse, veya «aramalara son verilmiştir» biçiminde gelerinin fırıl fırıl döndüğünü, güzel bir gün olma- rapor edilse, herkesin en doğal tepkisi, durumu sına rağmen gökyüzünün birden sapsarı kesildiğini hemen eskiden beri olagelen olaylara bağlamaktır. -

The World's Deepest Watch
The world’s deepest watch PRESS INFORMATION The groundbreaking technology behind the record-breaking dive When adventurer Victor Vescovo successfully piloted his submersible Limiting Factor to the bottom of the Mariana Trench in early 2019, the 10,928m dive set a new world record. Along for the ride – and performing perfectly at depth - was OMEGA’s Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional. About Five Deeps The world’s fi rst manned expedition to the deepest point in each of the fi ve oceans is the brainchild of adventurer and submersible pilot Victor Vescovo. Above the surface is the good ship DSSV Pressure Drop, equipped with the highest fi delity full ocean depth sonar. The action at depth takes place in DSV Limiting Factor, a Triton-built submersible commercially certifi ed by the international maritime authority DNV-GL for extensive, repeated dives to extraordinary depths. On the ocean fl oor, gathering important scientifi c data are three “Landers”. OMEGA’s distinguished dive watch legacy Our journey begins in 1932, with the launch of the fi rst divers’ watch made for everyone – the OMEGA “Marine”. The timepiece used by Charles William Beebe, the American explorer who created the ‘bathysphere’, a spherical diving vessel that could transport humans to the depths of the ocean. The “Marine” served Beebe well during his historical 14m dive in the 1930’s. “I wore my OMEGA Marine in the Pacifi c Ocean at a depth of 14 metres, where the pressure is twice the normal one. Its tightness to water and dust and its robustness to corrosion rep- resent a true progress for watchmaking science.” Charles William Beebe In 1948, the first Seamaster is born. -

LA ATLANTIDA.Pdf
La Atlántida, ¿Un mito? ¿Un deseo de creer? ¿Un recuerdo ancestral? ¿Una fábula de Platón? ¿Un enigma geológico? ¿Es la Atlántida algo más que un nombre tan acertado que cualquier experto en marketing daría su sueldo por encontrar uno de similar éxito? El filósofo griego Platón escribió unas obras llamadas Diálogos en las que trataba de explicar su concepción del mundo. Dos misteriosos diálogos fueron los llamados Timeo y Critias. En ellos, en apenas unas líneas, unas veinte páginas de un libro normal, Platón escribió la noticia acerca de un continente gigantesco que había Dibujo de como pudo ser el centro de la Atlántida. Desaparecido en un sólo día y una noche, tragado enterito por el mar océano. Platón citaba como fuente al historiador Solón, quien habría oído en Egipto la historia de la desaparición de una "isla del oeste". Eso ocurrió, según Platón, 9.500 años antes de su época (427-347 a.C.), y la isla tenía una superficie de once mil kilómetros cuadrados, más grande que China. Los atlantes constituyeron una sociedad superdesarrollada pero se alejaron de su dios y sobrevino el castigo divino, haciéndolos desaparecer para siempre. Al parecer Platón iba a escribir las razones de Zeus o su homólogo dios de los atlantes para condenarlos así, pero la muerte no le dejó terminar esa parte de sus Diálogos. Foto del centro de la ciudad de la Atlántida, como pudo ser en maqueta. El continente de la Atlántida estaba, como su nombre indica, en el océano Atlántico, entre la costa oeste del sur de Europa, y la del este de América. -

Mmubn000001 026828294.Pdf
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/148026 Please be advised that this information was generated on 2021-10-08 and may be subject to change. Ié>63 Bij^iit.:.., * й :. • THE INNER EAR AND HYPERBARIC CONDITIONS an electrophysiological and morphological study P. С LEVENDAG THE INNER EAR AND HYPERBARIC CONDITIONS an electrophysiological and morphological study Promotores: Prof. Dr. P. van den Broek Prof. Dr. J. J. Eggermont Co-referent: Dr. W. Kuijpers THE INNER EAR AND HYPERBARIC CONDITIONS an electrophysiological and morphological study PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR IN DE GENEESKUNDE AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT 1 E NIJMEGEN, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS PROF DR Ρ G А В WIJDEVELD VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE VAN DECANEN IN HET OPENBAAR ГЕ VERDEDIGEN OP DONDERDAG 21 MEI 1981 DES NAMIDDAGS TE 2 00 UUR PRECIES door PETER CAREL LEVENDAG geboren te Bandoeng krips repro meppel 1981 ACKNOWLEDGEMENTS Although I am not allowed to acknowledge some of the closest co-workers who advised tirelessly throughout this experimental study in the prepa ration of the manuscript, I am greatly indebted to many others, of whom I would very much like to mention Ing. H. Huibers because of his skilful technical assistance and Dr. P.L.M. Huygen for the data analysis and statistical work up. Also I would like to express my gratitude to Mr. J. Konings for the many fine illustrations. -

El Triángulo De Las Bermudas Charles Berlitz
El Triángulo de las Bermudas Charles Berlitz Edición Original 1970 Editorial EMECE Primera Edición en México 1990 ISBN: 968-7152-54-0 El Triángulo de las Bermudas: Un misterio del aire y el mar............................................. 3 El Triángulo de los aviones desaparecidos ....................................................................... 10 El "Mar de los Barcos Perdidos" ...................................................................................... 28 Los que escaparon............................................................................................................. 43 ¿Existe una explicación lógica?........................................................................................ 52 Trastornos del tiempo y el espacio. Otros mundos........................................................... 62 Una sugerencia del pasado del Océano............................................................................. 82 Sorpresas de la Prehistoria................................................................................................ 96 Agradecimientos ............................................................................................................. 129 Bibliografía ..................................................................................................................... 131 CAPÍTULO 1 El Triángulo de las Bermudas: Un misterio del aire y el mar FRENTE A LA COSTA SUDESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, en el Atlántico Occidental, existe una zona que forma lo que se ha denominado un triángulo. -
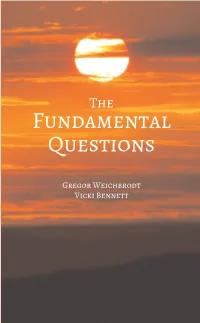
Fundamental Questions of Life
Who am I? Where do I come from? What is my purpose in Life and what happens when I die? For centuries people have tried to come up with answers regarding the fundamental questions of life. Then the internet was invented and these questions have finally been answered – by users. the book The Fundamental Questions captures them in an inspiring record of epic proportions where The every individual verse becomes a mantra of a mind- The Fundamental Questions expanding collective thought. It reminds us, that Fundamental one single answer is never the answer. Questions Gregor Weichbrodt Vicki Bennett Gregor Weichbrodt · Vicki Bennett ISBN 978-1-291-93212-6 90000 9 781291 932126 I am the gambling of the fraudulent; I am the splendour of the splen- did; I am victory; I am determination; I am the goodness of the good. I am a huge animal lover and love to spend time with my chinchilla and 2 pet rats. — Bhagavad Gita Copyright © 2014 Gregor Weichbrodt · Vicki Bennett www.ggor.de · www.peoplelikeus.org ISBN: 978-1-291-93212-6 CoNteNtS Who am I? 7 Where do I come from? 470 What is my purpose in Life? 499 What happens when I die? 563 Contents 5 WHO AM I? I am a Account Rep · I am a active guy who loves sports, mov- ies, cooking, and anything that sounds new and exciting · I am a actor in acting school · I am a dad to two girls Bug 5, and tooties 1.5 who are my life · I am a administrator for my dad and also volunteer in the Age UK office two days a week · i am a adventurious person · I am a adventurous, outdoors, hands on fix it all type person · I am