Bonner Jahrbücher
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Bullard Eva 2013 MA.Pdf
Marcomannia in the making. by Eva Bullard BA, University of Victoria, 2008 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS in the Department of Greek and Roman Studies Eva Bullard 2013 University of Victoria All rights reserved. This thesis may not be reproduced in whole or in part, by photocopy or other means, without the permission of the author. ii Supervisory Committee Marcomannia in the making by Eva Bullard BA, University of Victoria, 2008 Supervisory Committee Dr. John P. Oleson, Department of Greek and Roman Studies Supervisor Dr. Gregory D. Rowe, Department of Greek and Roman Studies Departmental Member iii Abstract Supervisory Committee John P. Oleson, Department of Greek and Roman Studies Supervisor Dr. Gregory D. Rowe, Department of Greek and Roman Studies Departmental Member During the last stages of the Marcommani Wars in the late second century A.D., Roman literary sources recorded that the Roman emperor Marcus Aurelius was planning to annex the Germanic territory of the Marcomannic and Quadic tribes. This work will propose that Marcus Aurelius was going to create a province called Marcomannia. The thesis will be supported by archaeological data originating from excavations in the Roman installation at Mušov, Moravia, Czech Republic. The investigation will examine the history of the non-Roman region beyond the northern Danubian frontier, the character of Roman occupation and creation of other Roman provinces on the Danube, and consult primary sources and modern research on the topic of Roman expansion and empire building during the principate. iv Table of Contents Supervisory Committee ..................................................................................................... -

Manica Experimental Trials).Pub
The ‘Abdasian’ Manica Abdas The find shown opposite has been dated to the earlier half of the 21 st Century AD. It was originally excavated from a cardboard box filled with a strange assortment of oddly shaped pink and white flakes of an unknown fragile material. The find was a little too cold and sharp to the touch in its original form, so any sharp edges were rounded and filed. The manica was then lined with skin from my favourite pet Baatavian sheep which was sewn to the riveted leather straps that hold the manica together. A very thick thread was used with a darning needle in a fairly loose stitch to allow some room for movement. In terms of attaching the manica to an arm, it was The ‘Abdasian’ Manica . decided against threading leather thongs through the holes that run the length of the manica , as such thongs break too easily and rethreading it continually is a highly unwelcome prospect! Rather what was needed was some- thing that could be easily put on and removed unaided. To that end, two leather straps and their associated “D” rings were fixed at the wrist and below the elbow, with the buckle on the upper edge. The two “D” ring straps can provide a tight fit when the strap is passed twice through the ring (see above). The buckle provides a very secure fit around the upper arm. After wearing manica #1 for a while it soon discovered that it had a tendency to slip down. To secure the manica to the upper arm the inside was lined with leather through which was run a thong. -
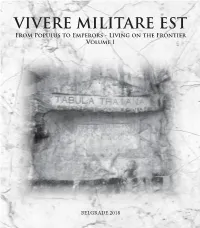
VIVERE MILITARE EST from Populus to Emperors - Living on the Frontier Volume I
VIVERE MILITARE EST From Populus to Emperors - Living on the Frontier Volume I BELGRADE 2018 VIVERE MILITARE EST From Populus to Emperors - Living on the Frontier INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY MONOGRAPHIES No. 68/1 VIVERE MILITARE EST From Populus to Emperors - Living on the Frontier VOM LU E I Belgrade 2018 PUBLISHER PROOFREADING Institute of Archaeology Dave Calcutt Kneza Mihaila 35/IV Ranko Bugarski 11000 Belgrade Jelena Vitezović http://www.ai.ac.rs Tamara Rodwell-Jovanović [email protected] Rajka Marinković Tel. +381 11 2637-191 GRAPHIC DESIGN MONOGRAPHIES 68/1 Nemanja Mrđić EDITOR IN CHIEF PRINTED BY Miomir Korać DigitalArt Beograd Institute of Archaeology, Belgrade PRINTED IN EDITORS 500 copies Snežana Golubović Institute of Archaeology, Belgrade COVER PAGE Nemanja Mrđić Tabula Traiana, Iron Gate Institute of Archaeology, Belgrade REVIEWERS EDITORiaL BOARD Diliana Angelova, Departments of History of Art Bojan Ðurić, University of Ljubljana, Faculty and History Berkeley University, Berkeley; Vesna of Arts, Ljubljana; Cristian Gazdac, Faculty of Dimitrijević, Faculty of Philosophy, University History and Philosophy University of Cluj-Napoca of Belgrade, Belgrade; Erik Hrnčiarik, Faculty of and Visiting Fellow at the University of Oxford; Philosophy and Arts, Trnava University, Trnava; Gordana Jeremić, Institute of Archaeology, Belgrade; Kristina Jelinčić Vučković, Institute of Archaeology, Miomir Korać, Institute of Archaeology, Belgrade; Zagreb; Mario Novak, Institute for Anthropological Ioan Piso, Faculty of History and Philosophy Research, -

Andabatae Horseback Fighters; from the Greek “Αναβάται” (Ascensores) Because They Fought on Horseback
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lingua Latina I ∙ Culture / History ∙ Gladiatorial Types < http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Roman_gladiator_types > --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Andabatae Horseback fighters; from the Greek “αναβάται” (ascensores) because they fought on horseback. They wore mail like eastern cavalry (Cataphracti) and wore visored helmets without eye holes. They charged at one another on horseback similar to a medieval joust but without being able to see each other. Arbelas Crescent Knife Fighter; likely a renaming of the Scissor, the Arbelas was armed with a dagger in his right hand, and wore a Secutor-type helmet, chain or scale covering his torso to the knees, a quilted manica on the right arm and a tubular vambrace with a cresent-shaped blade (similar to that used by shoemakers, and where the name Arbelas comes from) on the end on his left arm. From surviving artwork it seems he only fought his own kind, or the Retiarius. Bestiarii Animal fighters; men specializing in fighting various types of exotic, imported beasts with spears. The fights were arranged in such a way that there was small chance the animals would win. On occasion condemned criminals also fought animals in the arena, but under less favored conditions. Bestiarii were technically not considered gladiators as they did not fight other men. Bustuarii Funeral fighters; these fought in honour of a deceased person as part of his funeral rites. Dimachaerii Double sworded fighters; from the Greek "διμάχαιρος" (bearing two knives). Used two swords, one in each hand. Equites Horsemen; in early depictions, these lightly-armed gladiators wear scale armour, a medium-sized round cavalry shield (parma equestris), and a brimmed helmet without a crest, but with two decorative feathers. -

1 What Do Depictions of Gladiators on Gaulish Samian Tell Us About How Gladiatorial Combats Were Staged in the Roman Arenas?
What do depictions of gladiators on Gaulish samian tell us about how gladiatorial combats were staged in the Roman arenas? Timothy Edward Jones [email protected] (MPhil Humanities, University of South Wales; MA in Classical Studies Open; MA Historic Landscape Studies, Wales; MA Scientific Methods on Archaeology, Bradford; BSc Science, Open; BSc Geological Oceanography, Wales; BA Archaeology, Wales) Submitted in part fulfilment for the degree of MA in Classical Studies, Open University September 2015 1 ABSTRACT This work is a revised version of a thesis for the Open University’s MA in Classical Studies presented originally in September 2015. It undertakes a detailed analysis of a small sample of the gladiatorial images published by Oswald (1936-37) and uses them to present a new model of how the Ludus was staged. This is done by comparing the figures selected by Demarolle (2002) with those depicted in Medieval and Renaissance fencing manuals in order to show how the potters illustrated valid representations of real, effective techniques. The methodology used is heavily dependent on my own experience of martial arts- this spans over 40 years and is something that I have successfully used to interpret ancient and medieval images of combat for conference papers in the fields of archaeology and history every year since 2007, although only two have so far been published in hard copy (Jones, 2009; 2012) other material is available through Research Gate. This work has three main chapters. In the first I subject the figures themselves to a detailed analysis of their stances in which the Roman artistic depictions are compared with depictions from later time periods that are known to have been used to teach sword and shield fencing and also with practical experience acquired through over 40 years of martial arts training. -

Origins of Roman Infantry Equpiment: Innovation and Celtic Influence
ORIGINS OF ROMAN INFANTRY EQUPIMENT: INNOVATION AND CELTIC INFLUENCE Ian A. Martin Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF NORTH TEXAS December 201 9 APPROVED: Christopher J. Fuhrmann, Major Professor Walter Roberts, Co-Major Professor Guy Chet, Committee Member D. Keith Mitchener, Committee Member Reid Ferring, Committee Member Jennifer Jensen Wallach, Chair of the Department of History Tamara L. Brown, Executive Dean of the College of Liberal Arts and Social Sciences Victor Prybutok, Dean of the Toulouse Graduate School Martin, Ian A. Origins of Roman Infantry Equpiment: Innovation and Celtic Influence. Doctor of Philosophy (History), December 2019, 276 pp., 1 table, 35 figures, 1 appendix, bibliography, 23 ancient sources, 176 secondary sources. The Romans were known for taking technology and advancements from other peoples they encountered and making them their own. This pattern holds true in military affairs; indeed, little of the Roman military was indigenously developed. This dissertation looks at the origins of the Roman’s mainline weapons systems from the beginning of Roman Republic expansion in the fourth century BC to the abandonment of Western-style armaments in favor of Eastern style ones beginning in the late-third century AD. This dissertation determines that the Romans during that time relied predominately on the Celtic peoples of Europe for the majority of their military equipment. One arrives at this conclusion by examining at the origins of the major weapons groups: armor, shields, spears, swords, and missile weapons. This determination is based on the use of ancient written sources, artistic sources, and archaeological sources. It also uses the large body of modern scholarship on the individual weapons. -
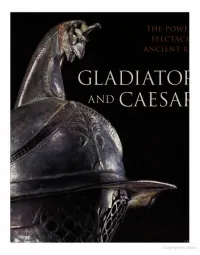
Gladiators and Caesars : the Power of Spectacle in Ancient Rome
THE I'OWE SPECTACL ANCIENT R GLADIATO Ij andCAESA I Copyrighted material GLADIATORS and CAESARS ThU on* III naterial THE POWER O SPECTACLE It ANCIENT ROM GLADIATORS and CAESARS EDITED E ECKART KOHNE AN CORNELIA EWIGLEBE ENGLISH VERSION EDITED E RALPH JACKSO UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRE* Berkeley Los Angeli Copyrighted material IkkiI, i Ihn i\ puoliuVd In ,i< nm ( Miry jn inhibition hrld .11 thr Lenders lo the British Museum Exhibition Rnlidi Mniouni (mm 11 ncmhi-r lo I ) Umwry iOOl Antikensammlung, Slaallirhe Muwen /u Berlin tin- inhibition i» ImkxI on m i-i* dwlKWd li> Ihe MuMiini (in Kuml < I l.intlKirn show n .It I t.imlxirt; Irnni 1 1 Frbnurv Und it—lfat, Md Ashmolean Museum, Oxford in 1H |iinr .'IHKI.irxl.n ihi- Hi<4»risc hrs hSwum nW lt.il/. S|n>w British Milium. London: Departments ot Greek and Rom.in Antiquities. Irum <l Mv to I ( h IflOM 2000. Prehistoric and Romano-British Antiquities. Coins and Medals, and Medieval and Later Antiquities ItiMvmilv ill ( .ilifcxnu Pm* jimI to- Anwlf.. ( jMihiiij BrnVirv Fitzwilliam Museum. Cambridge Historisth.es Museum der Phiz. Silver Kunsthislorist hes Museum Wien, Antikensammlung O .'(UK! Muwum lui KunM unil < irnrrtx-, I l.initmii! I iiHiivh itiiiwm .ind uamiHom Landesmuseum Mainz 40 200O I he Holi>h Mlivoutn C iHHOAnv I Mnnumenti Musei e Gallerie PontHide, Citta del Vatitano I >m puMnhrd .'Him Musee Art heologtque. Vaisoti-La-Romaine Musee de I Aries Antique fcimliiwl Irani ihr Gamin h> AMhea M in J«« ulH.ii wi* I ->l I Hilton Tr.miUiom lid, Cambridge, UK Musee du Louvre. -

TWO ROMAN SOLDIERS in ISTANBUL Praetorian Guardsmen Or Centurions?
TWO ROMAN SOLDIERS IN ISTANBUL Praetorian Guardsmen or Centurions? Julian BENNETT* Abstract A relief panel exhibited in the National Archaeology Museum, Istanbul, shows two Roman soldiers in their ‘field-service kit’. The relief belonged originally to a monument built in AD 108/109 near what is now the village of Adamclisi in Romania in connection with the conclusion of the Emperor Trajan’s Second Dacian War. The monument had been furnished with 54 figured panels or metopes, the 49 surviving examples all with scenes relating to the Roman army at the time of Trajan and of considerable importance in Roman military studies in particular and in the field of Roman provincial ‘classical’ art in general. The panel in Istanbul demands greater attention as it appears to be a rare depiction of either Praetorian Guardsmen or Centurions in their ‘field-service kit’. INTRODUCTION The Archaeological Museum in Istanbul is famed internationally for its classical-period sculpture, as with the ‘Alexander Sarcophagus’ and the companion ‘Sarcophagus of the Mourning Women’. One particular piece displayed there, however, rarely gets the atten- tion it deserves, namely a Trajanic-period relief sculpture of two soldiers in a naïve pro- vincial style which originated from one of the Roman Empire’s major architectural mon- uments and so featured in almost all text-books on Roman sculpture.1 Its importance lies especially in how it provides inter alia a realistic view of the Roman soldier wearing his actual battle panoply and his off-duty dress quite different from the ‘classic’ view of this as exemplified by the contemporary Trajan’s Column in Rome. -
East Meets West: Mounted Encounters in Early and High Mediaeval Europe
Acta Periodica Duellatorum, Scholarly section, articles 75 DOI 10.1515/apd-2017-0003 East meets West: Mounted Encounters in Early and High Mediaeval Europe Jürg Gassmann Artes Certaminis and Schweizer Rossfechten-Verein [email protected] Abstract – By the Late Middle Ages, mounted troops – cavalry in the form of knights – are established as the dominant battlefield arm in North-Western Europe. This paper considers the development of cavalry after the Germanic Barbarian Successor Kingdoms such as the Visigoths in Spain or the Carolingian Franks emerged from Roman Late Antiquity and their encounters with Islam, as with the Moors in Iberia or the Saracens (Arabs and Turks) during the Crusades, since an important part of literature ascribes advances in European horse breeding and horsemanship to Arab influence. Special attention is paid to information about horse types or breeds, conformation, tactics – fighting with lance and bow – and training. Genetic studies and the archaeological record are incorporated to test the literary tradition. Keywords – Knights, cavalry, Moors, Crusades, Saracens, Islam, Byzantium, Visigoths, Normans, Arabs, Iberia, horses I. INTRODUCTION – HORSE DOMESTICATION, USE AND TERMINOLOGY I.1. Introduction The Germanic kingdoms that established themselves in the Roman Empire of the West in the 5th C did not exist in a vacuum, they interacted with outside powers. Initially defensively, as Muslim forces first overran North Africa and then – in Iberia and Gaul – encroached on the European kingdoms as well; and further during the Crusades, as Europe transitioned from the defensive to the strategic counter-offensive. The equine side of these encounters has received little attention, and where it has, statements are often made and conclusions drawn which at the very least require testing against the archaeological and literary record. -

Un Protector Laminado De Brazo (Manica) Procedente Del Campamento De La Legio Vii Gemina En León1
Archivo Español de Arqueología 2008, 81, págs. 255-264 ISSN: 0066 6742 UN PROTECTOR LAMINADO DE BRAZO (MANICA) PROCEDENTE DEL CAMPAMENTO DE LA LEGIO VII GEMINA EN LEÓN1 POR JOAQUÍN AURRECOECHEA Universidad de Málaga CARMELO FERNÁNDEZ IBÁÑEZ Museo de Palencia VICTORINO GARCÍA MARCOS Ayuntamiento de León ÁNGEL MORILLO Universidad Complutense de Madrid RESUMEN PALABRAS CLAVE: León. Campamento romano. Legio VII gemina. Almacén en torno a patio. Armadura romana. Las excavaciones arqueológicas desarrolladas durante 1998 Protector laminado de brazo. Manica. en un solar de la calle Santa Marina, inmediato a la cara in- terna de la muralla bajoimperial de León, revelaron un gran KEY WORDS: Leon. Roman legionary fortress. Legio VII edificio perteneciente al campamento de la legio VII gemina, gemina. Magazine with a central courtyard. Roman ar- que ha sido identificado como un almacén con patio central, mour. Laminated arm protector. Manica. levantado a finales del siglo I d. C. En el interior de una de las estancias se encontró un fragmento de manica o protec- tor laminado de brazo. Este elemento está constituido por 11 láminas imbricadas Las excavaciones desarrolladas por A. García y de distinto tamaño, cuatro trapezoidales y siete rectangulares Bellido en diversos puntos de la ciudad de León de mayor tamaño. Se conservan algunos restos de lo que pudiera constituyeron un esfuerzo notable para el conocimien- ser cuero. Este conjunto se encuentra deformado por aplasta- miento. El protector fue abandonado hacia el último cuarto del to del asentamiento romano a orillas del Bernesga siglo III d. C. en una estancia destinada posiblemente a almace- que, desgraciadamente, no tuvo continuidad hasta namiento y quedó aplastado por el derrumbe del techo del edi- muchos años más tarde (García y Bellido 1970). -

Vegetius on Armour: the Pedites Nudati of the Epitoma Rei Militaris*
VEGETIUS ON ARMOUR: THE PEDITES NUDATI OF THE EPITOMA REI MILITARIS* The date of Vegetius’ Epitoma Rei Militaris has been oft debated. Although obviously written between the years 383 and 450, various impe- rial contenders have been suggested, with the most popular being Theo- dosius I, emperor of the eastern Empire from 379-395 and sole ruler of the Roman world after the usurper Eugenius’ defeat in 3941. Still, others have suggested a later date, perhaps one under Valentinian III, who ruled the western Empire between the years 425-455, a contention which deserves serious consideration. The present discussion will confine itself to only one aspect of this problem. One of the most intriguing statements to be found in the Epitoma is that the infantry of Vegetius’ time no longer wore armour (Epit. I 20.2-5). As will be seen, the epitomator’s assertion does not seem to tally with views that the text was written during the reign of Theodosius the Great. Much ink has been spilt on the value of * Journal sigla are those of L’Année philologique. Other abbreviations are as per OCD3. In addition: BAR = British Archaeological Reports (Oxford); BHAC = Bonner Historia- Augusta-Colloquium (Bonn); DRB = De Rebus Bellicis; HGM = L. DINDORF (ed.), His- torici Graeci Minores, 2 vols, Leipzig 1870-1871; L&S = C.T. LEWIS & C. SHORT, A Latin Dictionary, Oxford 1879; OLD = P. GLARE (ed.), Oxford Latin Dictionary, Oxford 1986. All dates in this article are AD. 1 The most notable partisans of a Theodosian date include S. MAZZARINO, Trattato di storia romana II, Rome 1956, p. -

The Progression of Arms and Armor from Ancient Greece to the European Renaissance Across Eurasia and Africa
The Progression of Arms and Armor from Ancient Greece to the European Renaissance across Eurasia and Africa Featuring: The Power to Pierce Armor An Interactive Qualifying Proposal Submitted to the Faculty of the WORCESTER POLYTECHNIC INSTITUTE In partial fulfillment of the requirements for graduation By ______________________________ ________________________________ Jacquelin A. Blair Fernando Martell ______________________________ March 4, 2011 Nicholas Roumas _______________________________ Professor Jeffrey L. Forgeng, Major Advisor 2 ABSTRACT_______________________________________________________ Gunpowder revolutionized not only the medieval battlefield, but the face of Western society, dethroning the knight from his battlefield dominance and helping to usher in modern governmental forms. This project for the Higgins Armory Museum documented the social history of the museum’s arms collection, synthesizing the research into a 15-minute video documentary on the rise of firearms and the decline of armor, c. 1300-1800. The documentary features animations and reenacted footage specifically created for the production. 3 Table of Contents Introduction . .6 – 11 Figures. 12 – 14 The Ancient World . .15 – 29 Ancient Greece – Corinthian Helmet . 15 – 21 Early Roman Republic – Montefortino Helmet . 22 – 26 Roman Empire – Gladiator Helmet . 27 – 29 European Middle Ages and Renaissance . 30 – 51 European Middle Ages – Knightly Weapons. .30 –36 European Renaissance – Pike man Weaponry. .37 – 39 European Renaissance – Rapiers and Short Swords . .40 – 42 European Renaissance –¾ Cuirassier. 43 – 46 European Renaissance – Firearms. .46 – 51 Western Asia & Africa . .52 –58 Turkey – Ottoman Turkish Panoply . .52 – 54 Africa – Sudanic Panoply . .55 – 58 Eastern Asia . 59 – 67 Japanese Armor . .59 – 61 Mughul India . .65 – 67 Appendix A. Team Biographies. 68 Jacquelin A. Blair . 68 Fernando Martell . .68 Nicholas Roumas .