Zeithaus-Automobile Klassiker Fiat Topolino
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
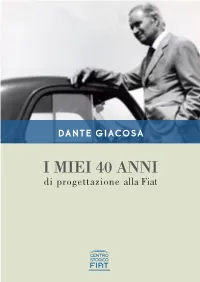
I MIEI 40 ANNI Di Progettazione Alla Fiat I Miei 40 Anni Di Progettazione Alla Fiat DANTE GIACOSA
DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat I miei 40 anni di progettazione alla Fiat DANTE GIACOSA I MIEI 40 ANNI di progettazione alla Fiat Editing e apparati a cura di: Angelo Tito Anselmi Progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino Due precedenti edizioni di questo volume, I miei 40 anni di progettazione alla Fiat e Progetti alla Fiat prima del computer, sono state pubblicate da Automobilia rispettivamente nel 1979 e nel 1988. Per volere della signora Mariella Zanon di Valgiurata, figlia di Dante Giacosa, questa pubblicazione ricalca fedelmente la prima edizione del 1979, anche per quanto riguarda le biografie dei protagonisti di questa storia (in cui l’unico aggiornamento è quello fornito tra parentesi quadre con la data della scomparsa laddove avve- nuta dopo il 1979). © Mariella Giacosa Zanon di Valgiurata, 1979 Ristampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. … ”Noi siamo ciò di cui ci inebriamo” dice Jerry Rubin in Do it! “In ogni caso nulla ci fa più felici che parlare di noi stessi, in bene o in male. La nostra esperienza, la nostra memoria è divenuta fonte di estasi. Ed eccomi qua, io pure” Saul Bellow, Gerusalemme andata e ritorno Desidero esprimere la mia gratitudine alle persone che mi hanno incoraggiato a scrivere questo libro della mia vita di lavoro e a quelle che con il loro aiuto ne hanno reso possibile la pubblicazione. Per la sua previdente iniziativa di prender nota di incontri e fatti significativi e conservare documenti, Wanda Vigliano Mundula che mi fu vicina come segretaria dal 1946 al 1975. -

2015 FIAT 500 Blue & Me Hands Free Communication Radio Book
2015 BLUE&ME™ 13BBM-726-AA15FBM-526-AC BLUE&ME™ Third Edition Owner’s Manual Supplement 2015 BLUE&ME™ Hands-Free Communication Owner’s Manual Supplement SECTION TABLE OF CONTENTS PAGE 1 OVERVIEW ..................................................................3 1 2 DISPLAY AND BUTTONS ON THE STEERING WHEEL ..............................11 2 3 BLUE&ME™ HANDS-FREE COMMUNICATION PACKAGE QUICK REFERENCE GUIDE ....17 3 4 HOW TO USE BLUE&ME™ HANDS-FREE COMMUNICATION ........................25 4 5 BLUE&ME™ HANDS-FREE COMMUNICATION FUNCTIONS .........................45 5 6 BLUE&ME™ HANDS-FREE COMMUNICATION SUPPORTED MOBILE DEVICES .........85 6 7 PERSONAL DATA PROTECTION ................................................91 7 8 SYSTEM SOFTWARE USE NOTICE ..............................................93 8 9 TROUBLESHOOTING ........................................................101 9 10 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS .............................................119 10 OVERVIEW 1 CONTENTS Ⅵ OVERVIEW.............................4 ▫ Media Player ..........................9 ▫ The BLUE&ME™ Hands-Free Communication ▫ Road Safety ..........................10 Package ..............................5 ▫ Message Reader ........................7 4 OVERVIEW OVERVIEW you to use your Bluetooth® wireless technology enabled Read and Follow Instructions: Before using your system, mobile device without having to take your eyes off the read and follow all instructions and safety information road. You can even keep your phone in a pocket or a bag. provided in this end user -

The Fiat Panda Range
THE FIAT PANDA THE FIAT PANDA THE CONTACT HOME 1.2 69HP RANGE 1.0 70HP HYBRID RANGE FIAT RANGE FIAT Use the menu bar above to navigate through the guide. Click ESC to exit THE FIAT PANDA RANGE Products offered for sale may differ from those described or illustrated in this brochure due to later production changes in specifications, components or place of manufacture. The contents of this brochure are therefore to be treated as a representation of current product availability or as to products actually offered for sale. Fiat UK, a trading name of Fiat Chrysler Automobiles UK Ltd, reserves the right to make changes at any time, without notice, to prices, colours, materials, equipment, specification and models and also to discontinue models. All details correct at date of publication, September 2020. Vehicle comparison data source: manufacturer information. For further information, please visit the Fiat Chrysler Auto Fleet Hub at www.fcafleethub.co.uk THE FIAT PANDA THE FIAT PANDA THE CONTACT HOME 1.2 69HP RANGE 1.0 70HP HYBRID RANGE FIAT RANGE FIAT INTRODUCTION POP/EASY/LOUNGE CITY CROSS CITY CROSS TRUSSARDI 4x4 CROSS 4x4 Use the menu bar above to navigate through the guide. Click ESC to exit THE FIAT PANDA The Fiat Panda blends compact style with innovation in a car that is just Fiat brand and precede the launch of the all-new 100% electric Fiat 500, For those wanting even more presence, the Panda Cross 4x4 adds the 3.7 metres long. And with a model range for every need, you can be sure scheduled for launch in early 2021. -

Design with Va-Va-Vroom Ron Arad's Pressed Flowers Exhibition Perfectly Embodies the Extraordinary Power and Emotional Impact of Car Design
Roddy Giacosa 2013 Design with va-va-vroom Ron Arad's Pressed Flowers exhibition perfectly embodies the extraordinary power and emotional impact of car design BY HENRIETTA THOMPSON DECEMBER 12, 2013 09:00 Over the past week or so, I’ve been struck repeatedly by the fact that cars have an extraordinary power to move people. It’s the emotional impact of a car that I’m talking about, not its physical one. A car with a strong enough brand, and a clever enough designer behind the wheel, can take a person to places that horsepower alone can never reach. Thompson, Henrietta. “Design with va-va-vroom”, Telegraph. December 12, 2013. In the beginning, there was the Aston Martin. We borrowed a Vanquish Volante in bright racing red for the weekend and were astounded as we were transformed Cinderella-style from our scruffpot selves into a sleek, sexy couple in sports mode. It sounded like a tiger, drove like a dream, and everyone we passed stopped and stared as we swooshed past. It was at once embarrassing and fabulous, a feeling that can be yours for just £200,000. The Vanquish experience made me think about design and how the feeling of a car can be extended, or not, into other products. “I want an Aston Martin office chair,” my boyfriend said at one point, a little overexcited. Also the Aston Martin desk, sofa, jacket, the coffee pot, the works. But did we really? Aston Martin doesn’t make office chairs, and hopefully it won’t ever feel the need. -
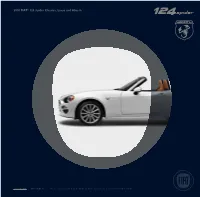
Page A1 Page A2 to MINGLE with the HIGHWAY’S MOST IRREVERENT PLAYER
2018 FIAT® 124 Spider Classica, Lusso and Abarth FIATUSA.COM 888-CIAO-FIAT FIAT is a registered trademark of FCA Group Marketing S.p.A., used under license by FCA US LLC. Page A1 THE TRUE SPORTS CAR IS BACK. THE FIAT® 124 SPIDER FOR 2018 TAKES ITS CUES FROM THE ORIGINAL 124 SPIDER, THE 1967 EUROPEAN CAR OF THE YEAR. ITS EXCEPTIONAL AGILITY AND SIGNATURE ROOMINESS WON OVER DRIVERS DECADES AGO. NOW, A WHOLE NEW GENERATION WILL ASPIRE TO MINGLE WITH THE HIGHWAY’S MOST IRREVERENT PLAYER. LET THE ADVENTURE BEGIN. 02 124 Spider Lusso shown in Nero Cinema. 03 Page A2 Page A3 Classic beauty and driving pleasure A car that believes you can never The authentic roadster born with in its purest form. be too comfortable. a competitive streak. • 1.4L MultiAir® Turbo 160 hp • 1.4L MultiAir Turbo I60 hp • 1.4L MultiAir® Turbo 164 hp with 6-speed manual transmission with 6-speed manual transmission with 6-speed manual transmission • 16-inch Silver aluminum wheels • 17-inch premium Silver aluminum wheels • 17-inch Gun Metallic aluminum wheels • AM/FM Bluetooth® radio • AM/FM radio with Bluetooth • 6-speed AISIN® automatic transmission with 3-inch display and four speakers and 7-inch display with steering wheel-mounted paddle • Bifunctional projector halogen headlamps • Automatic Temperature Control (ATC) shifters — Optional • Body-color A-pillar header, side sill • Bifunctional projector halogen • Available Hand-Painted Heritage Racing and door handles headlamps with automatic feature Stripe by Mopar® • Body-color power exterior mirrors • Dual bright-tip -

FIAT Brings Back 500 1957 Edition
Contact: Jordan Wasylyk Bryan Zvibleman FIAT Brings Back 500 1957 Edition Back by popular demand, the Fiat 500 1957 Edition celebrates iconic Italian style and fun-to-drive dynamics inspired by the original 1957 Fiat Nuova 500 1957 Edition available in hatchback and carbrio configurations with 1.4-liter MultiAir Turbo engine, which is now standard across the entire Fiat 500 lineup and delivers 135 horsepower and 150 lb.-ft. of torque Based on Lounge model, which starts at a U.S. manufacturer’s suggested retail price (MSRP) of $19,745, the 1957 Edition package for the Fiat 500 is available for $995 The 500 1957 Edition includes: Three new 16-inch retro-inspired wheel options (White, Green or Blue) Exterior highlights with vintage elements, such as retro fascia with bright inserts and retro FIAT badging, retro Ivory door-trim panels, White exterior mirrors, two-toned paint with White roof on hatchback models and Black soft top on cabrio models Three retro-inspired paint colors: Celeste Blue (Retro Light Blue), Chiaro (Light Green) and Bianco Ice (White) Elegant interior features with Italian style: Ivory door-trim panels and Marrone leather shift boot, Avorio/Marrone leather-wrapped steering wheel and retro "FIAT" badge Fiat 500 is available in three models: Pop, Lounge and the high-performance Abarth Fiat 500 starts at $16,245 MSRP – the most affordable turbocharged vehicle in the United States New Fiat 500 1957 Edition arrives in FIAT studios this fall September 26, 2018, Auburn Hills, Mich. - Celebrating its legendary past, the FIAT brand announced today the new Fiat 500 1957 Edition in both hatchback and cabrio configurations – last available for the 2016 model year. -

Fiat 500 Abarth SPECIFICATIONS Dimensions Are in Inches (Millimeters) Unless Otherwise Noted
FIAT 500ABARTH Specifications New 2012 Fiat 500 Abarth SPECIFICATIONS Dimensions are in inches (millimeters) unless otherwise noted. GENERAL INFORMATION Body Style A-segment hatchback EPA Vehicle Class Minicompact Assembly Plant Toluca, Mexico Introduction Date First half of 2012 as a 2012 model ENGINE: 1.4-LITER SOHC 16-VALVE TURBOCHARGED MULTIAIR® INLINE FOUR-CYLINDER Availability Standard — Fiat 500 Abarth Type and Description Inline four-cylinder, liquid-cooled, turbocharged Displacement 83.48 cu. in. (1368 cu. cm) Bore x Stroke 2.83 x 3.31 in. (72.0 x 84.0 mm) Valve System Belt-driven, MultiAir®, SOHC,16 valves, hydraulic end-pivot roller rockers Fuel Injection Sequential, multi-port, electronic, returnless Construction Cast-iron block with aluminum-alloy head and aluminum-alloy bedplate Compression Ratio 9.8:1 Maximum Turbo Boost (psi / bar) 18 psi / 1.24 bar Power (SAE) 160 bhp (119 kW) @ 5,500 rpm (117 bhp/L) Torque (SAE) 170 lb.-ft. (230 N•m) @ 2,500-4,000 rpm Max. Engine Speed 6,500 rpm (electronically limited) Fuel Requirement 87 octane (R+M)/2 acceptable 91 octane recommended Oil Capacity 4.0 qt. (3.8L) with dry filter Coolant Capacity 4.6 qt. (14.4L) Emission Controls Dual three-way catalytic converters, heated oxygen sensors and internal engine features(a) Max. Gross Trailer Weight Not rated for trailer tow Estimated EPA Fuel Economy mpg 28 / 34 / 31 (City/Highway/Combined) Engine Assembly Plant GEMA Engine Plant, Dundee, Mich. (a) Meets Federal Tier 2 Bin 5 emission requirements and ULEV II requirements in California, Massachusetts, New York, Maine, Vermont, Connecticut, Pennsylvania, Rhode Island, New Jersey, Oregon and Washington. -

Between Business Interests and Ideological Marketing the USSR and the Cold War in Fiat Corporate Strategy, 1957–1972
Between Business Interests and Ideological Marketing The USSR and the Cold War in Fiat Corporate Strategy, 1957–1972 ✣ Valentina Fava On 15 August 1966, the Fiat automotive company signed an agreement in Moscow with the Soviet government regarding the construction of the Volga Automobile Factory (VAZ) to manufacture Fiat cars. The plant began oper- ations in September 1970—one year later than originally planned—and was a highly automated facility that was able to produce 660,000 Fiat 124s per annum.1 More than half a century later, the image of Italian-Soviet partnership in building the giant automobile plant still arouses emotions and curiosity, as demonstrated by documentaries and preparations for the fiftieth anniversary 1. The model’s body and engine were modified to be better suited for Soviet roads and climatic condi- tions. The total cost of constructing the plant was estimated at $642 million in February 1966: $247 million (39 percent) was to be spent in Italy, about $55 million (8 percent) was to be spent in the United States, France, Great Britain, Belgium, Switzerland, and West Germany (but this percentage grew to such an extent that $50 million alone was expected to be spent in the United States), and $340 million (53 percent) was to be spent (it never was) on building plants or equipment in member-states of the Council for Mutual Economic Assistance. This estimate included neither consultancy fees for the technical designs of the factory and the car nor the transfer of know-how and assistance methods, nor did it budget for purchasing special materials or paying third parties’ commissions for patents or additional know-how. -

Il Progetto Di Un Nuovo Modello Di Automobile È Il Risultato Di Un Lavoro Complesso Che Vede Coinvolte Professionalità Diverse
Il progetto dI un nuovo modello dI automobIle è Il rIsultato dI un lavoro complesso che vede coInvolte professIonalItà dIverse. un Iter metodologIco artIcolato che ha InIzIo sIn dalle prIme fasI dI ImpostazIone e non sI esaurIsce nemmeno nell’assemblaggIo fInale sulle lInee dI produzIone. un percorso nel quale l’ IntegrazIone dI dIfferentI apportI e competenze, l’applIcazIone delle tecnologIe pIù avanzate dI sImulazIone dIgItale ma anche Il rIcorso alle pIù tradIzIonalI lavorazIonI manualI Incentrano ancora nella fIgura del progettIsta Il progressIvo affInamento dI ognI elemento e dettaglIo. a Fiat desIgn approach 2 500L A Fiat design approach 3 4 500L A Fiat design approach 9 Introduzione Enrico Leonardo Fagone 5 16 20 Invented here! Oltre la forma, oltre la funzione: conversazione con il design dell’esperienza a conversation with Beyond shape, beyond functionality: Roberto Giolito design through experience 26 Iconicità Iconicity 32 Filosofia progettuale Design philosophy 36 40 Onestà progettuale “Il gesto e la parola”: Design honesty il design antropologico conversazione con “Gesture and word”: a conversation with anthropological design Andreas Wuppinger 44 Partire dall’interno Starting from the inside 48 52 Per un design introspettivo Ergonomia emozionale For an introspective design Emotional Ergonomics conversazione con a conversation with 58 L’automobile come architettura Virgilio Fernandez The automobile like architecture 60 84 Esplorare le forma attraverso i sensi Identità di marchio e identità Exploring shapes through the senses di prodotto conversazione con Brand and product a conversation with identity Rossella Guasco 68 Innovazione tecno-logica Techno-logical Innovation 72 Progettare la materia Designing the material 76 78 500L e oltre Design pacifico vs. -

Vital Statistics the People Who Made the X1/9
1986 Bertone X1/9 The People Who Made the X1/9 Vital Statistics 1972 FIAT X1/9 Layout Championed by Nuccio Bertone Chairman of the prominent Italian coachbuilder Carrozerria Bertone, he Transverse mid-engine rear wheel drive battled the beancounters at FIAT but succeeded in persuading FIAT boss Two-seater Gianni Agnelli to bring an affordable mid-engined Italian sportscar to mass Removable targa top stores in front trunk Autobianchi Front and rear trunks production. From 1972 thru 1988, about 163,000 X1/9s were built, more Runabout than 2/3 of which were sold in the USA as FIATs, and later as Bertones. Fuel tank and spare tire centrally positioned Dimensions Designed by Marcello Gandini Length: 156.3” Gandini was Chief Designer at Bertone from 1965 to 1980. His Width: 61.8” Autobianchi Runabout concept car, forerunner of the X1/9, debuted at the Wheelbase: 86.7” 1969 Torino Auto Show. He also designed supercars such as the Lamborghini Miura and Countach, the Lancia Stratos, the Ferrari Dino Height: 46.5” 308GT4; concept cars such as the 1970 BMW Garmisch 2002ti Curb Weight: 2210 lbs. (forerunner of the first generation BMW 5-series); and everyday Engine & Transmission production cars such as the X1/9 and the Citroen BX. Inline 4-cylinder, iron block, aluminum head Single Overhead Cam (SOHC), belt driven Engineered by Dante Giacosa & Giuseppe Puleo Displacement: 1.5 Liter (1498cc) FIAT’s Chief Engineer Giacosa designed the Autobianchi Primula, the first Horsepower: 75.2@5,500 rpm car with today’s now-standard layout of front-mounted transverse engine Torque: 79.6 Ft. -

FIAT Brand and Hoonigan Award Micah Diaz the 'Hoonigans Wanted' Crown
Contact: Jordan Wasylyk Bryan Zvibleman FIAT Brand and Hoonigan Award Micah Diaz the ‘Hoonigans Wanted’ Crown Micah Diaz of Corona, California, crowned the newest Hoonigan ambassador as FIAT brand and Hoonigan teamed up for a second straight year to celebrate the culture of motorsport This year’s grand prize was a track-ready Fiat 124 Spider Abarth heavily modified by the Hoonigan team Among hundreds of entries, 10 finalists were put through a number of driving challenges over five episodes in FIAT models: the Fiat 500 Abarth, Fiat 124 Spider Abarth, and (in the ultimate challenge) a Fiat 124 Abarth Rally Car - FIAT’s factory-built race car Judging this year’s finalists were celebrity drivers and team captains, Rhys Millen and Tavo Vildosola Included with the purchase of every 2018 Fiat 500 Abarth and 124 Spider Abarth is the opportunity for new owners to attend a segment-exclusive Abarth Driving Experience at no additional charge October 17, 2018, Auburn Hills, Mich. - FIAT Brand North America and Hoonigan, a motorsport lifestyle brand, announced Micah Diaz of Corona, California, as the winner of the Hoonigans Wanted challenge. For his accomplishment, Diaz takes home a track-ready Fiat 124 Spider Abarth that was heavily modified by the Hoonigan team. The vehicle’s build was aired and can be re-watched in its entirety on Hoonigan’s YouTube channel on their Daily Transmission show. “Congratulations to Micah Diaz for winning the Hoonigan’s Wanted search,” said Steve Beahm, Head of Passenger Car Brands – Dodge, SRT, Chrysler and Fiat, FCA – North America. “And special thanks to all of the passionate enthusiasts who took the time to showcase their abilities in our Italian-designed, fun-to-drive Fiat 500 Abarth and Fiat 124 Spider Abarth. -

Catalog Seed Autumn 2019 Success in Every Field Discoveries and Innovations by the Italian Genius
THE BEAUTY OF KNOWLEDGE BETWEEN SCIENCE, MYTH, FUTURISM AND AVANT-GARDE ISEA IS A BRAND OF AGROSERVICE S.P.A. LOCALITÀ ROCCHETTA, SAN SEVERINO MARCHE (MC) ITALY TEL. +39 0733 636011 FAX +39 0733 636005 [email protected] WWW.AGROSERVICESPA.IT Cover: The Vespa Piaggio - scene from the film “Vacanze romane” (1953), directed by William Wyler, interpreted by Gregory Peck and Audrey Hepburn. CATALOG SEED AUTUMN 2019 SUCCESS IN EVERY FIELD DISCOVERIES AND INNOVATIONS BY THE ITALIAN GENIUS Art, food and Movements Fashion, Music and Theatre Aerospace engineering The Futurism 11 The ‘Prêt-à-porter’ casual wear 47 The launch of Vega 90 The Vespa 98 12 Thayaht’s Suit 47 The Fiat 500 13 The Nabucco48 The Moka Coffee-machine by Bialetti 14 The Italian anthem48 Bacio Perugina Chocolates 15 The Tourandot48 Nutella chocolate spread 15 An all-woman’s record Italian Neorealism 16 Samantha Cristoforetti: The Carosello 16 the first Italian woman astronaut 97 The Dat-3 Helicopter 17 The Hydroplane 17 Vegetable Genetics and Culture The Milan-Varese: Marco Michahelles: research on new wheats 56 the first Autostrada (Highway) 18 Maria Montessori: the new method of education by the teacher from the Marche region 58 Curiosity Borax Fumaroles of Larderello 98 Goldsmith’s craft of Valenza 98 The Microchip Intel 99 Murano Glass 99 Design and Mechanics The 202 Cisitalia 36 Science, Economy The Ferrari and the two lever gear shift 36 and Nobel Prize Winners The Common Rail 36 Enrico Fermi: the discovery of atom energy 70 Renato Dulbecco: the Genoma Project 70 Rita