Originalarbeiten
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Acta Entomologica Slovenica, 29 (1), 2021 Zastopane Z Zanimivimi Najdbami, Kot So Suillia Gigantea (Meigen, 1830), S
ACTA ENTOMO LOGICA SL OVENICA LJUBLJANA, JUNIJ 2021 Vol. 29, øt. 1: 93 –106 Some familieS of Diptera from beer trapS in balaton HigHlanD, Hungary Libor Dvořák 1, kateřina Dvořáková 1, Jan Máca 2 & attila J. TráJer 3 1 Tři Sekery 21, cZ-35301 Mariánské Lázně, czech republic; e-mail: [email protected], [email protected] 2 Na Potoce 276, cZ-39181 veselí nad Lužnicí, czech republic; e-mail: [email protected] 3 Sustainability Solutions research Lab, University of Pannonia, egyetem utca 10, H-8200 veszprém, Hungary; e-mail: [email protected] abstract – Faunistic records for 41 Diptera species from nine families (anisopodidae, Drosophilidae, Dryomyzidae, Heleomyzidae, Lauxaniidae, Platystomatidae, Sciomyzi - dae, Syrphidae and Ulidiidae) collected at six sites at Felsőörs and Lovas in the Balaton Highland, Hungary are presented. amongst the material, the species Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (Drosophilidae) and Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855) (Ulidiidae) belong to invasive pest species. Thermophilous species are represented by interesting records, namely Suillia gigantea (Meigen, 1830), S. lu - rida (Meigen, 1830) , S. variegata (Loew, 1862) (all Heleomyzidae), Minettia subvittata (Loew, 1847), Peplomyza discoidea (Meigen, 1830) (both Lauxaniidae), and Otites lamed (Schrank, 1781) (Ulidiidae). Furthermore, the disease vector role of Phortica variegata (Fallén, 1823) (Drosophilidae) is also discussed. key worDS : beer traps, Diptera, faunistics, Hungary izvleček – NekaJ DrUŽIN DvokrILcev IZ PIvSkIH PaSTI Na BaLa - ToNSkeM vIŠavJU Na MaDŽarSkeM Predstavljeni so favnistični podatki o 41 vrstah dvokrilcev iz devetih družin (anisopodidae, Drosophilidae, Dryomyzidae, Heleomyzidae, Lauxaniidae, Platys - tomatidae, Sciomyzidae, Syrphidae in Ulidiidae), zbranih na šestih krajih pri vaseh Felsőörs in Lovas na Balatonskem višavju na Madžarskem. -
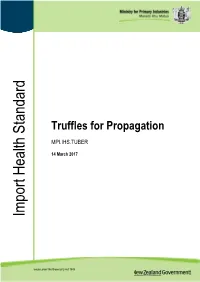
Truffles for Propagation
Truffles for Propagation MPI.IHS.TUBER 14 March 2017 Import Health Standard Import Health Issued under the Biosecurity Act 1993 Import Health Standard: Truffles for Propagation 14 March 2017 TITLE Import Health Standard: Truffles for Propagation COMMENCEMENT This Import Health Standard comes into force on the date of issue. REVOCATION This import health standard revokes and replaces Import Health Standard BNZ.IMP.TUBER: Importation into New Zealand of specified fresh and frozen Tuber species (truffle) dated 1 February 2011. ISSUING AUTHORITY This Import Health Standard is issued under section 24A of the Biosecurity Act 1993. Dated at Wellington this 14th day of March 2017 Shane Olsen acting Manager, Import and Export Plants Ministry for Primary Industries (acting under delegated authority of the Director-General) Contact for further information Ministry for Primary Industries (MPI) Regulation & Assurance Branch Plant Imports PO Box 2526, Wellington 6140 Email: [email protected] Ministry for Primary Industries Page 1 of 11 Import Health Standard: Truffles for Propagation 14 March 2017 Contents Page Introduction 3 Part 1: General Requirements 5 1.1 Application 5 1.2 Incorporation of material by reference 5 1.3 Definitions 5 1.4 General 5 1.5 Exporting country systems 5 1.6 Export plans 6 1.7 Permit to import 6 1.8 Transit requirements 6 Part 2: Specific Requirements 7 2.1 Commodity description 7 2.2 Pest list 7 2.3 Basic Measures 7 2.4 Phytosanitary inspection 7 Part 3: Documentation Requirements 8 3.1 Phytosanitary certification 8 3.2 Species validation 8 Appendix 1: Definitions 9 Appendix 2: Amendment Record 10 Appendix 3: Truffles Regulated Pest List 11 Ministry for Primary Industries Page 2 of 11 Import Health Standard: Truffles for Propagation 14 March 2017 Introduction This introduction is not part of the import health standard (IHS), but is intended to indicate its general effect. -

<I>Pseudoleria Pectinata</I>
Acta zoologica cracoviensia, 63(2) 2020 e-ISSN 2300-0163 Kraków, December, 2020 https://doi.org/10.3409/azc.63.05 http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae) Andrzej Józef WONICA Received: 14 October 2020. Accepted: 10 December 2020. Available online: 23 December 2020. Issue online: 30 December 2020. Original article WONICA A.J. 2020. Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae). Acta zool. cracov., 63(2): 23-27. Abstract. One female specimen of Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) was identified from photos taken at the Spanish Atlantic coast by Antonio J. PIZARRO MÉNDEZ, an amateur biologist. The species was observed in nature, in Rota, Spain, on 6th December 2019, and after detailed identification process, it was recorded for the first time in Europe. The pictures concerning the Pseudoleria pectinata specimen and the diagnostic features are presented. A discussion concerning the utilization of citizen science to help monitor invasive or introduced animals is included. Key words: Diptera, Heleomyzidae, Pseudoleria, distribution, citizen science, new record, Europe, Spain. *Andrzej Józef WONICA, Institute of Environmental Biology, Wroc³aw University of Environmental & Life Sciences, Ko¿uchowska 5b, 51-631 Wroc³aw, Poland. E-mail: [email protected] I. INTRODUCTION Of these, only one species, Prosopantrum flavifrons TONNOIR &MALLOCH 1927, was regarded as an in- Heleomyzidae are rather medium-sized acalyptrate troduced and alien species in Europe, distributed in flies with a yellowish, brownish, or rarely blackish the Atlantic European area and reported from a few is- body colouration and wing membrane hyaline, some- lands only (PAPE et al. -

MAF BIOSECURITY NEW ZEALAND STANDARD 155.02.06 Importation
MAF BIOSECURITY NEW ZEALAND STANDARD 155.02.06 Importation of Nursery Stock Issued as an import health standard pursuant to section 22 of the Biosecurity Act 1993 MAF Biosecurity New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry PO Box 2526 Wellington New Zealand CONTENTS Endorsement Review Amendment Record 1. Introduction 1.1 Official Contact Point 1.2 Scope 1.3 References 1.4 Definitions and Abbreviations 1.5 General 1.6 Convention on International Trade in Endangered Species 1.7 Equivalence 2. Import Specification and Entry Conditions 2.1 Inspection on Arrival and Maximum Pest Limit 2.2 Entry Conditions 2.2.1 Basic Conditions 2.2.1.1 Types of Nursery Stock that may be Imported 2.2.1.2 Import Permit 2.2.1.3 Labelling 2.2.1.4 Cleanliness 2.2.1.5 Phytosanitary Certificate 2.2.1.6 Pesticide treatments for whole plants and cuttings 2.2.1.7 Pesticide treatments for dormant bulbs 2.2.1.8 Measures for Helicobasidium mompa 2.2.1.9 Measures for Phymatotrichopsis omnivore 2.2.1.10 Measures for Phytophthora ramorum 2.2.1.11 Measures for Xylella fastidiosa 2.2.1.12 Post-Entry Quarantine (PEQ) 2.2.2 Entry Conditions for Tissue Culture 2.2.2.1 Labelling 2.2.2.2 Cleanliness & Tissue Culture Media 2.2.2.3 Phytosanitary Certificate 2.2.2.4 Inspection on Arrival 2.2.3 Importation of Pollen 2.2.4 Importation of New Organisms 2.3 Compliance Procedures 2.3.1 Validation of Overseas Measures 2.3.2 Treatment and Testing of the Consignment 2.4 New Zealand Nursery Stock Returning from Overseas 3. -
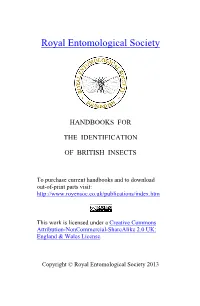
An Introduction to the Immature Stages of British Flies
Royal Entomological Society HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS To purchase current handbooks and to download out-of-print parts visit: http://www.royensoc.co.uk/publications/index.htm This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales License. Copyright © Royal Entomological Society 2013 Handbooks for the Identification of British Insects Vol. 10, Part 14 AN INTRODUCTION TO THE IMMATURE STAGES OF BRITISH FLIES DIPTERA LARVAE, WITH NOTES ON EGGS, PUP ARIA AND PUPAE K. G. V. Smith ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON Handbooks for the Vol. 10, Part 14 Identification of British Insects Editors: W. R. Dolling & R. R. Askew AN INTRODUCTION TO THE IMMATURE STAGES OF BRITISH FLIES DIPTERA LARVAE, WITH NOTES ON EGGS, PUPARIA AND PUPAE By K. G. V. SMITH Department of Entomology British Museum (Natural History) London SW7 5BD 1989 ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON The aim of the Handbooks is to provide illustrated identification keys to the insects of Britain, together with concise morphological, biological and distributional information. Each handbook should serve both as an introduction to a particular group of insects and as an identification manual. Details of handbooks currently available can be obtained from Publications Sales, British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD. Cover illustration: egg of Muscidae; larva (lateral) of Lonchaea (Lonchaeidae); floating puparium of Elgiva rufa (Panzer) (Sciomyzidae). To Vera, my wife, with thanks for sharing my interest in insects World List abbreviation: Handbk /dent. Br./nsects. © Royal Entomological Society of London, 1989 First published 1989 by the British Museum (Natural History), Cromwell Road, London SW7 5BD. -
Diptera) of Finland 319 Doi: 10.3897/Zookeys.441.7507 CHECKLIST Launched to Accelerate Biodiversity Research
A peer-reviewed open-access journal ZooKeys 441: Checklist319–324 (2014) of the fly families Chyromyidae and Heleomyzidae( Diptera) of Finland 319 doi: 10.3897/zookeys.441.7507 CHECKLIST www.zookeys.org Launched to accelerate biodiversity research Checklist of the fly families Chyromyidae and Heleomyzidae (Diptera) of Finland Jere Kahanpää1 1 Finnish Museum of Natural History, Zoology Unit, P.O. Box 17, FI-00014 University of Helsinki, Finland Corresponding author: Jere Kahanpää ([email protected]) Academic editor: J. Salmel | Received 13 March 2014 | Accepted 6 May 2014 | Published 19 September 2014 http://zoobank.org/FFD58A2C-97C8-4319-9D2B-AF8ADE1EB9C0 Citation: Kahanpää J (2014) Checklist of the fly families Chyromyidae and Heleomyzidae (Diptera) of Finland. In: Kahanpää J, Salmela J (Eds) Checklist of the Diptera of Finland. ZooKeys 441: 319–324. doi: 10.3897/zookeys.441.7507 Abstract A Finnish checklist of the sphaeroceroid fly families Chyromyidae and Heleomyzidae is provided. Keywords Species list, Finland, Diptera, biodiversity, faunistics Introduction The superfamily Sphaeroceroidea is a medium-sized one, with two families of moder- ate diversity, Sphaeroceridae (1550 species) and Heleomyzidae (~720 species), and the small family Chyromyidae. The enigmatic afrotropical Mormotomyia hirsuta Aus- ten, 1936 was once placed near Sphaeroceridae but it is now seen as an ephydroid fly (Kirk-Spriggs et al. 2011). McAlpine (2007) has proposed an alternative concept for Sphaeroceroidea with Sphaeroceridae and Heleomyzidae united as a single family called Heteromyzidae. This proposal has not gained significant support and for the purposes of this checklist the traditional concept of family Sphaeroceridae is retained. Copyright Jere Kahanpää. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. -

Elimination of Viruses in Garlic ( Allium Sativum L.) by Different Methods Bachelor Thesis
MENDEL UNIVERSITY IN BRNO FACULTY OF AGRISCIENCES BACHELOR THESIS BRNO 2016 MILICA RACO Mendel University in Brno Faculty of AgriSciences Department of Plant Biology Elimination of viruses in garlic ( Allium sativum L.) by different methods Bachelor thesis Supervisor: Author: Ing. Biljana Đor đevi ć Milica Raco Brno 2016 Statutory Declaration Herewith I declare that I have written my final thesis Elimination of viruses in garlic (Allium sativum L.) by different methods by myself and all sources and data used are quoted in the list of references. I agree that my work will be published in accordance with Section 47b of Act No. 111/1998 Sb. on Higher Education as amended thereafter and in accordance with the Guidelines on the Publishing of University Student Theses . I am aware of the fact that my thesis is subject to Act. No. 121/2000 Sb., the Copyright Act and that the Mendel University in Brno is entitled to close a licence agreement and use the results of my thesis as the “School Work” under the terms of Section 60 para. 1 of the Copyright Act. Before closing a licence agreement on the use of my thesis with another person (subject) I undertake to request for a written statement of the university that the licence agreement in question is not in conflict with the legitimate interests of the university, and undertake to pay any contribution, if eligible, to the costs associated with the creation of the thesis, up to their actual amount. In Brno on: ……………………………………………… signature Acknowledgements I would like to express my deepest gratefulness to my supervisor Ing. -

A New Genus and Species of Heleomyzid Fly Introduced Into the European Fauna (Diptera: Heleomyzidae)
Acta zoologica cracoviensia, 63(2) 2020 e-ISSN 2300-0163 Kraków, December, 2020 https://doi.org/10.3409/azc.63.05 http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae) Andrzej Józef WONICA Received: 14 October 2020. Accepted: 10 December 2020. Available online: 23 December 2020. Issue online: 30 December 2020. Original article WONICA A.J. 2020. Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae). Acta zool. cracov., 63(2): 23-27. Abstract. One female specimen of Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) was identified from photos taken at the Spanish Atlantic coast by Antonio J. PIZARRO MÉNDEZ, an amateur biologist. The species was observed in nature, in Rota, Spain, on 6th December 2019, and after detailed identification process, it was recorded for the first time in Europe. The pictures concerning the Pseudoleria pectinata specimen and the diagnostic features are presented. A discussion concerning the utilization of citizen science to help monitor invasive or introduced animals is included. Key words: Diptera, Heleomyzidae, Pseudoleria, distribution, citizen science, new record, Europe, Spain. *Andrzej Józef WONICA, Institute of Environmental Biology, Wroc³aw University of Environmental & Life Sciences, Ko¿uchowska 5b, 51-631 Wroc³aw, Poland. E-mail: [email protected] I. INTRODUCTION Of these, only one species, Prosopantrum flavifrons TONNOIR &MALLOCH 1927, was regarded as an in- Heleomyzidae are rather medium-sized acalyptrate troduced and alien species in Europe, distributed in flies with a yellowish, brownish, or rarely blackish the Atlantic European area and reported from a few is- body colouration and wing membrane hyaline, some- lands only (PAPE et al. -

Proceedings of the Meetings Comptes Redus De Les Réunions Edited By
IOBC / WPRS Working Group “Integrated Protection in Field Vegetable Crops” OILB / SROP Groupe de Travail « Lutte Intégrée en Culture de Légumes » Proceedings of the Meetings Comptes Redus de les Réunions at / à Gödöllö (Hungary) 31.10. – 3.11.1999 and Krakow (Poland) 15. – 17.10.2001 Edited by Stefan Vidal IOBC wprs Bulletin Bulletin OILB srop Vol. 26 (3), 2003 The content of the contributions is in the responsibility of the authors The IOBC/WPRS Bulletin is published by the International Organization for Biological and Integrated Control of Noxious Animals and Plants, West Palearctic Regional Section (IOBC/WPRS) Le Bulletin OILB/SROP est publié par l‘Organisation Internationale de Lutte Biologique et Intégrée contre les Animaux et les Plantes Nuisibles, section Regionale Ouest Paléarctique (OILB/SROP) Copyright: IOBC/WPRS 2003 The Publication Commission of the IOBC/WPRS: Horst Bathon Luc Tirry Federal Biological Research Center University of Gent for Agriculture and Forestry (BBA) Laboratory of Agrozoology Institute for Biological Control Department of Crop Protection Heinrichstr. 243 Coupure Links 653 D-64287 Darmstadt (Germany) B-9000 Gent (Belgium) Tel +49 6151 407-225, Fax +49 6151 407-290 Tel +32-9-2646152, Fax +32-9-2646239 e-mail: [email protected] e-mail: luc.tirry@ rug.ac.be Address General Secretariat: INRA – Centre de Recherches de Dijon Laboratoire de recherches sur la Flore Pathogène dans le Sol 17, Rue Sully, BV 1540 21034 DIJON CEDEX France ISBN 92-9067-151-1 Web: http://www.iobc-wprs.org Introduction This Bulletin is exceptional in containing the papers of the last two meetings of the IOBC/wprs Working Group on “Integrated Protection in Field Vegetables”. -

Publikační Činnost
Mendelova univerzita v Brně Publikační činnost Projekt: Biologické a technologické aspekty udržitelnosti řízených ekosystémů a jejich adaptace na změnu klimatu Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Pracoviště projektu: Agronomická fakulta 2011 Vytištěno 31. 01. 2012 TRNKA, M. – SCHAUMBERGER, A. – EITZINGER, J. – HLAVINKA, P. – BALEK, J. – MARTIN, D. – BARTO- ŠOVÁ, L. – MOŽNÝ, M. – ŠTĚPÁNEK, P. – KOHOUTEK, A. – ŽALUD, Z. Modelling approach for evalua- ting the seasonal drought impact on the productivity of permanent grasslands under conditions of the Czech Republic. In Grassland farming and land management systems in mountainous regions. 1. vyd. Raumberg-Gumpenstein: European Grassland Federation, 2011, s. 211–213. ISBN 978-3-902559-65-4. Grassland productivity in the Czech Republic is significantly affected by variability in the weather, which in recent years has exhibited more frequent drought episodes (e.g. in 2000 or 2003) leading to lower yield-stability. The negative effects of drought could be partly prevented by a system combining a body of knowledge obtained from past long-term grassland experiments with spatially explicit information about the soil water availability in the given season, and to issue a probabilistic forecast of seasonal water stress and yield levels. Such a system was shown to well represent the between-year yield variability (R2 between 0.6 – 0.9) at individual sites and provide useful forecasting ability surpassing standard statistical forecast methods. HEJDUK, S. Changes of soil agrichemical characteristics in pastures influenced by mineral Fertilizing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2011. sv. 59, č. 1, s. 113–119. ISSN 1211-8516. Grasslands fertilizing is used for increasing of forage yields and quality and simultaneously for soil fertility mainte- nance. -

BIOSECURITY NEW ZEALAND STANDARD 155.02.06 Importation
BIOSECURITY NEW ZEALAND STANDARD 155.02.06 Importation of Nursery Stock Issued as an import health standard pursuant to section 22 of the Biosecurity Act 1993 Biosecurity New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry PO Box 2526 Wellington New Zealand CONTENTS Endorsement Review Amendment Record 1. Introduction 1.1 Official Contact Point 1.2 Scope 1.3 References 1.4 Definitions and Abbreviations 1.5 General 1.6 Convention on International Trade in Endangered Species 2. Import Specification and Entry Conditions 2.1 Import Specification 2.2 Entry Conditions 2.2.1 Basic Conditions 2.2.1.1 Types of Nursery Stock that may be Imported 2.2.1.2 Import Permit 2.2.1.3 Labelling 2.2.1.4 Cleanliness 2.2.1.5 Phytosanitary Certificate 2.2.1.6 Pesticide treatments for whole plants and cuttings 2.2.1.7 Pesticide treatments for dormant bulbs 2.2.1.8 Measures for Helicobasidium mompa 2.2.1.9 Measures for Phymatotrichopsis omnivora 2.2.1.10 Post-Entry Quarantine (PEQ) 2.2.2 Entry Conditions for Tissue Culture 2.2.2.1 Labelling 2.2.2.2 Cleanliness 2.2.2.3 Phytosanitary Certificate 2.2.2.4 Inspection on Arrival 2.2.3 Importation of Pollen 2.2.4 Importation of New Organisms 2.3 Compliance Procedures 2.3.1 Validation of Overseas Measures 2.3.2 Treatment and Testing of the Consignment 2.4 New Zealand Nursery Stock Returning from Overseas 3. Schedule of Special Entry Conditions 3.1 Special Entry Conditions 3.2 Accreditation of Offshore Plant Quarantine Facilities 3.3 Amendments to the Plants Biosecurity Index Biosecurity New Zealand Standard 155.02.06: Importation of Nursery Stock. -

<I>Pseudoleria Pectinata</I>
Acta zoologica cracoviensia, 63(2) 2020 e-ISSN 2300-0163 Kraków, December, 2020 https://doi.org/10.3409/azc.63.05 http://www.isez.pan.krakow.pl/en/acta-zoologica.html Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae) Andrzej Józef WONICA Received: 14 October 2020. Accepted: 10 December 2020. Available online: 23 December 2020. Issue online: 30 December 2020. Original article WONICA A.J. 2020. Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) – a new genus and species of heleomyzid fly introduced into the European fauna (Diptera: Heleomyzidae). Acta zool. cracov., 63(2): 23-27. Abstract. One female specimen of Pseudoleria pectinata (LOEW, 1872) was identified from photos taken at the Spanish Atlantic coast by Antonio J. PIZARRO MÉNDEZ, an amateur biologist. The species was observed in nature, in Rota, Spain, on 6th December 2019, and after detailed identification process, it was recorded for the first time in Europe. The pictures concerning the Pseudoleria pectinata specimen and the diagnostic features are presented. A discussion concerning the utilization of citizen science to help monitor invasive or introduced animals is included. Key words: Diptera, Heleomyzidae, Pseudoleria, distribution, citizen science, new record, Europe, Spain. *Andrzej Józef WONICA, Institute of Environmental Biology, Wroc³aw University of Environmental & Life Sciences, Ko¿uchowska 5b, 51-631 Wroc³aw, Poland. E-mail: [email protected] I. INTRODUCTION Of these, only one species, Prosopantrum flavifrons TONNOIR &MALLOCH 1927, was regarded as an in- Heleomyzidae are rather medium-sized acalyptrate troduced and alien species in Europe, distributed in flies with a yellowish, brownish, or rarely blackish the Atlantic European area and reported from a few is- body colouration and wing membrane hyaline, some- lands only (PAPE et al.