IAN REPORT 98 Regionalstudie Piestingtal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aufteilung Gemeinden Niederösterreich
Gemeinde Förderbetrag Krems an der Donau 499.005 St. Pölten 1.192.215 Waidhofen an der Ybbs 232.626 Wiener Neustadt 898.459 Allhartsberg 38.965 Amstetten 480.555 Ardagger 64.011 Aschbach-Markt 69.268 Behamberg 60.494 Biberbach 41.613 Ennsdorf 54.996 Ernsthofen 39.780 Ertl 23.342 Euratsfeld 48.110 Ferschnitz 31.765 Haag 101.903 Haidershofen 66.584 Hollenstein an der Ybbs 31.061 Kematen an der Ybbs 47.906 Neuhofen an der Ybbs 53.959 Neustadtl an der Donau 39.761 Oed-Oehling 35.097 Opponitz 18.048 St. Georgen am Reith 10.958 St. Georgen am Ybbsfelde 51.812 St. Pantaleon-Erla 47.703 St. Peter in der Au 94.276 St. Valentin 171.373 Seitenstetten 61.882 Sonntagberg 71.063 Strengberg 37.540 Viehdorf 25.230 Wallsee-Sindelburg 40.446 Weistrach 40.557 Winklarn 29.488 Wolfsbach 36.226 Ybbsitz 64.862 Zeillern 33.838 Alland 47.740 Altenmarkt an der Triesting 41.057 Bad Vöslau 219.013 Baden 525.579 Berndorf 167.262 Ebreichsdorf 199.686 Enzesfeld-Lindabrunn 78.579 Furth an der Triesting 15.660 Günselsdorf 32.320 Heiligenkreuz 28.766 Hernstein 28.192 Hirtenberg 47.036 Klausen-Leopoldsdorf 30.525 Kottingbrunn 137.092 Leobersdorf 91.055 Mitterndorf an der Fischa 45.259 Oberwaltersdorf 79.449 Pfaffstätten 64.825 Pottendorf 125.152 Pottenstein 54.330 Reisenberg 30.525 Schönau an der Triesting 38.799 Seibersdorf 26.619 Sooß 19.511 Tattendorf 26.674 Teesdorf 32.727 Traiskirchen 392.653 Trumau 67.509 Weissenbach an der Triesting 32.005 Blumau-Neurißhof 33.690 Au am Leithaberge 17.474 Bad Deutsch-Altenburg 29.599 Berg 15.938 Bruck an der Leitha 145.163 Enzersdorf an der Fischa 57.236 Göttlesbrunn-Arbesthal 25.915 Götzendorf an der Leitha 39.040 Hainburg a.d. -

Absolventen Der Landwirtschafts- Schule Der Buckligen Welt Am Stand- Ort Kirchschlag Und Warth Bis Heute
Lehranstalt/Fachschule Kirchschlag Absolventen der Landwirtschafts- schule der Buckligen Welt am Stand- ort Kirchschlag und Warth bis heute Absolventen der Landwirtschaftlichen Lehranstalt/Fachschule am Standort KIRCHSCHLAG Allgemeine Information zur Aufstel- Ab dem Schuljahr 1933/34 bis Ab März 1940 war die Schule für lung der Absolventen von Kirch- zum Schuljahr 1938/39 sind die die Burschen geschlossen und es schlag: Namen und Unterlagen beider musste in weit entfernte Landwirt- Fachrichtungen lückenlos schriftlich schaftsschulen ausgependelt wer- Von Kirchschlag sind die Namen erhalten geblieben sowie die ge- den. der Absolventen der Winterschule meinsamen Abschlussfotos der für Burschen und Absolventinnen Mädchen und Burschen von 1937, Von den Absolventinnen des landwirtschaftlichen Haushaltungs- 1938 und 1939 (1939 sogar zu- letzten Haushaltungs-Jahrganges schule Mädchen für die ersten Jahr- sätzlich getrennte Gruppenfotos 1940/41 konnte wiederum There- gänge 1924/25 bzw. 1924/26 bis von Burschen und Mädchen). sia FREILER über die Nachkom- 1927/28 einschließlich 1927/29 men ihrer schon verstorbenen im Original im Bericht der Lehran- Die Namen der Absolventen von Schwester Maria, die jenen Jahr- stalt Kirchschlag von 1928 ersicht- 1939/40 sind, soweit noch durch gang besuchten, die Daten über ein lich). den letzten noch lebenden Absol- Stammbuch wieder rekonstruieren venten Alois SCHWARZ sen. vlg. und ein Abschlussfoto – das letzte Die Namen der Absolventen von Stockbauer, Spratzau 1, 2812 überhaupt – durch die Nachkom- 1929 bis 1934 werden im Bericht Hollenthon (geb. 1922) – übrigens men ihrer Schwester zur Verfügung der Lehranstalt Kirchschlag von Vater von Bischof Alois SCHWARZ stellen, denn sämtliche Daten 1934 zum 10-Jahr-Jubiläum nicht – und der Absolventin Theresia waren in den Kriegswirren und bei erwähnt und mussten 2010 müh- FREILER, geb. -

Exkursionsziele Sehenswertes, Landwirtschaftliche Exkursionsbetriebe, Unternehmen, Gasthäuser Und Heurige Im Bezirk Wr
Bezirksbauernkammer Wr. Neustadt ZVR-Nr. 938245685 Exkursionsziele Sehenswertes, landwirtschaftliche Exkursionsbetriebe, Unternehmen, Gasthäuser und Heurige im Bezirk Wr. Neustadt TRADITIONSBETRIEBTRADITIONSBETRIEB FrühstückFrühstückFrühstück -- -MittagsmenüMittagsmenü Mittagsmenü - - - GasthausGasthausGasthaus FestsaalFestsaalFestsaal fürfür für bisbis bis zuzu zu 220220 220 PersonenPersonen Personen [email protected]@[email protected] AngeboteAngeboteAngebote fürfür für BussreisendeBussreisende Bussreisende SeminarmöglichkeitenSeminarmöglichkeitenSeminarmöglichkeiten ZimmerZimmerZimmer www.fromwald.comwww.fromwald.comwww.fromwald.com ESSENESSEN ––– TRINKENTRINKEN –– WOHNENWOHNENWOHNEN Marktgemeinde Gutenstein RAIMUNDSPIELE 2019 „BRÜDERLEIN FEIN“ von Felix Mitterer „Ich wäre nie auf die Idee gekommen, über Raimund ein Stück anzufertigen. Andrea Eckert war es, die mich fragte, ob ich eines für Gutenstein schreiben könnte. Dafür bin ich ihr sehr dankbar. Denn während der Recherchen, während des Lesens und Schreibens, ist mir Ferdinand Raimund zum Bruder geworden. Und das Tragische, das seine Existenz durchwebt, hat sich wie durch ein Wunder – durch ihn! – in eine Komödie verwandelt. In eine sehr schmerzhafte Komödie. Oh, was für ein wahnwitziges Leben! Was für eine grenzenlose Hingabe an die Liebe, an die Natur, ans Theater. Brüderlein fein, du bist mir ans Herz gewachsen.“ Felix Mitterer Die Uraufführung des Auftragswerks der Raimundspiele mit dem Titel „BRÜDERLEIN FEIN“ wird am 11. Juli 2019 in Gutenstein -

Landesparteilisten Landeswahlkreis 3 – NÖ
Nationalratswahl 2019 Landeswahlbehörde für den Landeswahlkreis 3 - Niederösterreich KUNDMACHUNG Gemäß § 49 Abs. 1 der Nationalrats-Wahlordnung 1992 - NRWO werden folgende Landeswahlvorschläge (Landesparteilisten) für die Nationalratswahl 2019 veröffentlicht Landesparteilisten für den Landeswahlkreis 3 - Niederösterreich Liste 1 Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei (ÖVP) 1 SOBOTKA, Mag. Wolfgang 1956 Nationalratspräsident 3340 Waidhofen an der Ybbs 20 SCHMID, MSc Susanne 1968 Direktorin VS u. NMS Lichtenegg 2822 Walpersbach 39 FORSTHUBER, Mag. Gottfried 1983 Rechtsanwalt 2500 Baden 58 KERSCH Lena 1995 Studentin 2733 Grünbach am Schneeberg 2 HIMMELBAUER, BSc Eva-Maria 1986 Selbstständig 3741 Pulkau 21 FREISTETTER, Ing. Andreas 1968 Angestellter 3032 Eichgraben 40 YOUNG Regina 1948 Pensionistin 2351 Wiener Neudorf 59 LUEF Johannes 1969 Polizist 2620 Wartmannstetten 3 SCHMUCKENSCHLAGER Johannes 1978 Weinhauer 3400 Klosterneuburg 22 KALAB, Mag. Belinda 1967 Berufsschullehrerin, Dipl.-Päd. 3580 Horn 41 MINNICH Andreas 1974 Unternehmer 2100 Korneuburg 60 PÖLTL Sabrina 1980 Hausfrau 2340 Mödling 4 STEINACKER, Mag. Michaela 1962 Juristin 3002 Purkersdorf 23 BROIDL Franz Xaver 1988 Winzer 3550 Langenlois 42 BOLLWEIN Tamara 1981 Beamtin 3100 St. Pölten 61 SONNAUER Armin 1947 Pensionist 3512 Mautern an der Donau 5 AUER Otto 1966 Landwirt 2465 Höflein 24 STIFT Catharina 1973 Selbstständig 3430 Tulln an der Donau 43 MAYR, Ing. Lorenz 1982 Landwirt 2002 Steinabrunn 62 HAGHOFER, BSc Anna 1996 Ergotherapeutin 3910 Zwettl 6 BERGER-GRABNER, Mag. Dr. Doris 1978 Angestellte 3500 Krems an der Donau 25 RÄDLER Christian 1974 Geschäftsführer 2822 Bad Erlach 44 ZEIDLER-BECK, Mag., MBA Marlene 1987 Kampagnenmanagerin 2344 Maria Enzersdorf 63 SMUK, Ing. Alexander 1978 Unternehmer 2603 Felixdorf 7 HINTEREGGER, Ing., BA Florian 1989 Angest., Leitstellenl. -

Verordnung Befristete Anpassung
BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT WIENER NEUSTADT Fachgebiet Gesundheitswesen 2700 Wiener Neustadt, Ungargasse 33 Beilagen E-Mail: [email protected] WBA5-S-1338/006 Fax: 02622/9025-41571 Bürgerservice: 02742/9005-9005 Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) Internet: www.noe.gv.at - www.noe.gv.at/datenschutz (0 26 22) 9025 Bezug BearbeiterIn Durchwahl Datum Sabine Fischer 34573 12. April 2020 Betrifft befristete Anpassung der Regelung der Betriebszeiten V E R O R D N U N G der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt über eine befristete Anpassung der Regelung der Betriebszeiten öffentlicher Apotheken im Bezirk Wiener Neustadt zur Bewältigung der Situation um das Coronavirus Artikel I In den Verordnungen der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt als zuständige Bezirksverwaltungsbehörde über die Regelung der Betriebszeiten und des Bereitschaftsdienstes öffentlicher Apotheken im Bezirk Wiener Neustadt sind die Betriebs- bzw. Öffnungszeiten, während der die öffentlichen Apotheken für den Kundenverkehr offen zu halten haben, sowie Bereitschaftsdienstzeiten festgelegt. §1 Aufgrund des § 8 des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907, zuletzt geändert durch BGBl. I. 59/2018 werden die Betriebs- bzw. Bereitschaftsdienstzeiten wie folgt angepasst: § 2 Jene Apotheken, die während der Mittagssperre Bereitschaftsdienst versehen, können diesen in unbedingt erforderlichen Umfang unterbrechen, um Desinfektionsmaßnahmen zu setzen, einen Teamtausch vorzunehmen oder sonstige unbedingt gebotene Schutzmaßnahmen durchführen zu können. - 2 - § 3 Die unter § 2 vorgesehenen -

Bad Fischau-Brunn Bf
Tickets und Preise Für Strecken von/nach Bad Fischau-Brunn Bf Die Übersicht enthält die Preise gemäß Tarifbestimmungen des Verkehrsverbund Ost-Region für: Einzeltickets Tagestickets Wochenkarten Monatskarten Jahreskarten bei Einmalzahlung Alle Preise von 01.07.2020 bis 30.06.2021 Preisliste von Bad Fischau-Brunn Bf Preisstand: 01.07.2020 Seite 2 von 249 Nach Wegbeschreibung Einzelfahrt Tageskarte Wochenkarte Monatskarte Jahreskarte Aalfang über Wien, inkl. Wien Regionalverkehr 77,60 € 264,30 € 2.494,00 € Aalfang über Region ohne Wien 33,90 € 66,10 € 86,10 € 267,90 € 2.679,00 € Aalfang über Wien, inkl. Wien Kernzone 33,30 € 66,10 € 90,30 € 300,40 € 2.859,00 € Aalfang über Wien, inkl. Wien Kernzone Senior 2.729,00 € Absdorf bei Tulln über Wien, inkl. Wien Regionalverkehr 47,20 € 169,60 € 1.710,00 € Absdorf bei Tulln über Wien, inkl. Wien Kernzone 22,40 € 44,80 € 61,20 € 209,50 € 1.950,00 € Absdorf bei Tulln über Wien, inkl. Wien Kernzone Senior 1.820,00 € Absdorf (St. Pölten) über Wien, inkl. Wien Regionalverkehr 49,40 € 178,40 € 1.810,00 € Absdorf (St. Pölten) über Wien, inkl. Wien Kernzone 24,50 € 48,90 € 64,20 € 220,90 € 2.064,00 € Absdorf (St. Pölten) über Wien, inkl. Wien Kernzone Senior 1.934,00 € Absdorf-Hippersdorf über Wien, inkl. Wien Regionalverkehr 47,20 € 169,60 € 1.710,00 € Absdorf-Hippersdorf über Wien, inkl. Wien Kernzone 22,40 € 44,80 € 61,20 € 209,50 € 1.950,00 € Absdorf-Hippersdorf über Wien, inkl. Wien Kernzone Senior 1.820,00 € Abstetten über Wien, inkl. Wien Regionalverkehr 42,70 € 150,00 € 1.515,00 € Abstetten über Wien, inkl. -

Termine Auf Einen Blick
Termine auf einen Blick INHALT Seite Laufend Seite Yoga, Bad Fischau 7 Pilates, Grünbach 7 Unser Kurs- und Veranstaltungskalender Aerobic, Grünbach 7 ist in Schwerpunktbereiche unterteilt. Tischtennis, Grünbach 7 Sie finden die Angebote zu den Seniorenturnen, Grünbach 7 verschiedenen Themen auf folgenden Karate, Grünbach 7 Seiten: Zumba, Grünbach u. Steinabrückl 7 Aerobic Bauch,Bein,Po, Grünbach 7 Feldenkrais, Gutenstein 7 SPRACHEN 6 Treffpunkt:Tanz, Bad Fischau 10 Tanzen mit Gaby, Bad Fischau 10 EDV 7 Breakdance Steinabrückl 13 Zumba ab 12 Jahre, Steinabrückl 13 GESUNDHEIT 7-10 Balettkurs für Kinder, Gutenstein 13 Wöchentliche Meditationsrunde 19 TANZ 10-11 Reikitreff 20 Integratives Atemtraining 20 KREATIVKURSE 11-12 Smovey-Training 20 Jänner KOCHEN 12-13 04. Kraftplatzwanderung Lichtmess 17 Botanische Malerei 23 KINDER & JUGEND 13-14 05. Merkaba Basic 20 09. Modern Line Dance 10 SEMINARE und 10.Spanisch für den Urlaub 6 WORKSHOPS 15-22 11. Italienisch für den Urlaub 6 14. Eutonie, Seminar 15 BILDUNGSBERATUNG 22 16. Pilates 7 Gesundheitsgymnastik 7 BHW-Seminarprogramm für 17. Gesunde Kinderseele 15 Bildung, Kultur u. Beteiligung 22 18. Treffpunkt:Tanz 10 Kreativrunde 11 KUNST-KULTUR-BRAUCHTUM Faschingumzug 26 19. Treffpunkt:Tanz 11 mit den diverse Veranstaltungen Männerkochtreff 12 auf den Seiten 23-30 20. Kasperltheater 13 21. Frauen-Managerinnen des Alltags 15 Eltern als Führungskräfte WS3 19 Körper Typologie 2 20 22. Klangschalen Seminar 20 24. Pilates-BodyArt 8 26. Trommelkurs für Anfänger 11 Bräuche und Feste im Jahreskreis 17 28. Frückstück nach den 5 Elementen 12 Schneeschuhwandern Unterberg 15 Ätherische Öle 15 Februar 02. Pernitzer Melange 25 03. Schitourenkurs 8 Humoristische Lesung 25 Koordination: Regionales BHW Piestingtal/Schneebergland, Magdalena Schreiner 2 Tel. -

Moving Wachau, © Robert Herbst
REFRESHINGLY moving Road map of Lower Austria, with tips for visitors WWW.LOWER-AUSTRIA.INFO Mostviertel, © Robert Herbst Mostviertel, Welcome! “With this map, we want to direct you to the most beautiful corners of Lower Austria. As you will see, Austria‘s largest federal state presents itself as a land of diversity, with a wide variety of landscapes for refreshing outdoor adventures, great cultural heritage, world-class wines and regional specialities. All that’s left to say is: I wish you a lovely stay, and hope that your time in Lower Austria will be unforgettable!” JOHANNA MIKL-LEITNER Lower Austrian Governor © NLK/Filzwieser “Here you will find inspiration for your next visit to, or stay in, Lower Austria. Exciting excursion destinations, varied cycling and mountain biking routes, and countless hiking trails await you. This map also includes lots of tips for that perfect stay in Lower Austria. Have fun exploring!” JOCHEN DANNINGER Lower Austrian Minister of Economics, Tourism and Sports © Philipp Monihart Wachau, © Robert Herbst Wachau, LOWER AUSTRIA 2 national parks in numbers Donau-Auen and Thaya Valley. 1 20 Vienna Woods nature parks years old is the age of the Biosphere Reserve. in all regions. Venus of Willendorf, the 29,500 world’s most famous figurine. fortresses, castles 70 and ruins are open to visitors. 93 centers for alpine abbeys and monasteries have “Natur im Garten” show gardens 9 adventure featuring 15 shaped the province and ranging from castle and monastic summer and winter its culture for centuries, gardens steeped in history sports. Melk Abbey being one to sweeping landscape gardens. -

Abwanderungsgemeinden in NÌ Homepage.Xlsx
Abwanderungsgemeinden in Niederösterreich * Kategorie I = Abwanderung von minus 2,5% bis 4,9% X Kategorie II = Abwanderung minus 5% und mehr Aggsbach * Gnadendorf * Kottes-Purk x Puchenstuben * Sigmundsherberg * Albrechtsberg an der Großen Krems* Göstling an der Ybbs x Laab im Walde * Raabs an der Thaya x Sonntagberg * Allentsteig x Grafenbach-Sankt Valentin * Langau x Raach am Hochgebirge x Sooß x Altmelon * Groß Gerungs * Leitzersdorf * Rabensburg * Spitz * Amaliendorf-Aalfang * Großgöttfritz * Lengenfeld * Randegg * Staatz x Annaberg x Großharras x Lichtenegg * Ravelsbach x Statzendorf * Arbesbach x Großriedenthal x Lichtenwörth x Reichenau an der Rax x Stronsdorf * Aspangberg-Sankt Peter * Groß-Schweinbarth * Lilienfeld x Reingers x Ternitz * Bad Großpertholz x Groß-Siegharts * Litschau * Retzbach x Thaya * Bad Schönau * Grünbach am Schneeberg x Loich * Ringelsdorf-Niederabsdorf x Traisen x Bärnkopf x Günselsdorf * Ludweis-Aigen x Rohr im Gebirge * Trattenbach * Brand-Nagelberg x Gutenbrunn x Lunz am See x Rohrbach an der Gölsen x Türnitz * Breitenstein x Gutenstein x Mailberg x Röhrenbach x Velm-Götzendorf * Buchbach * Hardegg x Mannsdorf an der Donau x Rosenburg-Mold x Waidhofen an der Thaya x Dietmanns x Haugschlag * Maria Laach am Jauerling * Rossatz-Arnsdorf x Waidmannsfeld x Dobersberg x Haugsdorf x Martinsberg x Sallingberg x Waldhausen x Dorfstetten x Heidenreichstein x Meiseldorf x Sankt Aegyd am Neuwalde x Waldkirchen an der Thaya x Drosendorf-Zissersdorf * Hirschbach * Mitterbach am Erlaufsee x Sankt Anton an der Jeßnitz -
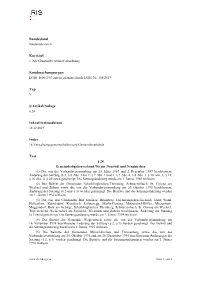
PDF-Dokument
Bundesland Niederösterreich Kurztitel 1. NÖ Gemeindeverbändeverordnung Kundmachungsorgan LGBl. 1600/2-57 zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 108/2019 Typ V §/Artikel/Anlage § 24 Inkrafttretensdatum 18.12.2019 Index 16 Verwaltungsgemeinschaften und Gemeindeverbände Text § 24 Gemeindeabgabenverband Wiener Neustadt und Neunkirchen (1) Die von der Verbandsversammlung am 18. März 1987 und 2. Dezember 1987 beschlossene Änderung der Satzung (§ 5, § 6 Abs. 3 bis 7, § 7 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 4, § 8 Abs. 3, § 10 Abs. 3, § 12, § 16 Abs. 4, § 20) wird genehmigt. Die Satzungsänderung wurde am 1. Jänner 1988 wirksam. (2) Der Beitritt der Gemeinden Scheiblingkirchen-Thernberg, Schwarzenbach, St. Corona am Wechsel und Zöbern sowie die von der Verbandsversammlung am 20. Oktober 1993 beschlossene Änderung der Satzung (§ 2 und § 3) werden genehmigt. Die Beitritte und die Satzungsänderung werden am 1. Jänner 1994 wirksam. (3) Die von den Gemeinden Bad Schönau, Bromberg, Hochneukirchen-Gschaidt, Hohe Wand, Hollenthon, Katzelsdorf, Krumbach, Lichtenegg, Markt-Piesting, Matzendorf-Hölles, Miesenbach, Muggendorf, Rohr am Gebirge, Scheiblingkirchen-Thernberg, Schwarzenbach, St. Corona am Wechsel, Theresienfeld, Weikersdorf am Steinfeld, Wiesmath und Zöbern beschlossene Änderung der Satzung (§ 3) wird genehmigt. Die Satzungsänderung wurde am 1. Jänner 1994 wirksam. (4) Der Beitritt der Gemeinde Walpersbach sowie die von der Verbandsversammlung am 16. November 1994 beschlossene Änderung der Satzung (§ 2, § 3) werden genehmigt. Der Beitritt und die Satzungsänderung wurden am 1. Jänner 1995 wirksam. (5) Die Beitritte der Gemeinden Mönichkirchen und Thomasberg sowie die von der Verbandsversammlung am 25. Oktober 1995 und am 20. Dezember 1995 beschlossenen Änderungen der Satzung (§ 2, § 3) werden genehmigt. Die Beitritte und die Satzungsänderungen wurden am 1. -

Niederösterreich)
BCBEA 3/1 (Dezember 2017) – Sauberer & Willner: Bibliographie Flora und Vegetation Bezirk Baden Bibliographie der Gefäßpflanzenflora und Vegetation des Bezirks Baden (Niederösterreich) 1, * 1, 2 Norbert Sauberer & Wolfgang Willner 1VINCA – Institut für Naturschutzforschung und Ökologie Gießergasse 6/7, A-1090 Wien, Österreich ²Department für Botanik und Biodiversitätsforschung, Universität Wien Rennweg 14, A-1030 Wien, Österreich *e-mail: [email protected] Sauberer N. & Willner W. 2017. Bibliographie der Gefäßpflanzenflora und Vegetation des Bezirks Baden (Niederöster- reich). Biodiversität und Naturschutz in Ostösterreich - BCBEA 3/1: 36–66. Online ab 30 Dezember 2017 Abstract Bibliography of the vascular plant flora and vegetation for the district of Baden (Lower Austria). For the first time a bibliography of vascular plants and vegetation for the district of Baden is compiled. It encompasses 234 citations; among these are 190 publications, 22 academic works and 22 quotations of grey literature. Keywords: Austria, Pteridophyta, Spermatophyta Zusammenfassung Insgesamt umfasst die zum ersten Mal zusammengestellte Bibliographie der Gefäßpflanzenflora und Vegetation des Bezirks Baden 234 Zitate. Davon sind 190 Veröffentlichungen, 22 universitäre wissenschaftliche Arbeiten und 22 „Graue Literatur“-Zitate. Einleitung Die hier präsentierte Zusammenstellung versucht alle relevanten Veröffentlichungen, wissenschaftli- chen Arbeiten (Hausarbeiten, Diplom- und Masterarbeiten, Dissertationen,) und unveröffentlichten Projektberichte („Graue Literatur“) zu den Themen Farn- und Blütenpflanzen (Gefäßpflanzen) und Vegetation für den Bezirk Baden bis einschließlich dem Jahr 2016 aufzulisten und zu kommentieren. Die Suche nach dementsprechenden Zitaten erfolgte einerseits über verschiedene Literaturverzeich- nisse, andererseits mithilfe von Internet-Suchmaschinen und Online-Datenbanken. Diese Biliographie stellt eine Vorarbeit für die in Planung befindliche „Flora und Vegetation des Be- zirks Baden“ dar. Gebietsbeschreibung Der Bezirk Baden ( Abb. -

Alpenkonvention in Niederösterreich
Alpenkonvention in Niederösterreich Niederösterreichische Gemeinden Anwendungsbereich Alpenkonvention innerhalb des Anwendungsbereiches außerhalb des Anwendungsbereiches Waidhofen an der Thaya Bezirksgrenze Horn Gmünd Hollabrunn Mistelbach Zwettl Krems (Land) Korneuburg Bezirk Amstetten mit 9 Gemeinden Krems an der Donau (Stadt) Tulln Bezirk Baden mit 15 Gemeinden Wien Umgebung Gänserndorf Bezirk Lilienfeld mit 14 Gemeinden Wien Umgebung Melk Sankt Pölten (Stadt) Bezirk Melk mit 1 Gemeinde Sankt Pölten (Land) Wien Umgebung Mödling Amstetten Bruck an der Leitha Bezirk Mödling mit 10 Gemeinden Bezirk Neunkirchen mit 40 Gemeinden Baden Waidhofen an der Ybbs (Stadt) Scheibbs Lilienfeld Bezirk St. Pölten (Land) mit 19 Gemeinden Wiener Neustadt (Land) Amstetten Wiener Neustadt (Stadt) Bezirk Scheibbs mit 13 Gemeinden Bezirk Tulln mit 5 Gemeinden Neunkirchen Bezirk Wiener Neustadt (Land) mit 29 Gemeinden Wiener Neustadt (Land) Bezirk Wien-Umgebung mit 7 Gemeinden 0 5 10 20 Grafik: Kudrnovsky / CIPRA Österreich 2008 Datenquellen: NÖGIS, BGBl.Nr 477/1995 geändert durch BGBl. III Nr. 18/1999 Kilometer ± BUNDESLAND Hohenberg Grünbach am Schneeberg Neulengbach Hollenthon NIEDERÖSTERREICH Kaumberg Kirchberg am Wechsel Neustift-Innermanzing Katzelsdorf (Quelle: BGBl..Nr. 477/1995 zuletzt Kleinzell Mönichkirchen Pyhra Kirchschlag in der Buckligen Welt ergänzt durch BGBl. III Nr. 18/1999) Lilienfeld Natschbach-Loipersbach Rabenstein an der Pielach Krumbach Mitterbach am Erlaufsee Otterthal Schwarzenbach an der Pielach Lanzenkirchen Waidhofen an der Ybbs