KKK-Broschuere-Pdf.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abfallkalender 2021
Sperrgut ab 2021 Dienstags! 2021 ab Sperrgut weitere Informationen zur Grünabfallannahme siehe Tipps für... für... Tipps siehe Grünabfallannahme zur Informationen weitere Grünabfallannahme = Sperrgutabfuhr = Sperr Sack Gelber = Gelb Gebühr gegen Kühlgeräte/Elektrogeräte = K/E Bioabfall = Bio Sperr Blau Gelb Bio Rest Meine Abfuhrbezirke Meine = Problemabfälle = Problem Papiertonne = Blau gereinigt Tonne die wird Bioabfuhr der nach = Bio/Spül Restabfall = Rest Gelb 1 Gelb 1 Blau 1 Bio MO 31 3 Rest MI 31 SO 31 Zu entsorgen bei 22. Umweltstation Bioabfallbehälter Bioabfallbehälter, Kompost Restabfall Umweltstation gelber Sack Restabfall Restabfall Restabfall Restabfall Restabfall Restabfall Restabfall gelber Sack gelber Sack Bioabfallbehälter Umweltstation Restabfall Bioabfallbehälter, Kompost Umladeanlage Gevelsberg Restabfall Restabfall Restabfall Bioabfallbehälter gelber Sack Umladeanlage Restabfall gelber Sack Altkleidercontainer, Restmüll Restabfall oder Umladeanlagen Restabfall Bioabfallbehälter Restabfall oder Umladeanlagen Sperrgutabfuhr Umweltstation Umladeanlage Gevelsberg Restabfall Restabfall gelber Sack Umladeanlage Gevelsberg Umweltstation Restabfall Gelb 3 Gelb 3 Blau 3 Bio MI 30 SO 30 5 Rest FR 30 2 Rest DI 30 SA 30 Gelb 2 Gelb 2 Blau 2 Bio DI 29 5 Rest SA 29 4 Rest DO 29 1 Rest MO 29 13. 5 Gelb 5 Bio FR 29 Gelb 1 Gelb 1 Blau 1 Bio MO 28 26. 4 Rest FR 28 3 Rest MI 28 SO 28 SO 28 4 Gelb 4 Bio DO 28 SO 27 3 Rest DO 27 2 Rest DI 27 Platsch ggü. Grünabfall. SA 27 SA 27 3 Gelb 3 Bio MI 27 SA 26 4 Sperr 2 Rest MI 26 1 Rest MO 26 17. 5 Gelb 5 Bio FR 26 5 Gelb 5 Bio FR 26 4 Sperr 2 Gelb 2 Bio DI 26 Problem Kirmespl.Voerde Grünabf. -

(Förderschule) in Gevelsberg
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Gevelsberg und Hattingen über den Besuch der Hasencleverschule (Förderschule) in Gevelsberg Gemäß den Vorschriften der §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1. Oktober 1979 (SGV. NRW 202) in der zurzeit geltenden Fassung schließen die Städte Gevelsberg und Hattingen die folgende öffentlich- rechtliche Vereinbarung über den Besuch der Hasencleverschule in Gevelsberg ab. Präambel Aufgrund der allgemein sinkenden Schülerzahlen und der gleichzeitig steigenden Beschulung im Gemeinsamen Unterricht (Inklusion) ist es künftig nicht möglich, die bestehende Förderschule in Hattingen fortzuführen. Die gemäß der gültigen Verord- nung über die Mindestschülerzahlen an Förderschulen vorgeschriebene Mindestzahl wird von der Schule bereits jetzt schon nicht mehr erreicht. Damit die betroffenen Familien auch in Zukunft die Möglichkeit haben, Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf an Förderschulen beschulen zu lassen, schließen die Städte Gevelsberg und Hattingen diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung ab. § 1 Schülerinnen und Schüler aus Hattingen mit einem den Förderschwerpunkten der Gevelsberger Förderschule entsprechenden sonderpädagogischen Unterstützungs- bedarf, deren nächstgelegene Förderschule die Hasencleverschule in Gevelsberg ist, können ab 01.08.2016 die Gevelsberger Förderschule besuchen. In Zweifelsfäl- len entscheidet das Schulamt für den Ennepe-Ruhr-Kreis darüber, welche Schule die nächstgelegene Förderschule ist. § 2 Für die Beschulung -

1/110 Allemagne (Indicatif De Pays +49) Communication Du 5.V
Allemagne (indicatif de pays +49) Communication du 5.V.2020: La Bundesnetzagentur (BNetzA), l'Agence fédérale des réseaux pour l'électricité, le gaz, les télécommunications, la poste et les chemins de fer, Mayence, annonce le plan national de numérotage pour l'Allemagne: Présentation du plan national de numérotage E.164 pour l'indicatif de pays +49 (Allemagne): a) Aperçu général: Longueur minimale du numéro (indicatif de pays non compris): 3 chiffres Longueur maximale du numéro (indicatif de pays non compris): 13 chiffres (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 chiffres Services de radiomessagerie (NDC 168, 169): 14 chiffres) b) Plan de numérotage national détaillé: (1) (2) (3) (4) NDC (indicatif Longueur du numéro N(S)N national de destination) ou Utilisation du numéro E.164 Informations supplémentaires premiers chiffres du Longueur Longueur N(S)N (numéro maximale minimale national significatif) 115 3 3 Numéro du service public de l'Administration allemande 1160 6 6 Services à valeur sociale (numéro européen harmonisé) 1161 6 6 Services à valeur sociale (numéro européen harmonisé) 137 10 10 Services de trafic de masse 15020 11 11 Services mobiles (M2M Interactive digital media GmbH uniquement) 15050 11 11 Services mobiles NAKA AG 15080 11 11 Services mobiles Easy World Call GmbH 1511 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Services mobiles Telekom Deutschland GmbH 1517 -

The Districts of North Rhine-Westphalia
THE DISTRICTS OF NORTH RHINE-WESTPHALIA S D E E N R ’ E S G N IO E N IZ AL IT - G C CO TIN MPETENT - MEE Fair_AZ_210x297_4c_engl_RZ 13.07.2007 17:26 Uhr Seite 1 Sparkassen-Finanzgruppe 50 Million Customers in Germany Can’t Be Wrong. Modern financial services for everyone – everywhere. Reliable, long-term business relations with three quarters of all German businesses, not just fast profits. 200 years together with the people and the economy. Sparkasse Fair. Caring. Close at Hand. Sparkassen. Good for People. Good for Europe. S 3 CONTENTS THE DIstRIct – THE UNKnoWN QUAntITY 4 WHAT DO THE DIstRIcts DO WITH THE MoneY? 6 YoUTH WELFARE, socIAL WELFARE, HEALTH 7 SecURITY AND ORDER 10 BUILDING AND TRAnsPORT 12 ConsUMER PRotectION 14 BUSIness AND EDUCATIon 16 NATURE conseRVAncY AND enVIRonMentAL PRotectIon 18 FULL OF LIFE AND CULTURE 20 THE DRIVING FORce OF THE REGIon 22 THE AssocIATIon OF DIstRIcts 24 DISTRIct POLICY AND CIVIC PARTICIPATIon 26 THE DIRect LIne to YOUR DIstRIct AUTHORITY 28 Imprint: Editor: Dr. Martin Klein Editorial Management: Boris Zaffarana Editorial Staff: Renate Fremerey, Ulrich Hollwitz, Harald Vieten, Kirsten Weßling Translation: Michael Trendall, Intermundos Übersetzungsdienst, Bochum Layout: Martin Gülpen, Minkenberg Medien, Heinsberg Print: Knipping Druckerei und Verlag, Düsseldorf Photographs: Kreis Aachen, Kreis Borken, Kreis Coesfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreis Gütersloh, Kreis Heinsberg, Hochsauerlandkreis, Kreis Höxter, Kreis Kleve, Kreis Lippe, Kreis Minden-Lübbecke, Rhein-Kreis Neuss, Kreis Olpe, Rhein-Erft-Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Steinfurt, Kreis Warendorf, Kreis Wesel, project photos. © 2007, Landkreistag Nordrhein-Westfalen (The Association of Districts of North Rhine-Westphalia), Düsseldorf 4 THE DIstRIct – THE UNKnoWN QUAntITY District identification has very little meaning for many people in North Rhine-Westphalia. -

Beratungsstellen Für Migrantinnen Und Migranten Im Ennepe-Ruhr-Kreis
Beratungsstellen für Migrantinnen und Migranten im Ennepe-Ruhr-Kreis Stand: 18.03.2020 Angebotsart Organisation Angebote Zielgruppe Ort Angebotsadresse Einzugsgebiet Ansprechperson Öffnungszeiten Telefon / Fax E-Mail Vielfalt-EN Homepage dienstags von 15 - 17 Uhr, 02332 55 56 53 http://www.awo- Gevelsberg Mühlenstraße 5 Gevelsberg Marina Böhm [email protected] http://vielfalt-en.de/#677 mittwochs von 9 - 11 Uhr 0151 16 16 23 22 en.de/Jugendmigrationsdienst • Beratung (Schwerpunkt Ü S/B) 02332 55 56 51 Hattingen, Sabine Görke-Becker / montags von 14 - 17 Uhr [email protected] http://www.awo- --> sonst alle Lebenslagen • 12 - 26 jährige Hattingen Talstraße 8 0170 334 01 87; 02324 38 http://vielfalt-en.de/#676 Sprockhövel Rita Nachtigal mittwochs von 13 - 15 Uhr [email protected] en.de/Jugendmigrationsdienst • Kursangebote (für Jugendl. u. Frauen) • alle Migranten 09 30 62 Jugendmigrationsdienst (JMD) AWO-EN • Casemanagement (langfrist. Begleitung) • alle Jugendlichen im Schwelm, 1. und 3. Donnerstag im Monat von 02332 55 56 53 http://www.awo- • Begleitung d. Jugendintegrationskurse Kreisgebiet Schwelm Märkische Straße 16 Marina Böhm [email protected] http://vielfalt-en.de/#677 Ennepetal 15 - 17 Uhr 0151 16 16 23 22 en.de/Jugendmigrationsdienst (trägerfremde) Witten, Wetter, donnerstags von 9 - 11 Uhr und 15 - 02332 55 56 52 http://www.awo- Witten Johannisstraße 6 Larissa Boguta [email protected] http://vielfalt-en.de/#28 Herdecke 17 Uhr 0151 16 16 23 24 en.de/Jugendmigrationsdienst • Casemanagement http://www.caritas- Witten, Wetter, • Begleitung von Kursen Witten Marienplatz 2 Heike Terhorst nach Absprache 02302 910 90 40 [email protected] http://vielfalt-en.de/#543 witten.de/caritas- Herdecke • Koordinierung der Kursplätze migration/migrationsberatung Caritas Casemanagement – Einzel- und Familienberatung / sozialpäd. -

Stadt Ennepetal Sabine Hofmann Bismarckstraße 21, 58256
Die Salonbetreiberinen ― Ihre Ansprechpartnerinnen für Chancengleichheit und Ihre Salon-Ideen: Stadt Ennepetal Stadt Schwelm Sabine Hofmann Annika Appelkamp-Decker Bismarckstraße 21, 58256 Ennepetal Hauptstr. 14, 58332 Schwelm 02333 979-207 02336 801-209 [email protected] [email protected] Stadt Gevelsberg VHS Ennepe-Ruhr-Süd Christel Hofschröer Rita Miegel Rathausplatz 1, 58285 Gevelsberg Mittelstr. 86-88, 58285 Gevelsberg 02332 771-124 02332 9186-138 [email protected] [email protected] Stadt Sprockhövel Kreisverwaltung des Ennepe-Ruhr-Kreises Sabine Schlemmer Petra Bredow Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel Hauptstr. 92, 58332 Schwelm 02339 917-347 02336 932430 [email protected] [email protected] Sprockhövel und des Ennepe-Ruhr-Kreises. des und Sprockhövel Gastgeberinnen sind die VHS im Ennepe-Ruhr-Südkreis und die Gleichstellungsbeauftragten der Städte Ennepetal, Gevelsberg, Schwelm, Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal, Städte der Gleichstellungsbeauftragten die und Ennepe-Ruhr-Südkreis im VHS die sind Gastgeberinnen schen vor und lädt zum Mitmachen ein. ein. Mitmachen zum lädt und vor schen Der Salon geht immer mal wieder auf Reisen, macht an frauen- und kulturstarken Orten Station. Er stellt Projekte, Gruppen und Men und Gruppen Projekte, stellt Er Station. Orten kulturstarken und frauen- an macht Reisen, auf wieder mal immer geht Salon Der - Männer gleichermaßen gut entwickeln und in ihrer ganzen Vielfalt einbringen können. können. einbringen Vielfalt ganzen ihrer in und entwickeln gut gleichermaßen Männer bewegen, Veränderungen anstoßen und ein lustvolles Wachstum ermöglichen. Die Vision ist eine Gesellschaft, in der sich Frauen und und Frauen sich der in Gesellschaft, eine ist Vision Die ermöglichen. Wachstum lustvolles ein und anstoßen Veränderungen bewegen, im Ennepe-Ruhr-Südkreis im 9. -

Informationen Zur Abfallanlieferung Aus Privathaushalten Gültig Vom 1.1
Informationen zur Abfallanlieferung aus Privathaushalten gültig vom 1.1. - 31.12.2017 Abfallart Gebühr in € Restmüll: PKW-Anlieferung: pauschal 20,00 (gemischter Siedlungsabfall) PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 175,00 Gewicht < 200 kg 25,00 Sperrmüll: PKW-Anlieferung: pauschal 20,00 PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 175,00 Gewicht < 200 kg 25,00 Bio- und Grünabfall: PKW-Anlieferung: pauschal 7,50 PKW-5er-Karte Grüner Spar(s)pass 25,00 PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 95,00 Gewicht < 200 kg 10,00 PKW-Altreifen: pro Stück (auch mit Felge) 7,00 Gewicht > 200 kg 498,00 Bauschutt: PKW-Anlieferung: pauschal 7,50 PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 40,00 Gewicht < 200 kg 8,00 Bau- und Abbruchabfall: PKW-Anlieferung: pauschal 20,00 PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 180,00 Gewicht < 200 kg 25,00 Asbestabfall PKW-Anlieferung: pauschal 20,00 PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 970,00 Gewicht < 200 kg 20,00 Mineralfaserabfall PKW-Anlieferung: pauschal 20,00 PKW mit Anhänger, Kleintransporter o.ä. nach Verwiegung pro Tonne 1.200,00 Gewicht < 200 kg 100,00 Elektroaltgeräte, Kühlgeräte, Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen, Verpackungsstyropor, Problemabfall, Kunststoff (ausschließlich Hartkunststoffe) kostenlos Achtung: Gasflaschen und Gasdruckpatronen können zusammen mit Altmetall nicht mehr kostenlos angenommen werden. Fahrzeuge, die als PKW angemeldet sind und deren maximale Zuladung (zulässiges Gesamtgewicht abzüglich Leergewicht) nach der Zulassungsbescheinigung 800 kg überschreitet, werden generell gewogen. Die Höhe der Entsorgungsgebühr errechnet sich ausschließlich nach dem Gewicht soweit die Abfallmenge von 200 kg überschritten wird. -

1/98 Germany (Country Code +49) Communication of 5.V.2020: The
Germany (country code +49) Communication of 5.V.2020: The Bundesnetzagentur (BNetzA), the Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway, Mainz, announces the National Numbering Plan for Germany: Presentation of E.164 National Numbering Plan for country code +49 (Germany): a) General Survey: Minimum number length (excluding country code): 3 digits Maximum number length (excluding country code): 13 digits (Exceptions: IVPN (NDC 181): 14 digits Paging Services (NDC 168, 169): 14 digits) b) Detailed National Numbering Plan: (1) (2) (3) (4) NDC – National N(S)N Number Length Destination Code or leading digits of Maximum Minimum Usage of E.164 number Additional Information N(S)N – National Length Length Significant Number 115 3 3 Public Service Number for German administration 1160 6 6 Harmonised European Services of Social Value 1161 6 6 Harmonised European Services of Social Value 137 10 10 Mass-traffic services 15020 11 11 Mobile services (M2M only) Interactive digital media GmbH 15050 11 11 Mobile services NAKA AG 15080 11 11 Mobile services Easy World Call GmbH 1511 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1512 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1514 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1515 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1516 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1517 11 11 Mobile services Telekom Deutschland GmbH 1520 11 11 Mobile services Vodafone GmbH 1521 11 11 Mobile services Vodafone GmbH / MVNO Lycamobile Germany 1522 11 11 Mobile services Vodafone -

S-Bahn Linie S8 Fahrpläne & Karten
S-Bahn Linie S8 Fahrpläne & Netzkarten Hagen - Mönchengladbach Im Website-Modus Anzeigen Die S-Bahn Linie S8 (Hagen - Mönchengladbach) hat 2 Routen (1) Mönchengladbach: 24 Stunden (2) Hagen: 00:54 - 23:54 Verwende Moovit, um die nächste Station der S-Bahn Linie S8 zu ƒnden und, um zu erfahren wann die nächste S-Bahn Linie S8 kommt. Richtung: Mönchengladbach S-Bahn Linie S8 Fahrpläne 26 Haltestellen Abfahrzeiten in Richtung Mönchengladbach LINIENPLAN ANZEIGEN Montag 24 Stunden Dienstag 24 Stunden Hagen Hauptbahnhof Mittwoch 24 Stunden Hagen Wehringhausen - Hagen Schlachthofstraße, Hagen Donnerstag 24 Stunden Hagen Heubing Bf. - Hagen Freitag 24 Stunden Samstag 24 Stunden Hagen Westerbauer Bf. - Hagen Nordstraße 9002, Hagen Sonntag 24 Stunden Gevelsberg-Knapp - Gevelsberg Gevelsberg Hbf Rheinische Straße, Gevelsberg S-Bahn Linie S8 Info Richtung: Mönchengladbach Gevelsberg-Kipp - Gevelsberg Stationen: 26 Heidestraße 21, Gevelsberg Fahrtdauer: 99 Min Linien Informationen: Hagen Hauptbahnhof, Hagen Gevelsberg West - Gevelsberg Wehringhausen - Hagen, Hagen Heubing Bf. - Hagen, Am Erlenfeld 3, Gevelsberg Hagen Westerbauer Bf. - Hagen, Gevelsberg-Knapp - Gevelsberg, Gevelsberg Hbf, Gevelsberg-Kipp - Schwelm Bf. Gevelsberg, Gevelsberg West - Gevelsberg, Schwelm Bahnhofplatz 2, Schwelm Bf., Schwelm West - Schwelm, Wuppertal Langerfeld Bf - Wuppertal, Oberbarmen Bf - Wuppertal, Schwelm West - Schwelm Wuppertal, Barmen Bf, Wuppertal Unterbarmen Bf - Wuppertal, Wuppertal Hauptbahnhof, Wuppertal Wuppertal Langerfeld Bf - Wuppertal Steinbeck Bf - Wuppertal, -

Hochwasserrisiko Und Maßnahmenplanung Ennepetal
Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Ennepetal Stand März 2021 Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW Hochwasserrisiko und Maßnahmenplanung Ennepetal Die Karte zeigt die Risikogewässer und die Ausdehnung der Überflutung für das extreme Hochwasserereignis (HQextrem) im 2.Umsetzungszyklus 2016-2021 der HWRM-RL. Bezirksregierung Arnsberg Hochwasserrisikomanagementplanung NRW Kommunensteckbrief Ennepetal Stand März 2021 Der Kommunensteckbrief stellt die Maßnahmenplanung zur Verminderung von Hochwasserrisiken in Ihrer Kommune dar. Die Maßnahmenplanung ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der europäischen Hochwas- serrisikomanagementrichtlinie (HWRM-RL) in Ihrer Region. Sie wurde auf der Grundlage der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten für die Gewässer mit potenziellem signi- fikantem Hochwasserrisiko, die sogenannten Risikogewässer, erarbeitet. Mithilfe der Karten erkennen Sie, wo in Ihrer Region oder Ihrer Stadt konkret Gefahren und Risiken durch Hochwasser bestehen. Die aktuellen Gefahren- und Risikokarten und viele weitere Informationen zum Hochwasserrisikomanagement in NRW finden Sie auf der Inter- netseite flussgebiete.nrw.de oder in den Kartendiensten elwasweb.nrw.de bzw. uvo.nrw.de. Von welchen Risikogewässern ist Ihre Kommune betroffen? Teileinzugsgebiet (TEG) Ruhr Flussgebiete NRW > TEG Ruhr Ennepe Hasper Bach Heilenbecke Teileinzugsgebiet (TEG) Wupper Flussgebiete NRW > TEG Wupper Wupper Hinweis: Eine Hochwassergefährdung kann sich auch durch Gewässer ergeben, die hier nicht aufgeführt sind. -

Fliedner Klinik Gevelsberg“ Anfahrt Mit Dem Auto: Von Der A46: Bis Ende, Re
Fliedner Klinik Witten 1 Dortmund Gevelsberg 43 Gevelsberg Autobahnkreuz Wuppertal-Nord S Hochstr . Mittelstr . r . 46 Rosendahler Str Brunnenstr Str Wuppertal Sudfeldst Klinik Milsper 1 . Gevelsberg Südstr r. Schwelm Kampst . Ennepetal Institutsambulanz Anfahrt Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Ab Gev. Hbf: Buslinien 551, 556 oder 563 bis „Südstraße“ oder 551 bis „Fliedner Klinik Gevelsberg“ Anfahrt mit dem Auto: Von der A46: bis Ende, re. Rtg. Schwelm, erste große Kreuzung li. Rtg. Gev., Rtg. Gev. Stadtmitte; Wegweisern Fliedner Klinik folgen. A1 aus Rtg. Köln: Abfahrt Gev/Wuppertal Nord, einordnen Rtg. Schwelm/ Gev., Rtg. Gev. Stadtmitte, Wegweisern Fliedner Klinik folgen. A1 aus Rtg. Hagen: Abf. Gev., li. Auf Eichholzstr., erste Kreuzung re. auf Wittener Str., Rtg. Gev. Stadtmitte; Wegweisern Fliedner Klinik folgen. A43 aus Rtg. Bochum: Abfahrt Sprockhövel/Gev., re. auf B51, Rtg. Gev. Stadtmitte; Wegweisern Fliedner Klinik folgen. Unsere Hausanschrift Ambulanz und Tagesklinik Fliedner Klinik Gevelsberg für Psychiatrie, Psychotherapie und Ambulanz und Tagesklinik für Psychiatrie, Psychosomatik Psychotherapie und Psychosomatik Sudfeldstr. 1 58285 Gevelsberg Kontakt Telefon: (02332) 66 43 - 0 Telefax: (02332) 66 43 - 33 [email protected] www.fliednerklinikgevelsberg.de Die Ambulanz der Darüber hinaus behandeln wir folgende Fliedner Klinik Gevelsberg Schwerpunktbereiche: Unsere Institutsambulanz ergänzt, als Teil der • Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen Fliedner Klinik im Zentrum von Gevelsberg, seit (ADHS) 2010 das teilstationäre Behandlungsangebot und • Psychische Störungen im Seniorenalter bietet Diagnostik und Behandlung für erwachsene Patienten. Dabei richtet sich unser Angebot an • Emotional instabile Persönlichkeitsstörungen Menschen, die wegen der Art und Schwere ihrer (Borderline Typus, impulsiver Typus) psychischen Erkrankung auf ein breites Spektrum Unser multiprofessionelles Team besteht aus ÄrztInnen, an ambulanten psychiatrischen und psychothera- PsychologInnen und SozialarbeiterInnen. -
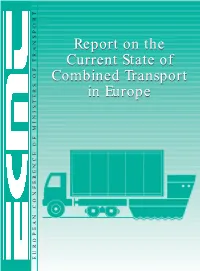
View Its System of Classification of European Rail Gauges in the Light of Such Developments
ReportReport onon thethe CurrentCurrent StateState ofof CombinedCombined TransportTransport inin EuropeEurope EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS TRANSPORT EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT REPORT ON THE CURRENT STATE OF COMBINED TRANSPORT IN EUROPE EUROPEAN CONFERENCE OF MINISTERS OF TRANSPORT (ECMT) The European Conference of Ministers of Transport (ECMT) is an inter-governmental organisation established by a Protocol signed in Brussels on 17 October 1953. It is a forum in which Ministers responsible for transport, and more speci®cally the inland transport sector, can co-operate on policy. Within this forum, Ministers can openly discuss current problems and agree upon joint approaches aimed at improving the utilisation and at ensuring the rational development of European transport systems of international importance. At present, the ECMT's role primarily consists of: ± helping to create an integrated transport system throughout the enlarged Europe that is economically and technically ef®cient, meets the highest possible safety and environmental standards and takes full account of the social dimension; ± helping also to build a bridge between the European Union and the rest of the continent at a political level. The Council of the Conference comprises the Ministers of Transport of 39 full Member countries: Albania, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, the Former Yugoslav Republic of Macedonia (F.Y.R.O.M.), Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, the Russian Federation, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine and the United Kingdom. There are ®ve Associate member countries (Australia, Canada, Japan, New Zealand and the United States) and three Observer countries (Armenia, Liechtenstein and Morocco).